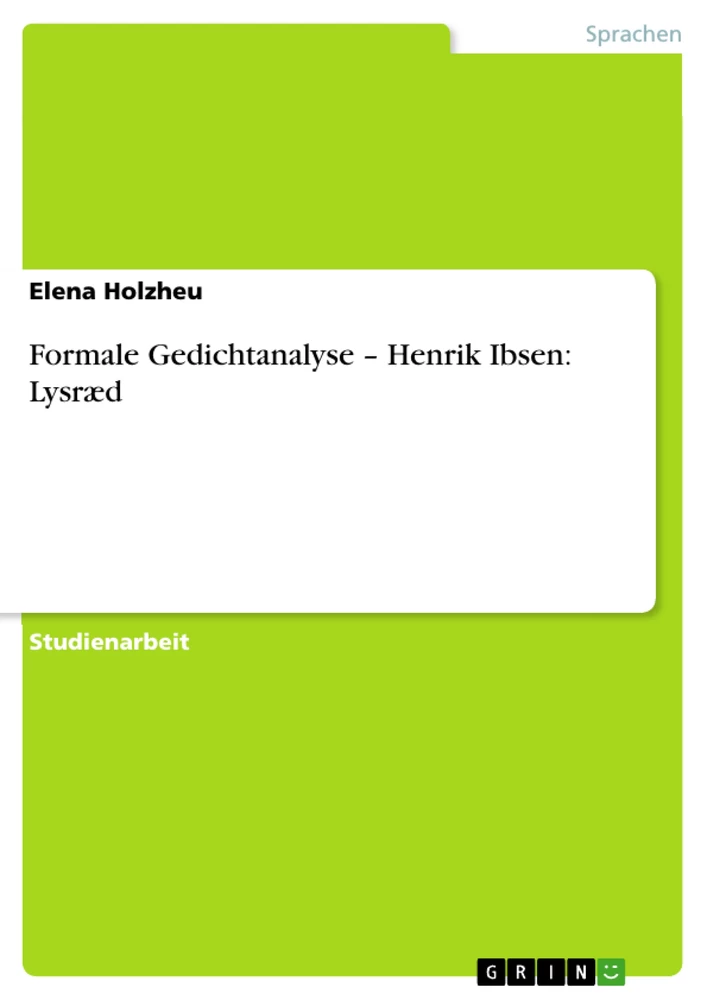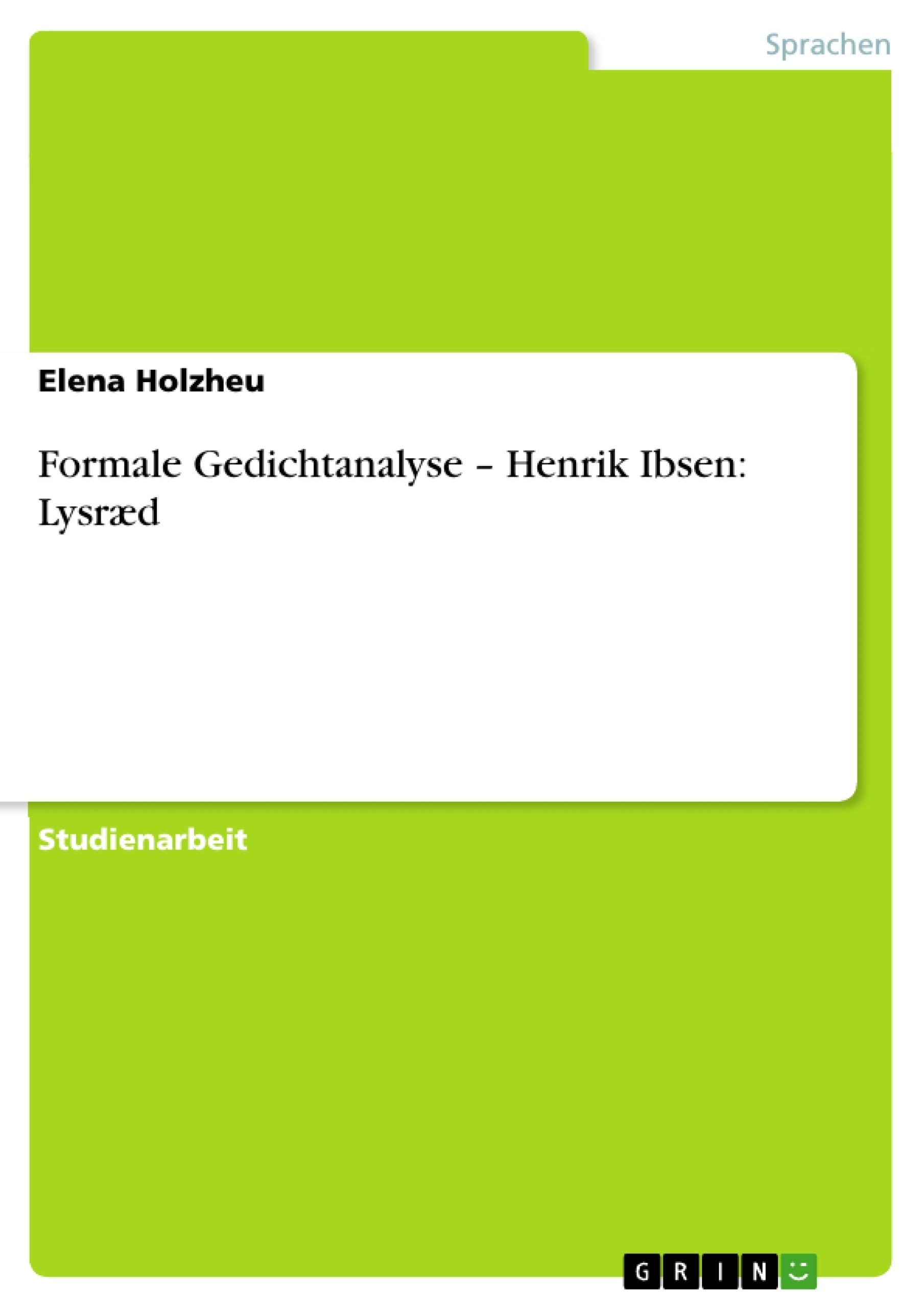Das von Henrik Ibsen im Jahre 1863 verfasste das Gedicht Lysræd beinhaltet acht Strophen zu je vier Versen und ist im Kreuzreim verfasst mit strikter Verwendung von Endreimen. Als Versmass verwendet Ibsen Jambus und Anapäst. Die Kadenz des Gedichts ist abwechselnd weiblich und männlich, wobei die erste Zeile weiblich und die letzte Zeile männlich ist. Der Titel des Gedichtes – „Lichtscheu“ – beschreibt einen Zustand. Das Gedicht zeigt die Entwicklung des lyrischen Ichs hin zu jenem Zustand. In Anbetracht dieser inhaltlichen Entwicklung lässt sich das Gedicht formal in vier Phasen einteilen: Phase 1 umfasst die erste Strophe, die das lyrische Ich in seiner Jugend im Wachzustand am Tage schildert. Phase 2 umfasst die Strophen zwei und drei wobei Strophe zwei denselben Jugendlichen im Wachzustand bei Nacht und Strophe drei im Traumzustand bei Nacht schildert. Phase 3 umfasst die Strophen vier und fünf und schildert das lyrische Ich in der Gegenwart als vermeintlich Erwachsener bei Tag. Phase 4 umfasst die Strophen sechs, sieben und acht. Sie schildert denselben Erwachsenen bei Nacht.
Inhaltsverzeichnis
- Phase 1: Tag - Mut
- Phase 2: Nacht - fehlender Mut
- Phase 3: Tag - fehlender Mut
- Phase 4: Nacht - Mut
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Henrik Ibsens Gedicht "Lysræd" (Lichtscheu) formal und thematisch. Die Analyse fokussiert auf die Entwicklung des lyrischen Ichs und die Beziehung zwischen Mut und den sich verändernden Umständen (Tag/Nacht).
- Formale Analyse des Gedichts (Versmaß, Reimschema, Kadenz)
- Thematische Entwicklung des lyrischen Ichs über die vier Phasen
- Das Motiv des Mutes und sein Zusammenhang mit Tag und Nacht
- Verwendung von Symbolen (z.B. Tag/Nacht, Falk)
- Die Wirkung der Tempuswechsel auf die Darstellung der Entwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
Phase 1: Tag - Mut: Diese Phase beschreibt die jugendliche Zuversicht des lyrischen Ichs am Tag. Der Mut wird als selbstverständlich und ungebrochen dargestellt. Die Sonne symbolisiert Sicherheit und Geborgenheit. Diese anfängliche Unbekümmertheit bildet einen Kontrast zu den späteren Phasen des Gedichts.
Phase 2: Nacht - fehlender Mut: Im Gegensatz zur ersten Phase, wird hier die Nacht als Quelle von Angst und Unsicherheit präsentiert. Die Dunkelheit und die damit verbundenen "Spukgestalten" lösen im lyrischen Ich Furcht aus. Der Verlust des Mutes ist direkt mit der nächtlichen Umgebung verknüpft. Dieser Abschnitt legt den Grundstein für die spätere Entwicklung.
Phase 3: Tag - fehlender Mut: Trotz des Tageslichts bleibt der Mut des lyrischen Ichs in dieser Phase geschwächt. Die "Trolle des Tages" und "der Lärm des Lebens" lösen weiterhin Ängste und Unbehagen aus. Dieser Abschnitt betont, dass die Quelle der Angst nicht allein in der Dunkelheit der Nacht liegt, sondern auch im Leben selbst bestehen kann. Die anhaltende Unsicherheit trotz der helligkeit des Tages unterstreicht die Komplexität der emotionalen Entwicklung.
Phase 4: Nacht - Mut: In dieser letzten Phase findet eine Umkehrung statt. Der Mut kehrt zurück, obwohl das lyrische Ich sich in der Nacht befindet. Die "Dunkelheit" wird nun als Schutzraum wahrgenommen, in dem es seine Ängste überwindet. Der Mut wird als aktive Kraft dargestellt, die den Herausforderungen trotzt, obwohl der Kontext (Nacht) weiterhin negativ konnotiert ist. Der Abschluss, der einen möglichen "Triumph" in der Dunkelheit ankündigt, vermittelt ein komplexes Bild der Entwicklung und den Umgang mit Angst und Mut.
Schlüsselwörter
Lysræd, Henrik Ibsen, Gedichtanalyse, Formale Analyse, Thematische Analyse, Mut, Angst, Tag, Nacht, Symbole, Personifikation, Tempuswechsel, Jambus, Anapäst, Entwicklung des lyrischen Ichs.
Häufig gestellte Fragen zu Henrik Ibsens "Lysræd" (Lichtscheu)
Was ist der Inhalt dieser Gedichtanalyse?
Diese Arbeit analysiert Henrik Ibsens Gedicht "Lysræd" (Lichtscheu) umfassend. Sie beinhaltet eine formale und thematische Analyse, die sich auf die Entwicklung des lyrischen Ichs und die Beziehung zwischen Mut und den sich verändernden Umständen (Tag/Nacht) konzentriert. Die Analyse umfasst eine Zusammenfassung der vier Phasen des Gedichts, eine Beschreibung der Zielsetzung und der wichtigsten Themen sowie eine Liste der Schlüsselbegriffe.
Welche Phasen werden in "Lysræd" unterschieden?
Das Gedicht wird in vier Phasen unterteilt: Phase 1 (Tag - Mut), Phase 2 (Nacht - fehlender Mut), Phase 3 (Tag - fehlender Mut) und Phase 4 (Nacht - Mut). Jede Phase repräsentiert einen anderen Zustand des lyrischen Ichs in Bezug auf Mut und die damit verbundenen Umgebungsbedingungen (Tag und Nacht).
Wie wird der Mut im Gedicht dargestellt?
Der Mut wird als zentrale Thematik behandelt und seine Beziehung zu den sich ändernden Umständen (Tag und Nacht) analysiert. In den "Tag"-Phasen ist der Mut zunächst vorhanden, geht dann verloren, um in der letzten Nachtphase wieder zurückzukehren. Die Nacht wird anfänglich als Quelle der Angst dargestellt, wird aber am Ende als Ort der Selbstfindung und des neu gewonnenen Mutes interpretiert.
Welche formalen Aspekte werden in der Analyse berücksichtigt?
Die formale Analyse umfasst das Versmaß, das Reimschema, die Kadenz und den Gebrauch von Tempuswechseln. Diese Elemente werden untersucht, um ihren Einfluss auf die Darstellung der emotionalen Entwicklung des lyrischen Ichs zu verstehen.
Welche Symbole spielen eine Rolle in "Lysræd"?
Wichtige Symbole im Gedicht sind Tag und Nacht, die jeweils unterschiedliche emotionale Zustände des lyrischen Ichs repräsentieren. Weitere Symbole können "Spukgestalten", "Trolle des Tages" oder der "Falk" sein (je nach Interpretation und Kontext im Gedicht). Die Bedeutung dieser Symbole wird im Rahmen der Analyse näher beleuchtet.
Wie entwickelt sich das lyrische Ich im Laufe des Gedichts?
Das lyrische Ich durchläuft eine Entwicklung, die durch den Wechsel zwischen Mut und Angst gekennzeichnet ist. Die anfängliche Zuversicht weicht der Unsicherheit, bevor schließlich ein neu gewonnener Mut, sogar in der Nacht, erreicht wird. Diese Entwicklung wird sowohl durch die thematische als auch die formale Analyse des Gedichts nachvollzogen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Analyse von "Lysræd"?
Schlüsselwörter sind: Lysræd, Henrik Ibsen, Gedichtanalyse, Formale Analyse, Thematische Analyse, Mut, Angst, Tag, Nacht, Symbole, Personifikation, Tempuswechsel, Jambus, Anapäst, Entwicklung des lyrischen Ichs.
Welche Zusammenfassung der einzelnen Phasen wird geboten?
Für jede der vier Phasen wird eine detaillierte Zusammenfassung gegeben, die den emotionalen Zustand des lyrischen Ichs, die relevanten Symbole und die Beziehung zwischen dem Kontext (Tag/Nacht) und dem Mut beschreibt. Diese Zusammenfassungen bieten einen Überblick über die Entwicklung des Gedichts.
- Quote paper
- Elena Holzheu (Author), 2008, Formale Gedichtanalyse – Henrik Ibsen: Lysræd, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/126449