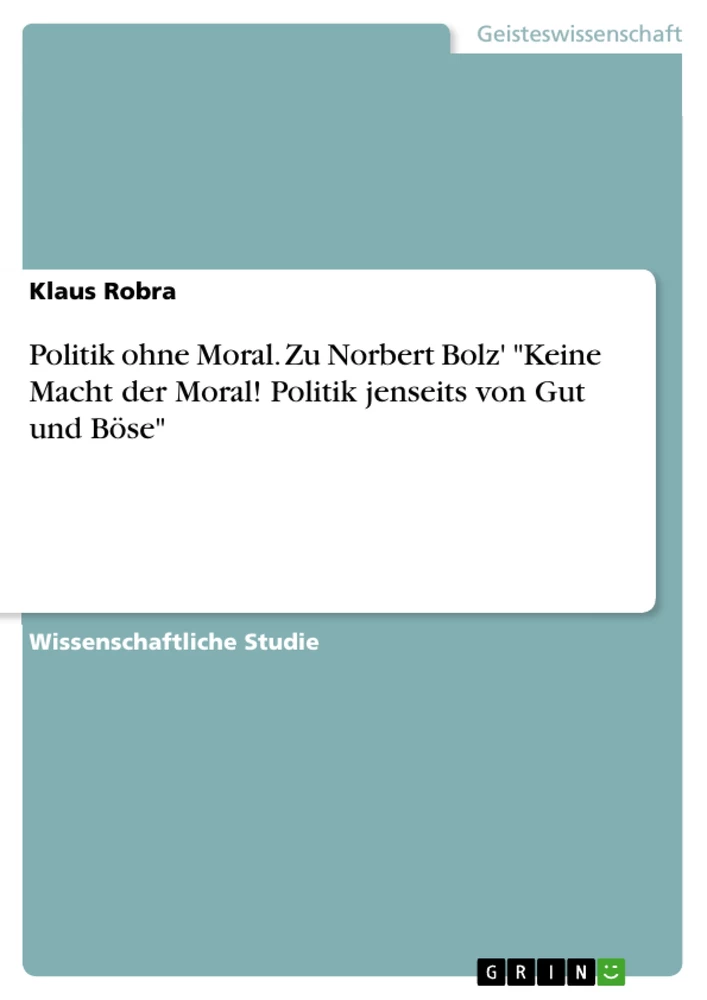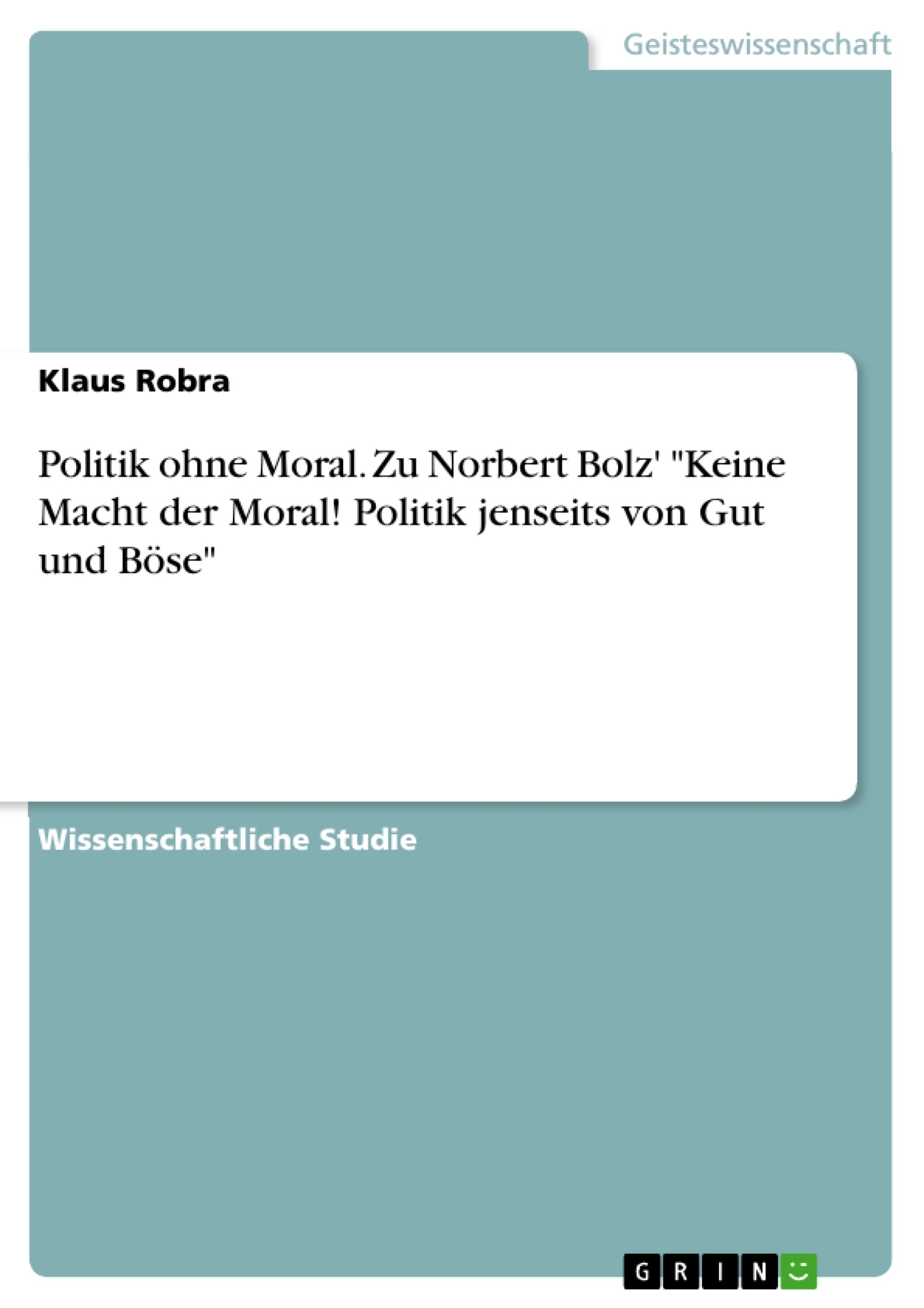Bolz sieht nicht, dass Menschen stets, d.h. von Natur aus, kulturfähige Moral-Wesen sind, sodass es eine Politik ohne Moral, „jenseits von Gut und Böse“, gar nicht geben kann. Was sich immer wieder bewahrheitet, z.B. auch an Figuren wie Napoleon, Hitler, Mussolini, Pol Pot, McCarthy, Nixon, Trump, Boris Johnson u.a., die allesamt an ihrer Unmoral gescheitert sind, die von den vernünftig, rechtsbewusst und anständig-Gebliebenen nicht toleriert wurde.
Schädlich ist Moral dann, wenn sie totalitär wird, ihre Grenzen überschreitet oder in bloßes Moralisieren umschlägt. Keinesfalls können Moral und Moralisieren an die Stelle der – stets unabdingbaren – konkreten Analyse der konkreten Situation treten.
1. Das antike bzw. das christliche Welt-, Menschen- und Gesellschaftsbild ist überholt. „Die Neuzeit steht nicht im Zeichen der Beobachtung, sondern der Konstruktion; sie sucht keinen natürlichen Weltzugang, sondern einen künstlichen.“ (a.a.O. S. 25) – „Der neuzeitliche Prozess der Technisierung und das Projekt der Aufklärung sind Reaktionen auf den Verlust von Ge-wissheiten und traditionellen Ordnungsvorstellungen, für die Begriffe wie Kosmos und Schöpfung stehen.“ (S. 26)
2. Gewaltverherrlichern und Moral-Verächtern wie Machiavelli, Hobbes und Carl Schmitt ist weitestgehend zuzustimmen. „Die Überzeugung, dass der Mensch von Natur böse, verworfen, Bestie, Pöbel ist (statt hinfällig, un-wissend, schwach und emanzipationsbedürftig), diese Auffassung gilt dem konstruierenden Staatskünstler der Renaissance und des anschließenden Absolutismus als Begründung dafür, dass er die zu organisierende Men-schenmenge als ein zu bevormundendes, bösartiges Material ansieht, dem gegenüber alle Mittel erlaubt sind.“ (Hugo Ball, S. 31).– „Der neue Fürst muss das Recht und die Moral auf Distanz halten.“ (S. 43) – „Machiavelli liebt den Staat, nicht die Leute. Erst der Staat macht den Menschen zum Menschen, und deshalb kann sich wahre Tugend nur im Staat entfalten.“ (S. 54) – „Für Machiavelli zählt die Größe der bösen Tat, man kann in Eh-ren schlecht sein. Cesare Borgia, figurales Zentrum des Principe, der itali-enische Renaissancefürst, der durch seine skrupellose Machtpolitik zur schwarzen Legende wurde, dient Machiavelli hier als Vorbild.“ (S. 74) – „Für Hobbes kann es schon deshalb kein höchstes Gut, kein letztes Ziel geben, weil menschliches Leben ein ununterbrochenes Begehren nach Macht und Ruhm ist, das erst mit dem Tod endet …“ (S. 81 f.) – „Natur ist für Hobbes ein feindliches Chaos, in dem um jeden Preis Ordnung ge-schaffen werden muss. Das leistet der Staat, der deshalb ein Artefakt sein muss. Es ist also nicht der natürliche, sondern der künstliche Mensch, der das gesellschaftliche Zusammenleben ermöglicht.“ (S. 85) – „Die Unter-werfung aller konstituiert die souveräne Einheit Staat. Der Schrecken der absoluten Macht – Hobbes spricht ausdrücklich von terror – bricht den Eigensinn aller und schafft den bürgerlichen Konformismus von Frieden und Eintracht.“ (S. 90) – „Das Gesetz gründet nicht in der Sittlichkeit des Guten und Gerechten, sondern umgekehrt: Was als moralisch gilt, be-stimmt das Gesetz. Dieses Gesetz wird nicht von der Wahrheit, sondern von der Autorität des Souveräns gesetzt, und nur dieser liefert dessen In-terpretation. So ersetzt Hobbes die Legitimität durch Autorität.“ (S. 93) – „Ein Gesetz ist für Hobbes im Kern ein Befehl – und der hat keinen Wahr-heitswert. Er hat mit Gerechtigkeit, Moral und Weisheit nichts zu tun. Alles Recht ist staatsimmanent. Und deshalb kann der Hobbes-Staat kein Unrecht begehen.“ (S. 96) – „Wie wir bereits bei Machiavelli und Hobbes gesehen haben, ist im Politischen die Klugheit wichtiger als die Weisheit, weil es nicht um Wissen, sondern um Entscheidung geht. Die persönliche Entscheidung leistet, was eine Norm niemals leisten kann: Sie verwirklicht >das gute Recht der richtig erkannten politischen Situation<.“ (Zit. Carl Schmitt, S. 136) – „Was politisch das Richtige ist, hängt so sehr von der konkreten Situation ab, dass im Grenzfall das Dass der Entscheidung wichtiger ist als das Was. Deshalb betont Schmitt, nur scheinbar gegen Max Weber, immer wieder »die unvermeidliche >Unsachlichkeit< aller politischen Entscheidungen«. Unsachlichkeit meint hier jedoch nicht Irrationalität, sondern die moralische Persönlichkeit und historische Be-stimmtheit durch die konkrete Situation.“ (S. 137) – „Die Diktatur im Ausnahmezustand offenbart die von Recht befreite Gewalt. Normalität be-ruht auf der in Recht verwandelten Gewalt.“ (Zu C. Schmitt, S. 149)
3. Hegels Staats- und Rechtsphilosophie ist korrekt – auch und gerade gegen-über Marx. „So kann Hegel sagen: »Die Formierung zur Freiheit selbst (Realisierung derselben) und zur Erhaltung derselben ist der Staat.«“ (S. 109) – „Der Grund des moralischen Protests gegen das Bestehende ist nicht das, was ist, sondern dass das, was ist, nicht ist, wie es sein soll. Hegels Sollenskritik will deshalb zeigen, dass das, was ist, sein muss – und deshalb sein soll.“ (S. 112) – „Wenn der Staat die Bedingung der Möglichkeit von Freiheit ist, dann ist jedes Mittel recht, das ihn vor ethischer oder religiöser Subversion schützt. Für Hegel ist es deshalb nur eine Trivialität der Moral, dass der Zweck die Mittel nicht heiligt, wenn es um die Rettung des Staates geht.“ (S. 115)
4. Max Weber hat Recht, wenn er der „Gesinnungsethik“ der Bergpredigt seine „Verantwortungsethik“ entgegenstellt. Politik ist zwar stets Kompro-miss mit dem Bösen, steht selbst aber jenseits moralischer Prinzipien. „Die Herrschaft liegt bei den Beamten, und sie vollzieht sich als Verwaltung unseres Alltags nach formal-rationalem Kalkül. Es ist eine Herrschaft kraft »Dienstwissen«. Der Beamte ist eine intelligente Maschine im modernen Staat, der als rationaler Betrieb funktioniert. Der neue Leviathan ist also nicht mehr auf den Souverän hin orientiert, sondern beruht auf der Bürokratie, die als perfekte Menschenmaschine funktioniert.“ (S. 119 f.) „Kampf ist das Hauptwort bei Weber. Er sieht das Leben geprägt von Konflikten und dem unstillbaren Willen zur Macht. Stets geht es dabei um die Herrschaft von Menschen über Menschen.“ (S. 123) – „Max Webers Pathos und Ethos der bewussten Lebensführung konzipiert das Leben als Kette eigener letzter Entscheidungen zwischen todfeindlichen Werten. Werte sind keine funktional äquivalenten Alternativen.“ (S. 126) „Es gibt kein wahres Wertesystem, das heißt, es gibt kein wahres Wissen von dem, was man tun soll. Hegels Sollenskritik wird von Weber also gerade wider-rufen. Die Kluft zwischen Sein und Sollen, zwischen Wirklichkeit und Wert ist unüberbrückbar – und deshalb liegt die Last der Entscheidung auf den Schultern jedes Einzelnen. Hier gibt es keinen Konsens und keine Vermittlung, weil jeder, der sich selbst versteht, seinem eigenen höchsten Wert folgen muss. Wert stößt auf Wert. Mit diesem Begriff der »Wert-kollision« schließt Weber einen Werterelativismus gerade aus.“ (S. 128) –
5. Wie Hobbes geht S. Freud von der grundsätzlichen, angeborenen Bosheit der Menschen aus. „Jacob Taubes schreibt: »Niemals seit Paulus und Augustin hat ein Theologe eine radikalere Lehre von der Erbsünde vertreten als Freud.« Seine Lehre bietet eine säkulare Version des Sünden-falls: Im Anfang war die Untat.“ (S. 151) „Die Ähnlichkeit mit dem Natur-zustand bei Hobbes ist verblüffend – nur dass Freud das Wechselspiel von Schutz und Gehorsam nicht am Verhältnis zum Staat, sondern zur Kultur exemplifiziert. Wie Hobbes gezeigt hat, dass die angsterfüllten Menschen zum Staat gezwungen werden, so zeigt Freud, wie die hilflosen Menschen zu Technik und Kultur gezwungen werden. Am Ende dieser Entwicklung – und deshalb heißt die Abhandlung Das Unbehagen in der Kultur – steht der unglückliche »Prothesengott«. Die Technik hat ihm die Herrschaft über die äußere Natur ermöglicht, aber doch nur um den Preis einer Kultur, die ihn zur Herrschaft über seine innere Natur zwingt.
Wie bei Hobbes heißt es auch bei Freud: »Die individuelle Freiheit ist kein Kulturgut.«“ (S. 152) – „Freud übernimmt … ausdrücklich Hobbes‘ anthropologisch-politische Grundthese, dass nämlich der Mensch dem Menschen ein Wolf sei. Er spricht von einer »primären Feindseligkeit«, die sofort durchbricht, wenn die Kultur ihre Zügel lockert und »den Menschen als wilde Bestie« enthüllt. Entsprechend deutet Freud das biblische Gebot der Nächstenliebe als eine Idealforderung, die der Natur des Menschen am meisten widerspricht. Er hat eine angeborene Neigung zur Aggression, die unaufhörlich die Kulturleistungen sabotiert; das ist die säkulare Erbsünde.“ (S. 153 f.)
6. Die Linke ist nicht mehr rot, sondern grün; sie folgt nicht mehr Marx, sondern Rousseau. „Mit dem Untergang der Sowjetunion zerplatzten die linken Träume endgültig. Deshalb stellte der Protest von rot auf grün um. Statt auf das Proletariat setzt man seither auf den guten Menschen und die eigentlich heile, aber gefährdete, weil ausgebeutete Natur. Man könnte von einer grünen Inversion der Revolution sprechen – von Marx zurück zu Rousseau. In den revolutionären Träumen hat die Ökodiktatur die Diktatur des Proletariats ersetzt.“ (S. 157) – „Der geistige Vater der heutigen Linken ist nicht Marx, sondern Rousseau. Während Hobbes auf der Basis einer pessimistischen Anthropologie den vernünftigen modernen Staat konstruierte, wollte Rousseau nicht nur zurück zur Natur, sondern auch zu-rück zur antiken Polis.“ (S. 163) – „Es resultiert ein Absolutismus der Tu-gend, den man heute politische Korrektheit nennt und der die bürgerliche Welt in Schockstarre versetzt hat. Das politische »links« und »rechts« wird durch das manichäische »gut« und »böse« überformt. … Dieser Tu-gendterror legitimiert sich nicht mehr diskursiv. Er erspart sich die Arbeit des Begriffs und reklamiert Authentizität als Wahrheitskriterium. Wer ge-fühlsecht ist, dem werden Inkompetenz und Unsachlichkeit verziehen. Vor allem die Umweltaktivisten zeigen, dass man durch und durch unpolitisch sein und gerade dadurch attraktiv erscheinen kann.“ (S. 168) – „Man zeigt seine Wunden vor und klagt die Gesellschaft an. Als Opfer braucht man keine Argumente. An die Stelle von Ideologiekritik tritt Indigniertheit. Entrüstung gilt heute als Echtheitsbeweis, aber wer moralisch entrüstet ist, kann nicht mehr klar denken.“ (S. 168 f.)
Demgegenüber finde ich bei Bolz mindestens zwei Kardinalfehler:
a) Er ignoriert die Tatsache, dass nicht nur das Böse, sondern auch das Gute angeboren ist. Schon im Tierreich gibt es nachweislich Vorformen von Ethos, nämlich das Streben nach guter eigener Befindlichkeit, die Bezäh-mung des Egoismus durch Altruismus und die Gegenseitigkeit, die Fähig-keit zur Kooperation.1 (Was sicherlich auch eine Grundlage des Sozialis-mus ist.)
b) Bolz verzichtet auf jegliche Kapitalismus-Kritik, akzeptiert aber nahezu alle Formen von Gewalt- und Willkürherrschaft, bis hin zur Autokratie und zur „Diktatur der Bürokraten“.
Bolz sieht also nicht, dass Menschen stets, d.h. von Natur aus, kulturfähige Moral-Wesen sind, so dass es eine Politik ohne Moral, „jenseits von Gut und Böse“, gar nicht geben kann. Was sich immer wieder bewahrheitet, z.B. auch an Figuren wie Napoleon, Hitler, Mussolini, Pol Pot, McCarthy, Nixon, Trump, Boris Johnson u.a., die allesamt an ihrer Unmoral gescheitert sind, die von den vernünftig, rechtsbewusst und anständig Gebliebenen nicht toleriert wurde.
Schädlich ist Moral dann, wenn sie totalitär wird, ihre Grenzen überschreitet (s.u.) oder in bloßes Moralisieren umschlägt. Keinesfalls können Moral und Moralisieren an die Stelle der – stets unabdingbaren – konkreten Analyse der konkreten Situation treten.
Bolz rechtfertigt mit seinen Konzepten den Status quo, d.h. vor allem die Unge-rechtigkeiten des globalisierten Neoliberalismus, der überall die sozialen Gegen-sätze und Konflikte verschärft.
Der Tatsache dass Aristoteles mit seiner Auffassung vom Menschen als zoon politikon, d.h. als Gemeinschaftswesen, Recht behalten hat, wird Bolz nicht gerecht. Gleiches gilt für die Tatsache, dass das Christentum eine der Grundlagen des modernen Rechtsstaates und der Demokratie bildet, einschließlich Religionsfreiheit und religiösem Pluralismus; und zwar im Einklang mit der herausragenden kultur- und geistesgeschichtlichen Bedeutung des Christentums, die auch Jürgen Habermas hervorhebt.2
Bei Machiavelli ignoriert Bolz die Tatsache, dass der Zweck nicht die Mittel heiligt. Menschen brauchen Fern-Ziele, die nicht durch das Streben nach Nah-Zielen verraten oder diskreditiert werden dürfen.
Hobbes‘ bzw. Freuds homo homini lupus („der Mensch dem Menschen ein Wolf“) ist einseitig und durch die angeborene Fähigkeit zur Kooperation wider-legt. Zwar gibt es auch das Böse (vielleicht ebenfalls als Erbe aus dem Tierreich), doch folgt daraus nicht die Notwendigkeit der Gewalt-Herrschaft, sondern der Demokratie.
Max Webers Ansatz ist widersprüchlich, weil er darin einerseits eine „Verant-wortungsethik“ fordert, andererseits aber die Politik jenseits jeglicher moralischer Prinzipien verortet. Ein weiterer Widerspruch: Wie soll „die Last der Entschei-dung auf den Schultern jedes Einzelnen“ liegen, wenn doch alle wesentlichen Entscheidungen letztlich vom „Dienstwissen“ perfekt, d.h. maschinenartig agie-render Beamter getroffen werden?
Carl Schmitt ist schon durch seine NS-Verstrickung weitgehend diskreditiert, was Bolz ebenso wenig beachtet wie die Berechtigung von Marx‘ Hegel-Kritik. Nicht ein theologisch begründeter „Absoluter Geist“, sondern die menschliche Arbeit bewirkt die Weltgeschichte einschließlich aller Werte. Marxens Ethik des ange-messenen Lebens ist plausibel, ebenso seine Forderung nach dem „kategorischen Imperativ, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein geknechtetes, ein verächtliches, ein verlorenes, ein verlassenes Wesen ist“. Während Bolz dies überhaupt nicht erwähnt, leite ich u.a. aus Marx‘ Forderungen die Möglichkeit ab, einen Demokratischen Öko-Sozialismus 3 ethisch zu fundieren.
Die angeblich „grünen“ Linken schätzt Bolz falsch ein. Nur noch wenige Grüne zählen sich überhaupt zur Linken. Viele Grüne, so auch in der Regierungs- und Führungs-Riege, sind längst auf US-Kurs umgeschwenkt.
Moral und Ethik sind m.E. aus der Politik nicht wegzudenken. Sie sind auch dort notwendig. Dagegen halte ich die Ansichten, die Bolz in Keine Macht der Moral! verkündet, in wesentlichen Teilen für undemokratisch, irreführend und schädlich.
Grenzen der Ethik
Wohl zu Recht weist Thomas Zoglauer darauf hin, dass Ethik ein „dynamisches System“ ist, in dem man sich immer wieder mit neuen Konflikten konfrontiert sieht „und vielleicht nie ihr Ziel, die Herstellung eines konfliktfreien Systems, erreichen wird“.45 Wobei man allerdings fragen muss, ob es überhaupt sinnvoll sein kann, der Ethik ein solches Ziel zu setzen; bezieht sich Ethik doch im Wesentlichen auf Werte und Normen, nicht auf das Ganze des Seins oder auch nur der Gesellschaft, auch wenn Werte und Normen, ähnlich dem Sollen, auf Erfahrungen mit Seiendem beruhen.
Bestimmt überdies das gesellschaftliche Sein das Bewusstsein, wie Marx an-nimmt, müsste sich auch das Sollen – als Bewusstseins-Phänomen – aus dem Sein ableiten lassen, was aber nicht der Fall ist, sondern zu naturalistischen Fehlschlüssen führen würde. Gesellschaftliches Sein und Ethik sind nicht identisch, nicht deckungsgleich. Ein „konfliktfreies System“ konnte bislang noch nirgendwo hergestellt werden, auch nicht anlässlich der bisherigen Versuche der Errichtung klassenloser Gesellschaften. Erst recht wird dies nicht mittels einer gedanklichen („Überbau“-)Instanz wie der Ethik möglich sein, zumal deren Wirkungsmacht notwendigerweise durch die relativ klar umreißbaren Grenzen des Sollens, der Werte und der Normen eingeschränkt ist.
Darüber hinaus ist Folgendes zu bedenken:
a) Ethik kann nicht mit der Mathematik konkurrieren, nichts Unumstößliches festlegen.
b) Die tatsächlichen Wirkungsbereiche und -möglichkeiten der Individuen und der Gesellschaften sind nicht überschaubar und reichen zuweilen nur so weit wie deren Urteilskraft. Es sind Wirkungsbereiche, die von keiner Ethik in allen Details bestimmt werden können.
c) Zielkonflikte sind nicht selten nur vorläufig mit Mitteln der Ethik zu bewältigen.6
Werden Werte zu Normen, werden sie in diesen aufgehoben und gesichert. Es sind Vorgänge, in denen sich Wertethik und Normativität vereinen, normative Wertethik konkret wird. – Zumal es auch negative „Werte“ gibt, auch wenn Werte – und mit ihnen Moral und Ethik – stets durch Arbeit entstehen. Umso mehr gilt es, die Auswirkungen negativer „Werte“, wie z.B. von Waffen-Missbrauch und anderen kriminellen Handlungen aller Art, zu bekämpfen. Auch hier stößt die Ethik auf Grenzen, kann sie doch in keinem Falle die Justiz ersetzen. – Weitere, höchst bedeutsame Grenzen zeigen sich in den politischen und gesellschaftlichen System-Bedingungen.
Ein „konfliktfreies System“ wäre wohl gleichbedeutend mit Marxens Reich der Freiheit in einer Assoziation freier Individuen. Diese Utopie zu verwirklichen, bedarf es vielleicht der Kooperation und der gemeinsamen Bemühungen aller Menschen, vor allem auf politischem, sozio-ökonomischem und technologischem Gebiet, aber freilich nicht ohne die Ethik einzubeziehen, und zwar nicht zuletzt im Hinblick auf die heutige Zeit mit ihren mannigfachen Gefährdungen.7
[...]
1 Vgl. Habermann, Ernst 1996: Evolution und Ethik. Skeptische Gedanken eines Ethik-Kommissars, geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2013/9705/pdf/GU1996_S?9_38...
2 In: Habermas, Jürgen 2001: Zeit der Übergänge, Frankfurt a.M., S. 174–175. Dazu auch: Robra, Klaus 2022 : Ist das Christentum am Ende? Zu den Kritiken von Marx, Nietzsche, Dawkins Kahl und Bauer. Mit einem Ausblick auf den progressiven Säkularismus, München, https://www.grin.com/document/1246983, S. 115 ff.
3 Hierzu: Robra, Klaus 2018: Neue Wege zu einem Demokratischen Öko-Sozialismus. Eine konkrete Utopie, München, https://www.grin.com/document/ 453321; sowie: Robra, Klaus o.J. ( 2021): Sind die Diktatur des Proletariats und die Bürokratie das Ende des Sozialismus? Die Frage nach Auswegen aus den Sackgassen, München (GRIN-Verlag: https://www.grin.com/document/1032082)
4 Hierzu: NABU o.J.: Grenzen von Ethik-Argumenten. Konflikte im Natur- und Tierschutz, in: schleswig-holstein.nabu.de/wir-ueber-uns/grundlagen/tierschutz/25744.html; s. auch: Robra, Klaus o.J. (2020): Ethik der Verhaltenssteuerung. Eine Neubegründung, München, https://www.grin.com/document/923015, S. 25 ff.
5 Zoglauer, Thomas: Normenkonflikte – zur Logik und Rationalität ethischen Argumentierens, Suttgart-Bad Cannstadt 1998, S. 311
6 Vgl. NABU o.J.: Grenzen von Ethik-Argumenten. Konflikte im Natur- und Tierschutz, in: schleswig-holstein.nabu.de/wir-ueber-uns/grundlagen/tierschutz/25744.html, S. 1
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in diesem Text?
Dieser Text analysiert kritisch die Thesen von Dr. Norbert Bolz, insbesondere seine Ablehnung der Moral in der Politik, wie sie in seinem Buch "Keine Macht der Moral!" dargelegt wird. Der Text argumentiert, dass Moral und Ethik in der Politik unerlässlich sind und Bolz' Ansichten als undemokratisch, irreführend und schädlich betrachtet werden.
Welche zentralen Thesen von Bolz werden kritisiert?
Der Text kritisiert Bolz' Zustimmung zu Gewaltverherrlichern wie Machiavelli, Hobbes und Carl Schmitt. Es wird argumentiert, dass Bolz die angeborene Fähigkeit des Menschen zum Guten ignoriert, jegliche Kapitalismus-Kritik vermeidet und die Unmoral von Figuren wie Napoleon, Hitler und Trump nicht ausreichend berücksichtigt.
Wie beurteilt der Text Bolz' Interpretation von Machiavelli, Hobbes und Freud?
Der Text argumentiert, dass Bolz Machiavelli falsch interpretiert, indem er die Tatsache ignoriert, dass der Zweck nicht die Mittel heiligt. Bezüglich Hobbes und Freud wird kritisiert, dass Bolz deren pessimistisches Menschenbild (homo homini lupus) einseitig darstellt und die angeborene Fähigkeit zur Kooperation vernachlässigt.
Was wird über Bolz' Analyse von Max Weber gesagt?
Der Text sieht Widersprüche in Bolz' Darstellung von Max Weber. Einerseits fordert Weber eine "Verantwortungsethik", andererseits verortet er die Politik jenseits moralischer Prinzipien. Zudem wird die Frage aufgeworfen, wie die Entscheidungen des Einzelnen relevant sein sollen, wenn diese letztlich von Bürokraten getroffen werden.
Was sind die "Grenzen der Ethik", die im Text diskutiert werden?
Der Text betont, dass Ethik kein unumstößliches System ist und nicht mit der Mathematik konkurrieren kann. Die Wirkungsbereiche und -möglichkeiten von Individuen und Gesellschaften sind begrenzt und Zielkonflikte können nur vorläufig bewältigt werden. Ethik kann die Justiz nicht ersetzen, und politische und gesellschaftliche Systembedingungen setzen ihr Grenzen.
Wie steht der Text zur Rolle des Christentums und zur Marx'schen Kritik?
Der Text betont, dass das Christentum eine Grundlage des modernen Rechtsstaates und der Demokratie bildet. Bezüglich Marx wird hervorgehoben, dass nicht ein theologisch begründeter "Absoluter Geist", sondern die menschliche Arbeit die Weltgeschichte bewirkt. Der Text leitet aus Marx' Forderungen die Möglichkeit ab, einen Demokratischen Öko-Sozialismus ethisch zu fundieren.
Wie wird die heutige Linke (insbesondere die Grünen) von Bolz beurteilt und was hält der Autor davon?
Bolz wird dafür kritisiert, dass er die heutigen "grünen" Linken falsch einschätzt. Viele Grüne werden nicht mehr der Linken zugerechnet und haben sich einem US-amerikanischen Kurs zugewandt. Der Autor argumentiert, dass Moral und Ethik aus der Politik nicht wegzudenken sind.
- Citar trabajo
- Dr. Klaus Robra (Autor), Politik ohne Moral. Zu Norbert Bolz' "Keine Macht der Moral! Politik jenseits von Gut und Böse", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1264887