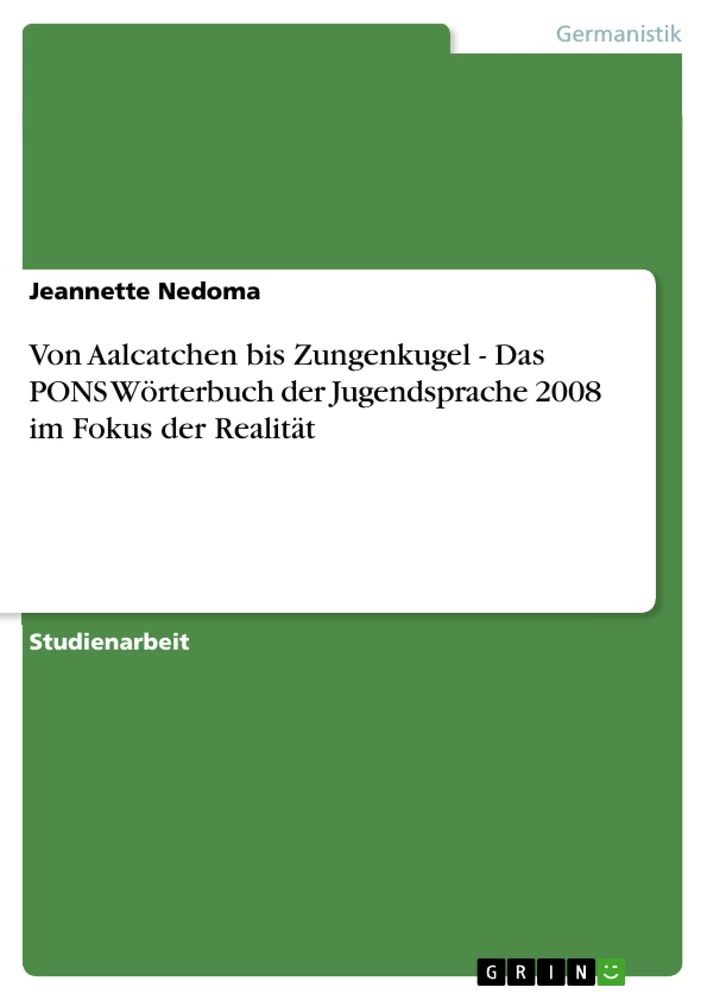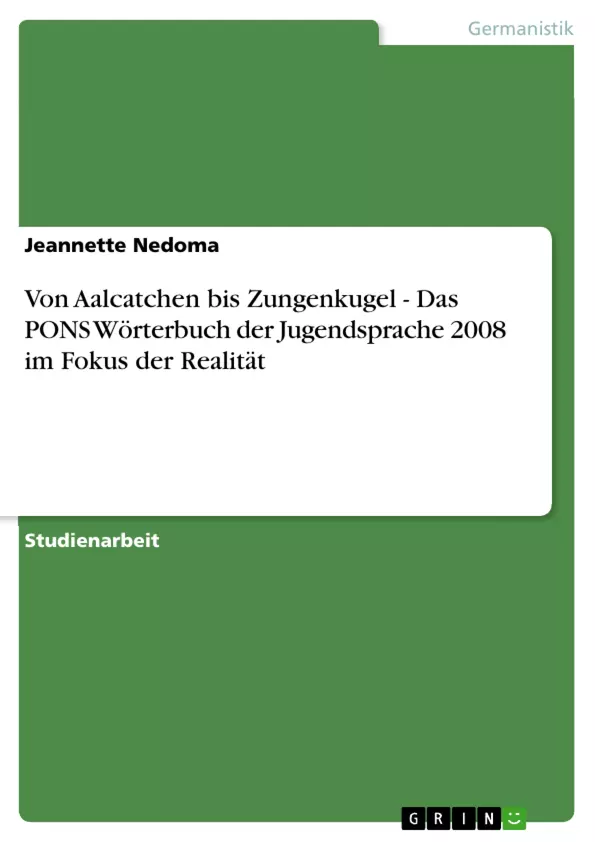Über die jugendliche Ausdrucksweise oder vielmehr die Existenz von Jugendsprache wird seit
Jahrzehnten hitzig diskutiert und debattiert. Laien und Sprachwissenschaftler und diejenigen, die
sich dafür halten, liefern sich unerbittliche Kämpfe, wenn es um die Erforschung der
jugendlichen Sprache geht. Es lassen sich die unterschiedlichsten Herangehensweisen und
Methoden zur Erfassung von Jugendsprache feststellen, doch bislang scheint der bahnbrechende
Erfolg in dieser Kontroverse auszubleiben. Die Medien, besonders Rundfunk und Fernsehen,
stellen sich auf ihre jugendliche Zielgruppe ein und benutzen endmadige (besonders schlechte)
Ausdrücke von denen sicherlich jeder Jugendliche Goldminen (Ohrenschmalz) und Hummeltitten
(Gänsehaut) bekommt. Ein vorzeigbares Beispiel stellt Viva dar; die Moderatoren schmeißen mit
phaten (sehr guten) Ausdrücken um sich, dass sich so mancher Erwachsene einfach nur noch
fremdschämen möchte. Eine Erklärung in der Süddeutschen Zeitung ist bezeichnend für den
Musikkanal, in dessen Programm der Zuschauer teils vergeblich auf die versprochene Musik
wartet. „Der Musikkanal Viva präsentiert sich seinen jugendlichen Zuschauern geradezu als
mediales Über-Ich: Wir sind euer Fernsehen, eure Sprache, eure Farben und eure Musik heißt es
in einer Pressemappe.“ (SZ 2004)
Neben den Medien, versuchen auch die meisten Erzeugerfraktionen (Eltern) sich auf ihre
Sprösslinge einzustellen. Sie versuchen mit der Jugend zu kommunizieren, indem sie
abgespacedte (verrückte, abgefahrene) Wörter verwenden. Da schalten sich nun die
Verlagshäuser ein und werfen regelmäßig jedes Jahr neue (absurde) Jugendsprachwörterbücher
auf den Markt, mit denen die Ellies und Mitarbeiter der Bildungsvermittlungsinstitute (Schulen)
fleißig die pornösen (außergewöhnlich guten) Ausdrücke lernen können um die Jugend zu rallen
(verstehen). „Dass sich diese Bücher trotzdem gut verkaufen, liegt an der „Prestigefunktion von
Jugendlichkeit“, wie die Sprachwissenschaftlerin Eva Neuland es formuliert: Wissen über
Jugendlichkeit enthält zugleich das Gebrauchswertversprechen, sich über dieses Wissen ein
Stück der eigenen Jugendlichkeit zurückzuerobern.“ (SZ 2004) Doch die Diskussionen rund um die Jugendsprache ist kein neuzeitliches Phänomen. Bereits
Anfang des 19.Jahrhundert lassen sich Lexika mit „jugendsprachlichen“ Ausdrücken finden, die
von Studenten geschrieben wurden. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. PONS Wörterbuch der Jugendsprache 2008- Fiktion oder Realität?
- 2.1 Von abbitchen bis Erzeugerfraktion: Auswertung der Beispiele 1 bis 7
- 2.2 Von Erzeugerfraktion bis Laugenbrezel: Auswertung der Beispiele 7 bis 12
- 2.3 Von natsen bis Zipfelzwicker: Auswertung der Beispiele 14 bis 20
- 3. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung von Jugendsprache im PONS Wörterbuch der Jugendsprache 2008 und vergleicht diese mit der tatsächlichen Verwendung in der gesprochenen Sprache. Die Zielsetzung ist es, die Genauigkeit und den Realitätsgehalt des Wörterbuchs zu evaluieren und die anhaltende Debatte um Jugendsprache und ihre Erfassung zu beleuchten.
- Die Entwicklung und der Wandel von Jugendsprache im Laufe der Zeit.
- Der Vergleich zwischen der im Wörterbuch dargestellten Jugendsprache und der tatsächlich verwendeten Sprache.
- Die Rolle der Medien und der Eltern bei der Verbreitung und Wahrnehmung von Jugendsprache.
- Die Methoden der Erfassung und Dokumentation von Jugendsprache.
- Die gesellschaftliche Bedeutung und Funktion von Jugendsprache als Mittel der Abgrenzung.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die langjährige und kontroverse Debatte um Jugendsprache ein. Sie beschreibt verschiedene Herangehensweisen an die Erforschung dieses linguistischen Phänomens und verweist auf die widersprüchlichen Darstellungen in Medien und Wörterbüchern. Die Einleitung hebt die Schwierigkeit hervor, Jugendsprache präzise zu erfassen und zu definieren, und stellt die Frage nach dem Realitätsgehalt von Jugendsprachwörterbüchern in den Mittelpunkt der Untersuchung.
2. PONS Wörterbuch der Jugendsprache 2008- Fiktion oder Realität?: Dieses Kapitel analysiert das PONS Wörterbuch der Jugendsprache 2008 anhand ausgewählter Beispiele. Durch die Auswertung einzelner Wortgruppen wird untersucht, inwieweit die im Wörterbuch präsentierten Begriffe und Definitionen den tatsächlichen Sprachgebrauch Jugendlicher widerspiegeln. Der Fokus liegt auf dem Vergleich zwischen der lexikalischen Darstellung und der Realität der jugendlichen Kommunikation. Die Analyse deckt potenzielle Diskrepanzen zwischen der fiktiven Darstellung im Wörterbuch und dem tatsächlichen Sprachgebrauch auf.
3. Fazit: (Kein Fazit, da in den Vorgaben explizit ausgeschlossen).
Schlüsselwörter
Jugendsprache, PONS Wörterbuch, Sprachwandel, Lexikografie, Medienwirkung, Abgrenzung, Soziolinguistik, Sprachwissenschaft, Realitätsgehalt, Wortbedeutung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument "PONS Wörterbuch der Jugendsprache 2008 - Fiktion oder Realität?"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht die Darstellung von Jugendsprache im PONS Wörterbuch der Jugendsprache 2008 und vergleicht diese mit der tatsächlichen Verwendung in der gesprochenen Sprache. Das Hauptziel ist die Evaluierung der Genauigkeit und des Realitätsgehalts des Wörterbuchs sowie die Beleuchtung der anhaltenden Debatte um Jugendsprache und ihre Erfassung.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit der Entwicklung und dem Wandel von Jugendsprache, dem Vergleich zwischen der im Wörterbuch dargestellten und der tatsächlich verwendeten Sprache, der Rolle von Medien und Eltern bei der Verbreitung von Jugendsprache, den Methoden der Erfassung und Dokumentation von Jugendsprache und der gesellschaftlichen Bedeutung von Jugendsprache als Mittel der Abgrenzung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in drei Kapitel: Eine Einleitung, die die Debatte um Jugendsprache einführt und die Forschungsfrage formuliert; ein Hauptteil, der das PONS Wörterbuch anhand ausgewählter Beispiele analysiert und den Vergleich zwischen Wörterbuch und Realität vornimmt; und ein Fazit (welches in dieser Version aufgrund der Vorgaben fehlt).
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit analysiert ausgewählte Einträge des PONS Wörterbuchs der Jugendsprache 2008 und vergleicht diese mit dem tatsächlichen Sprachgebrauch. Der Fokus liegt auf der Auswertung einzelner Wortgruppen und dem Aufdecken potenzieller Diskrepanzen zwischen Wörterbuch und Realität.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Ein explizites Fazit fehlt in diesem Auszug. Die Analyse konzentriert sich auf den Vergleich zwischen den im Wörterbuch dargestellten Begriffen und dem tatsächlichen Sprachgebrauch Jugendlicher.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Jugendsprache, PONS Wörterbuch, Sprachwandel, Lexikografie, Medienwirkung, Abgrenzung, Soziolinguistik, Sprachwissenschaft, Realitätsgehalt, Wortbedeutung.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für akademische Zwecke bestimmt und richtet sich an Personen, die sich mit Jugendsprache, Lexikografie und Soziolinguistik auseinandersetzen.
- Arbeit zitieren
- Jeannette Nedoma (Autor:in), 2008, Von Aalcatchen bis Zungenkugel - Das PONS Wörterbuch der Jugendsprache 2008 im Fokus der Realität, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/126504