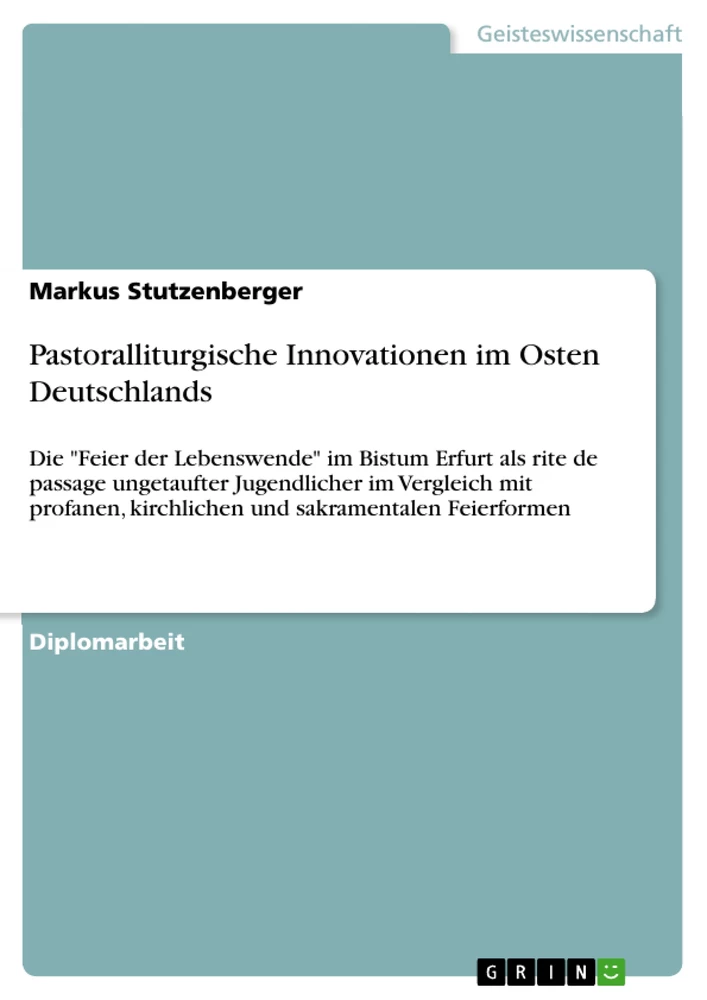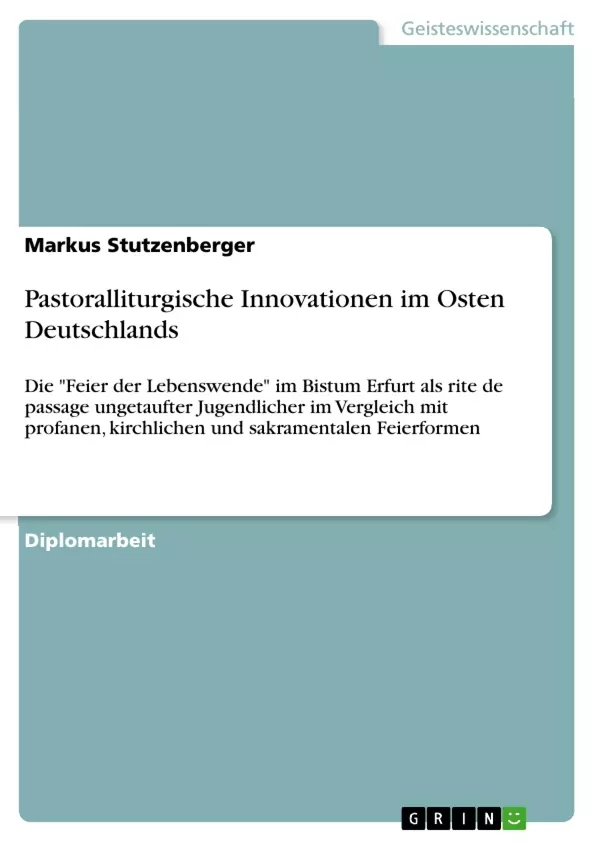Die Jugendweihe der früheren DDR erfreut sich über 15 Jahre nach dem schicksalhaften Fall der "Mauer" in Deutschland bleibender Beliebtheit in einem von vielen als "areligiös" beschriebenen und geprägten Umfeld, in dem sich über 80 Prozent des Bevölkerungsteils nicht zu einer -christlichen- Konfession bekennen. Der Osten Deutschlands ist religiös unbedarft und weniger gekennzeichnet durch bewussten Atheismus oder Religionsfeindlichkeit, sondern vielmehr durch ein verhaltenes Interesse, dass sich bei ersten Berührungen mit dem Phänomen Kirche äußert. Das Bistum Erfurt hat bereits zu Zeiten der DDR innovative Projekte für die Zielgruppe der Nichtgetauften entwickelt, um diese in der Liturgie nicht zu überfordern. Beispielhaft hierfür steht das nächtliche "Weihnachtslob" am Heiligen Abend im Erfurter Dom. Nach dem Fall der Mauer wurden andere, neue Feierformen speziell für Jugendliche entwickelt, um der postsozialistischen, sinnentleerten Jugendweihe eine christliche Alternative zuzugesellen: nicht um "junge Christen zu machen", sondern die soziologisch bedeutsame Schwelle des Übergangs vom Jugend- zum Erwachsenenalter in einem neuen rité des passages in geeigneter Weise rituell zu kennzeichnen. Dies erfolgt seither in Form einer Sensibilisierung für die Bedeutung des Kirchenraumes, der existentiellen Fragen religiös unbedarfter, jungen Menschen in der jährlich wiederkehrenden "Feier der Lebenswende" im Erfurter Dom, die sich nunmehr einer zehnjährigen Tradition erfreut. Dieses Buch lädt zu einem kritischen Vergleich mit den (national-) sozialistischen Ersatzriten ein, die von den jeweiligen Regimes in Abgrenzung zu den christlichen Initiationssakramenten Firmung/Konfirmation entwickelt wurden und ermutigt den Leser, sich selber auf die Suche zu machen nach Feierformen jenseits der gewohnten kirchlichen Initiation durch die Sakramente, um Liturgie in ihrer Praxis "menschenfähig" zu machen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Gliederung
- II. Einleitung
- III. Liturgische Inkulturation
- 1. Der Terminus
- 2. Einblicke in die Lebenswelt Jugendlicher im vereinigten Deutschland
- 3. Die Suche nach Vorbildern geglückten Lebens
- 4. Die Jugendweihe im Osten Deutschlands als (post-) sozialistischer Religionsersatz
- 4.1 Die historischen Wurzeln der Jugendweihe
- 4.2 Die Grundgestalt der Feier von 1955 bis 1989/1990
- 4.3 Die Funktionen der sozialistischen Jugendweihe
- 4.4 Postsozialistische Jugendweihefeiern nach 1990
- 4.5 Die nationalsozialistische Funktionalisierung jugendlicher Passageriten
- 4.5.1 „Jugendweihe“ und Jugendleite“
- 4.5.2 Überweisungs- und Schulentlassfeiern
- 4.5.3 Die Verpflichtungsfeier der Jugend
- 5. Ritus und Lebenswende als pastorale Herausforderung in der Begleitung ungetaufter Jugendlicher
- 5.1 Zum Begriff und zum Verständnis von Lebenswenden
- 5.2 Die Erfurter „Feier der Lebenswende“ (Prototyp nach Reinhard Hauke) seit 1998
- 5.2.1 Entstehungshintergründe der Feier
- 5.2.2 Zeiten und Orte der Feier
- 5.2.3 Die Feiergestalt des Prototyps (1998)
- 5.2.4 Schematisches Ablaufraster der Feiern der Lebenswende 1998-2000
- 5.2.5 Modifikationen des Prototyps 1999/2000
- 5.2.6 Nach den einzelnen Feiern: Reaktionen von Eltern und den beteiligten Jugendlichen. Gründe für die Fortführung des Projekts
- 5.2.7 Resümee und Überleitung
- 6. Die Erfurter „Feier der Lebenswende“: liturgisch ortlos „im Vorhof der Heiden“?
- 6.1 Die „Feier der Lebenswende“ – ein Gottesdienst?
- 6.2 Die liturgisch-theologische Einordnung der „Feier der Lebenswende“
- 6.2.1 Vergleich mit der Struktur des christlichen Wortgottesdienstes
- 6.2.2 Die Abläufe im Vergleich
- 6.2.3 Die Feier der Lebenswende: Liturgie?
- 6.3 Akzente im liturgischen Erfahrungsbezug der Feier der Lebenswende
- 6.3.1 Vorbemerkung
- 6.3.2 Die diakonische Dimension reflektierter Fest- und Feierkultur
- 6.3.2.1 Die Bedeutung der Tischgemeinschaft im Leben Jesu
- 6.3.2.2 Die liturgische Vermittlung zwischen der Lebenswelt Jugendlicher und deren Religiosität
- 6.3.2.2.1 Das Beispiel ökumenischer Initiativen
- 6.3.2.2.2 Das Bedürfnis nach Struktur: Mystagogische Zugänge Nichtgetaufter
- 6.3.2.2.3 Die Vorbereitungsphase als Lernfeld im Rahmen der Erfurter Lebenswendefeier
- 6.3.2.2.3.1 Diakonische und liturgischer Erfahrungsbereiche
- 6.3.2.2.3.2 Erfahrungsbezogene Mahlkultur
- IV. Firmung und Konfirmation als Vergleichspunkte christlicher Initiation
- 1. Die Konfirmation
- 2. Die Firmung
- 3. Die Firmung als verselbständigter rite de passage
- 4. Exkurs: Das Problem des Firmalters
- 5. Optionen einer zeitlich und theologisch kontextualisierten Initiation
- 6. Die Relevanz nichtsakramentaler Initiationsfeiern zur liturgischen Kultivierung markanter Lebenseinschnitte
- V. Gesamtresümee
- Liturgische Inkulturation im Kontext des Wandels in den neuen Bundesländern
- Die „Feier der Lebenswende“ als pastoralliturgische Innovation im Bistum Erfurt
- Vergleich der „Feier der Lebenswende“ mit anderen Feierformen (Jugendweihe, Firmung, Konfirmation)
- Die Bedeutung der „Feier der Lebenswende“ für die liturgische und diakonische Arbeit in der Kirche im Osten Deutschlands
- Religiöse Initiation im Kontext der Lebenswelt Jugendlicher
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den pastoralliturgischen Innovationen im Osten Deutschlands, wobei sie den Fokus auf die „Feier der Lebenswende“ im Bistum Erfurt legt. Die Arbeit analysiert die Feier der Lebenswende im Kontext des Wandels der Lebenswelt Jugendlicher im vereinigten Deutschland und im Vergleich zu profanen, kirchlichen und sakramentalen Feierformen wie der Jugendweihe, der Firmung und der Konfirmation. Die Arbeit befasst sich insbesondere mit den Herausforderungen, die sich für die Kirche im Osten Deutschlands aus der „Diaspora-Situation“ ergeben, sowie mit dem Bedürfnis nach einer zeitgemäßen und relevanten Form der religiösen Initiation für Jugendliche.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Ausgangssituation der Kirche im Osten Deutschlands und die Bedeutung der „Feier der Lebenswende“ in diesem Kontext beleuchtet. Kapitel III befasst sich mit der liturgischen Inkulturation und analysiert die Lebenswelt Jugendlicher im vereinigten Deutschland. Dieses Kapitel untersucht auch die Jugendweihe als (post-)sozialistischen Religionsersatz und die Rolle der nationalsozialistischen Funktionalisierung jugendlicher Passageriten. Kapitel V beleuchtet den Ritus und die Lebenswende als pastorale Herausforderung in der Begleitung ungetaufter Jugendlicher und analysiert die Erfurter „Feier der Lebenswende“ im Detail. Kapitel VI diskutiert die liturgisch-theologische Einordnung der „Feier der Lebenswende“ und untersucht die Akzente im liturgischen Erfahrungsbezug. Schließlich beleuchtet Kapitel IV die Firmung und Konfirmation als Vergleichspunkte christlicher Initiation.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Begriffen wie liturgische Inkulturation, Lebenswende, Jugendweihe, Feier der Lebenswende, Firmung, Konfirmation, rite de passage, religiöse Initiation, Diaspora-Situation, ostdeutsche Kirche, liturgische Erfahrungsbezüge, diakonische Dimension, Tischgemeinschaft und Mahlkultur.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die „Feier der Lebenswende“?
Es handelt sich um ein im Bistum Erfurt entwickeltes Projekt für nichtgetaufte Jugendliche, das als christliche Alternative zur säkularen Jugendweihe dient.
Warum ist die Jugendweihe im Osten Deutschlands so populär?
Die Jugendweihe hat historische Wurzeln als (post-)sozialistischer Religionsersatz und ist in einem Umfeld, in dem über 80 % der Bevölkerung konfessionslos sind, fest verankert.
Was ist das Ziel der liturgischen Inkulturation in diesem Kontext?
Ziel ist es, kirchliche Feierformen so zu gestalten, dass sie für religiös unbedarfte Menschen zugänglich sind, ohne sie rituell zu überfordern.
Wie unterscheidet sich die Lebenswendefeier von den Sakramenten?
Im Gegensatz zur Firmung oder Konfirmation ist die Feier der Lebenswende kein Sakrament, sondern ein „rite de passage“ für Jugendliche ohne Kirchenbindung.
Welche Rolle spielt der Erfurter Dom in diesem Projekt?
Der Erfurter Dom dient als zentraler Ort für die Feiern, um den Jugendlichen einen mystagogischen Zugang zum Kirchenraum zu ermöglichen.
Wird die Feier der Lebenswende als Gottesdienst eingestuft?
Die Arbeit diskutiert die liturgisch-theologische Einordnung und vergleicht die Struktur mit dem christlichen Wortgottesdienst.
- Quote paper
- Markus Stutzenberger (Author), 2001, Pastoralliturgische Innovationen im Osten Deutschlands, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/12652