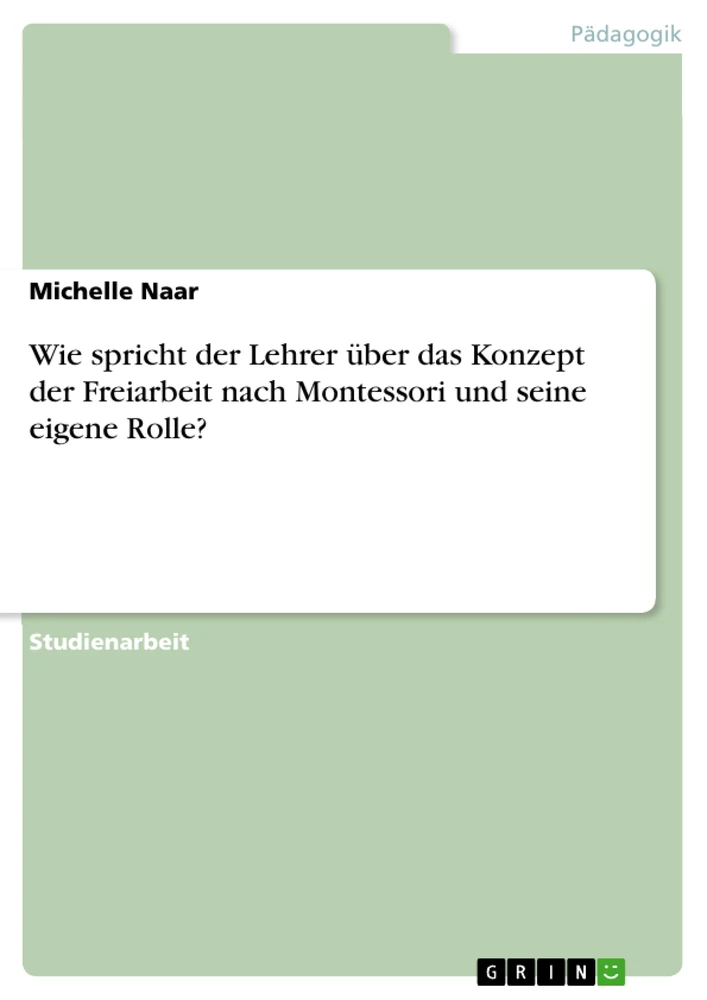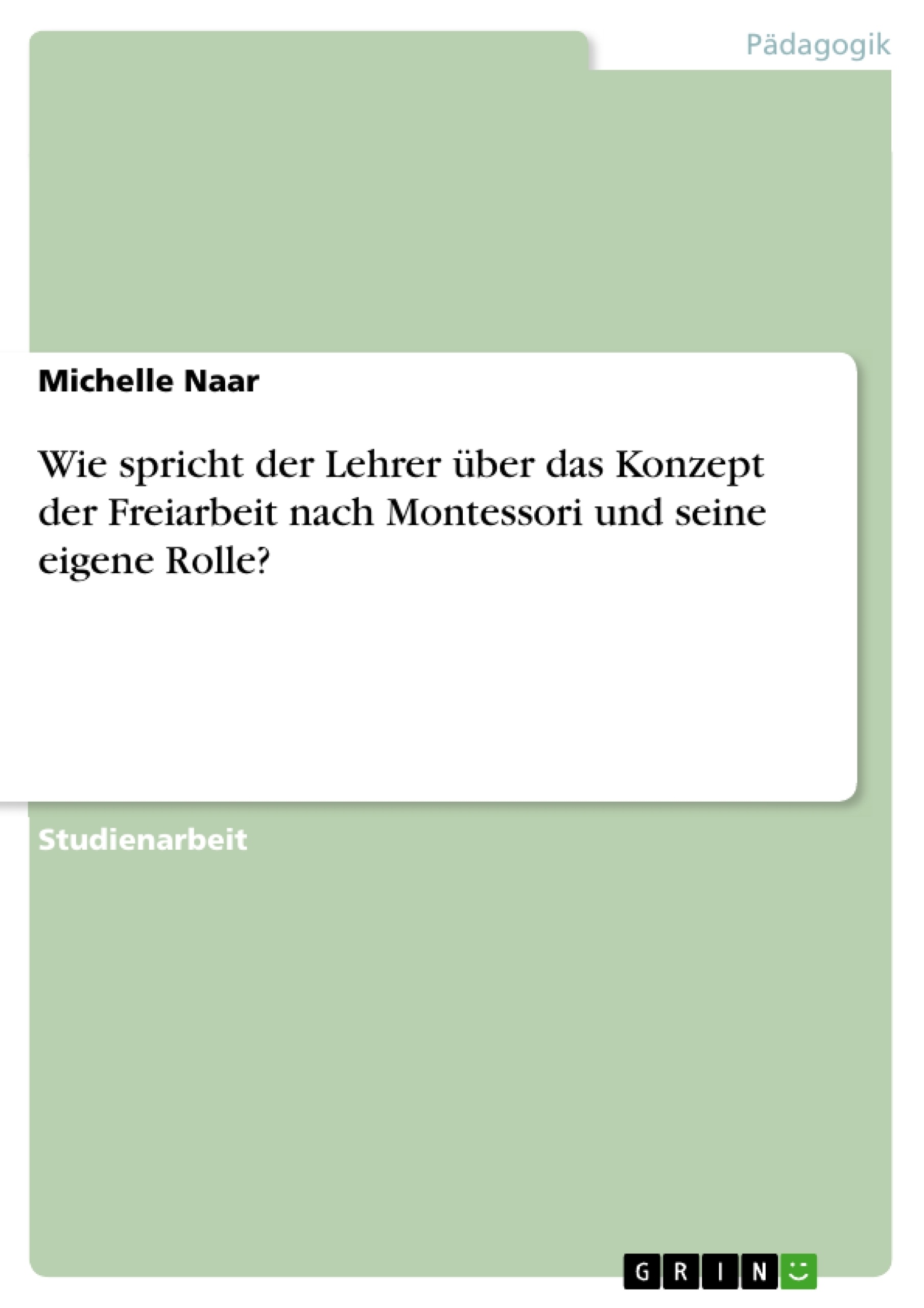Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Lehrer in der Freiarbeit nach Montessori und wertet Experteninterviews konversationsanalytisch aus.
Claus Georg Krieger definiert Freiarbeit als eine Form des Unterrichts, welche durch entsprechende Differenzierungsmaßnahmen innerhalb des Unterrichts zu einer individuellen Gestaltung der Lernprozesse der Schüler beiträgt und einen großen Freiraum hinsichtlich des selbstständigen Lernens bietet. Darüber hinaus ist die freie Arbeit durch den eigenen inneren Antrieb gekennzeichnet und geschieht unter entsprechenden pädagogischen Bedingungen, ohne dabei direkt vom Lehrer beeinflusst zu werden.
Die Freiarbeit ist eine offene Unterrichtsform und hebt sich damit deutlich vom gewohnten Frontalunterricht beziehungsweise gebundenen Unterricht ab. Der Unterschied zum traditionellen Unterricht ist, dass sich die Freiarbeit viel stärker an den Schüler als Individuum richten möchte und dadurch mehr auf die Fähigkeiten und Interessen einzelner Schüler eingeht. Der Schüler hat die Möglichkeit selbst festzulegen, zu welchem Zeitpunkt, er sich mit welchen Inhalten beschäftigen möchte, während sich der herkömmliche Schulunterricht an einem festen Lehrplan orientiert und alle Schüler zur gleichen Zeit, die gleichen Inhalte lernen.
Die Freiarbeit hat das Ziel, sich dem individuellen Entwicklungsstand eines jeden Kindes anzupassen und dementsprechend Lernwelten zu bieten, in denen nach eigenem Lerntempo und eigenen Interessen gearbeitet werden kann. In der Zeit der Freiarbeit kann jeder Schüler seine Themen und die entsprechenden Materialien selbst wählen und ebenso festlegen, in welcher Reihenfolge er dies tun möchte.
Außerdem liegt es auch in der Hand des Schülers für sich selbst zu entscheiden, wie oft er eine Tätigkeit ausüben möchte und wie sein Arbeitstempo ist. Auch der Arbeitsplatz und die Sozialform kann dabei selbst gewählt werden. Das individuelle Lernangebot sorgt zwar dafür, dass die Kinder auf unterschiedlichen Stufen lernen, jedoch sollte die Gemeinschaft im Vordergrund stehen, ohne Leistungsstress und Wettbewerb.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Einstieg
- Freiarbeit nach Montessori
- Der Lehrer nach Montessori
- Die Rolle des Lehrers
- Die Aufgaben des Lehrers
- Forschungsdesign
- Feldzugang
- Untersuchungssample
- Erhebungsmethode
- Durchführung und Aufbereitung der Daten
- Auswertungsmethode
- Analyse der Interviews
- Interview 1
- Interview 2
- Kritische Betrachtung der durchgeführten Forschung
- Das Leitfadeninterview
- Die Objektivität
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht, wie Montessori-Lehrer über die Unterrichtsmethode Freiarbeit und ihre eigene Rolle sprechen. Anhand von konversationsanalytischen Auswertungen von Experteninterviews wird untersucht, wie Lehrer das Konzept der Freiarbeit verstehen und welche Rolle sie sich darin zuschreiben.
- Das Konzept der Freiarbeit nach Montessori
- Die Rolle des Lehrers in der Montessori-Pädagogik
- Die Bedeutung von Selbstständigkeit und Eigeninitiative im Lernprozess
- Die Herausforderungen und Chancen der Freiarbeit für Lehrer und Schüler
- Die Bedeutung von Sprache und Kommunikation für das Verständnis der Freiarbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Freiarbeit nach Montessori ein und erläutert den Fokus der Arbeit. Der theoretische Einstieg beschäftigt sich mit den Grundlagen der Freiarbeit nach Montessori und der Rolle des Lehrers in diesem pädagogischen Konzept. Das Forschungsdesign beschreibt die Methode der Datenerhebung und -auswertung. Die Analyse der Interviews beleuchtet die Interviews mit Montessori-Lehrern und deren Sicht auf Freiarbeit und ihre eigene Rolle.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe der vorliegenden Arbeit sind Freiarbeit, Montessori-Pädagogik, Lehrerrolle, Selbstständigkeit, Eigeninitiative, konversationsanalytische Auswertung, Experteninterviews.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Konzept der Freiarbeit nach Montessori?
Freiarbeit ist eine offene Unterrichtsform, bei der Schüler selbst entscheiden, wann sie sich mit welchen Inhalten, Materialien und an welchem Arbeitsplatz beschäftigen.
Welche Rolle nimmt der Lehrer in der Montessori-Freiarbeit ein?
Der Lehrer fungiert als Beobachter und Begleiter, der die Umgebung vorbereitet, aber den Lernprozess nicht direkt beeinflusst oder steuert.
Wie unterscheidet sich Freiarbeit vom herkömmlichen Frontalunterricht?
Während der traditionelle Unterricht an festen Lehrplänen für alle orientiert ist, passt sich die Freiarbeit dem individuellen Entwicklungstempo und den Interessen jedes Kindes an.
Was sind die Ziele der Freiarbeit für die Schüler?
Ziele sind die Förderung von Selbstständigkeit, Eigeninitiative und ein Lernen ohne Leistungsstress und Wettbewerb innerhalb der Gemeinschaft.
Wie wurde die Rolle des Lehrers in dieser Arbeit untersucht?
Die Arbeit wertet Experteninterviews mit Montessori-Lehrern mittels Konversationsanalyse aus, um deren Selbstverständnis und Sicht auf die Freiarbeit zu erfassen.
Welche Bedeutung hat der „innere Antrieb“ in der Montessori-Pädagogik?
Freiarbeit geschieht aus dem eigenen inneren Antrieb des Kindes heraus, unterstützt durch pädagogische Bedingungen, die freies und selbstbestimmtes Lernen ermöglichen.
- Arbeit zitieren
- Michelle Naar (Autor:in), 2021, Wie spricht der Lehrer über das Konzept der Freiarbeit nach Montessori und seine eigene Rolle?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1265343