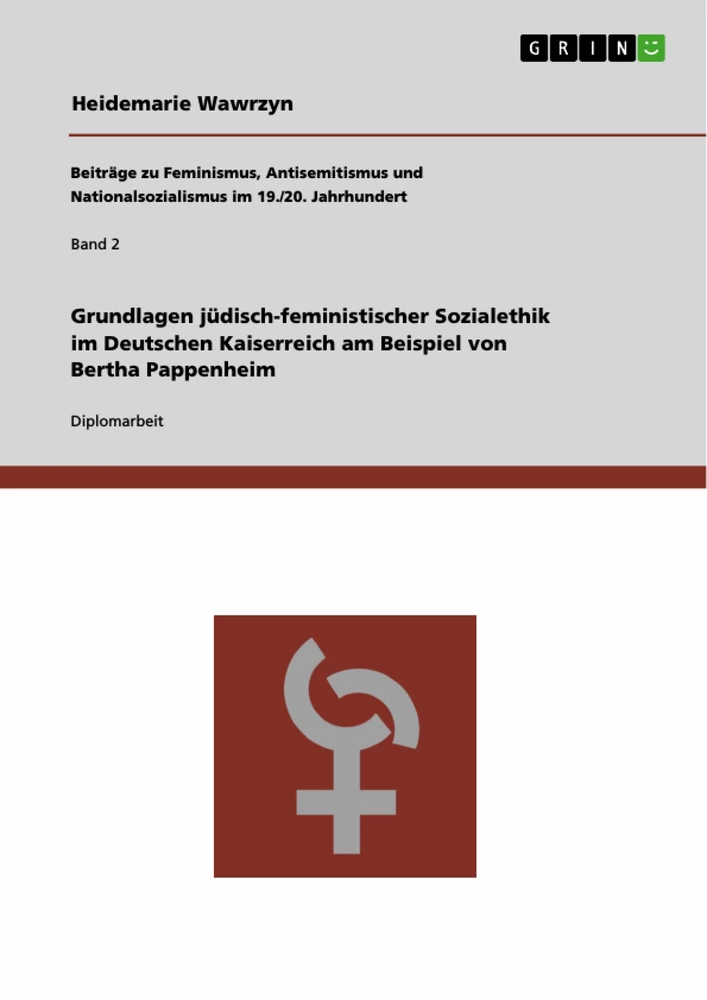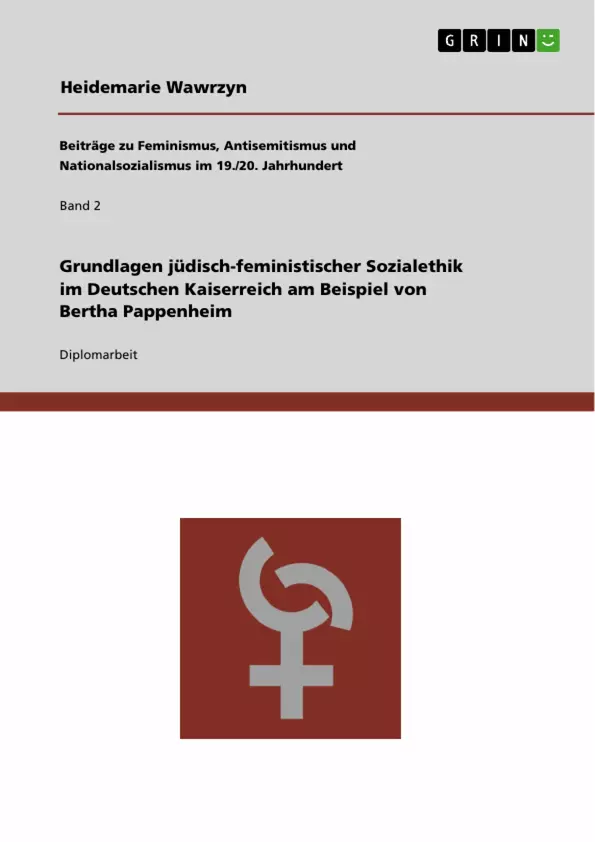Beiträge zu Feminismus, Antisemitismus und
Nationalsozialismus im 19./20. Jahrhundert: Band 2
Bertha Pappenheim, die Gründerin des Jüdischen Frauenbundes (1904), war eine ausgesprochene Praktikerin und Organisatorin. Stets versuchte sie, Judentum und Feminismus miteinander zu verbinden und die jüdische Tradition mit feministischen Reformen zu verändern, um auf diese Weise jüdischen Frauen Hilfe und Schutz zu geben und ihnen einen Weg zur Emanzipation zu zeigen.
In der vorliegenden Studie werden die Grundlagen, Werte und Ziele von Bertha Pappenheims jüdisch-feministischer Sozialethik anhand ihrer Schriften, Werke und ihres sozialen Engagements herausgearbeitet sowie dem Denken und Arbeiten ihrer Zeitgenossinnen gegenübergestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Forschungsstand und Quellenlage
- Begriffserklärungen:
- Feminismus
- Sozialethik
- Jüdische Orthodoxie
- Leben und soziales, feministisches Engagement von Bertha Pappenheim
- Kindheit und Jugendzeit
- Ihr soziales, feministisches Engagement zur Kaiserzeit
- Ihr soziales, feministisches Engagement zur Zeit des Ersten Weltkriegs und danach
- Vermächtnis
- Die Jüdin und Feministin Bertha Pappenheim in ihren Selbstzeugnissen
- Ihre feministische Einstellung
- Ihr Einstellung zur jüdischen Religion und Tradition
- Ansätze einer jüdisch-feministischen Sozialethik in Bertha Pappenheims Schriften
- Grundlagen
- Nächstenliebe
- Wohltätigkeit
- Menschenrechte
- Mütterlichkeit
- Zielsetzungen
- Emanzipation der jüdischen Frau
- Gleichverantwortlichkeit der Geschlechter
- Bekämpfung der sexuellen Ausbeutung von Frauen
- Erhaltung des Judentums
- Strategien der Durchsetzung
- Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit
- Petitionen an das jüdische Establishment
- Soziale Organisationen von Frauen für Frauen
- Reaktionen und Konflikte
- Reaktionen bei der Orthodoxie
- Reaktionen bei Mitarbeiterinnen
- Konflikte, ausgelöst durch den Antisemitismus
- Bertha Pappenheim soziales, feministisches Engagement in Bezug zu ihren Zeitgenossinnen
- Bertha Pappenheim und ihre jüdischen Zeitgenossinnen
- Alice Salomon, Konvertitin und Pazifistin
- Henriette May, Gründungsmitglied des Jüdischen Frauenbundes
- Nehemia Nobel, orthodoxer Rabbiner und Zionist
- Henriette Goldschmidt, Vertreterin der "Kulturmission" der deutschen Frau
- Bertha Pappenheim und ihre nichtjüdischen Zeitgenossinnen
- Hedwig Dohm, Vertreterin des radikalen Flügels der bürgerlichen Frauenbewegung
- Helene Stöcker, Begründerin einer neuen Sexualmoral
- Elisabeth Gnauck-Kühne, Wegbereiterin der christlich-konfessionellen Frauenbewegung
- Helene Lange, Repräsentantin des gemäßigten Flügels der bürgerlichen Frauenbewegung
- Schlussbemerkung: Vielfältige Widersprüche oder widersprüchliche Vielfalt?
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit von Heidemarie Wawrzyn befasst sich mit den Grundlagen jüdisch-feministischer Sozialethik im Deutschen Kaiserreich, am Beispiel von Bertha Pappenheim. Die Arbeit analysiert Pappenheims Leben und soziales Engagement, ihre Schriften und ihre Beziehungen zu anderen Frauenrechtlerinnen und -rechtlern ihrer Zeit. Sie untersucht, wie Pappenheims feministische und jüdische Identität ihre sozialethische Positionierung prägten und welche Strategien sie zur Durchsetzung ihrer Ziele einsetzte.
- Die Rolle der jüdischen Religion und Tradition in Pappenheims feministischem Denken
- Die Entwicklung einer jüdisch-feministischen Sozialethik im Kontext des Deutschen Kaiserreichs
- Die Bedeutung von Nächstenliebe, Wohltätigkeit und Menschenrechten in Pappenheims sozialem Engagement
- Die Strategien zur Emanzipation der jüdischen Frau und zur Gleichverantwortlichkeit der Geschlechter
- Die Konflikte und Reaktionen auf Pappenheims soziales und feministisches Engagement
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Forschungsstand und die Quellenlage dar. Sie erläutert die Begriffe Feminismus, Sozialethik und jüdische Orthodoxie im Kontext der Arbeit. Das zweite Kapitel beleuchtet Pappenheims Leben und soziales Engagement. Es beschreibt ihre Kindheit und Jugend, ihre Arbeit zur Kaiserzeit und ihre Aktivitäten während des Ersten Weltkriegs und danach. Das dritte Kapitel analysiert Pappenheims Selbstzeugnisse, ihre feministische Einstellung und ihre Haltung zur jüdischen Religion und Tradition. Das vierte Kapitel untersucht die Grundlagen, Zielsetzungen und Strategien einer jüdisch-feministischen Sozialethik in Pappenheims Schriften. Es beleuchtet ihre Ansätze zu Nächstenliebe, Wohltätigkeit, Menschenrechten und Mütterlichkeit sowie ihre Ziele zur Emanzipation der jüdischen Frau, zur Gleichverantwortlichkeit der Geschlechter und zur Bekämpfung der sexuellen Ausbeutung von Frauen. Außerdem werden die Reaktionen und Konflikte auf Pappenheims Engagement, insbesondere von Seiten der Orthodoxie und anderer Frauenrechtlerinnen, beleuchtet. Das fünfte Kapitel setzt Pappenheims Engagement in Bezug zu ihren Zeitgenossinnen, sowohl jüdischen als auch nichtjüdischen. Es analysiert ihre Beziehungen zu Alice Salomon, Henriette May, Nehemia Nobel, Henriette Goldschmidt, Hedwig Dohm, Helene Stöcker, Elisabeth Gnauck-Kühne und Helene Lange. Die Schlussbemerkung fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und stellt die Vielfältigkeit und Widersprüchlichkeit von Pappenheims Engagement heraus.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die jüdisch-feministische Sozialethik, Bertha Pappenheim, das Deutsche Kaiserreich, Feminismus, Soziales Engagement, jüdische Religion und Tradition, Emanzipation der Frau, Gleichverantwortlichkeit der Geschlechter, Nächstenliebe, Wohltätigkeit, Menschenrechte, Mütterlichkeit, Antisemitismus, Konflikte und Reaktionen, Zeitgenossinnen, Alice Salomon, Henriette May, Nehemia Nobel, Henriette Goldschmidt, Hedwig Dohm, Helene Stöcker, Elisabeth Gnauck-Kühne und Helene Lange.
- Arbeit zitieren
- Dr. Heidemarie Wawrzyn (Autor:in), 1993, Grundlagen jüdisch-feministischer Sozialethik im Deutschen Kaiserreich am Beispiel von Bertha Pappenheim, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/126535