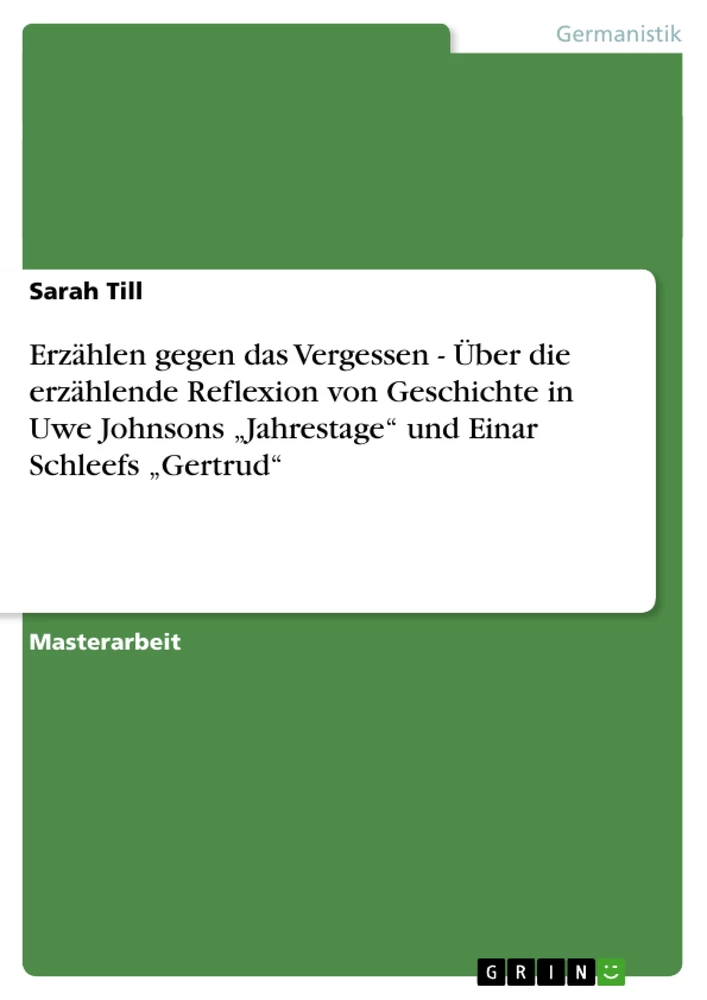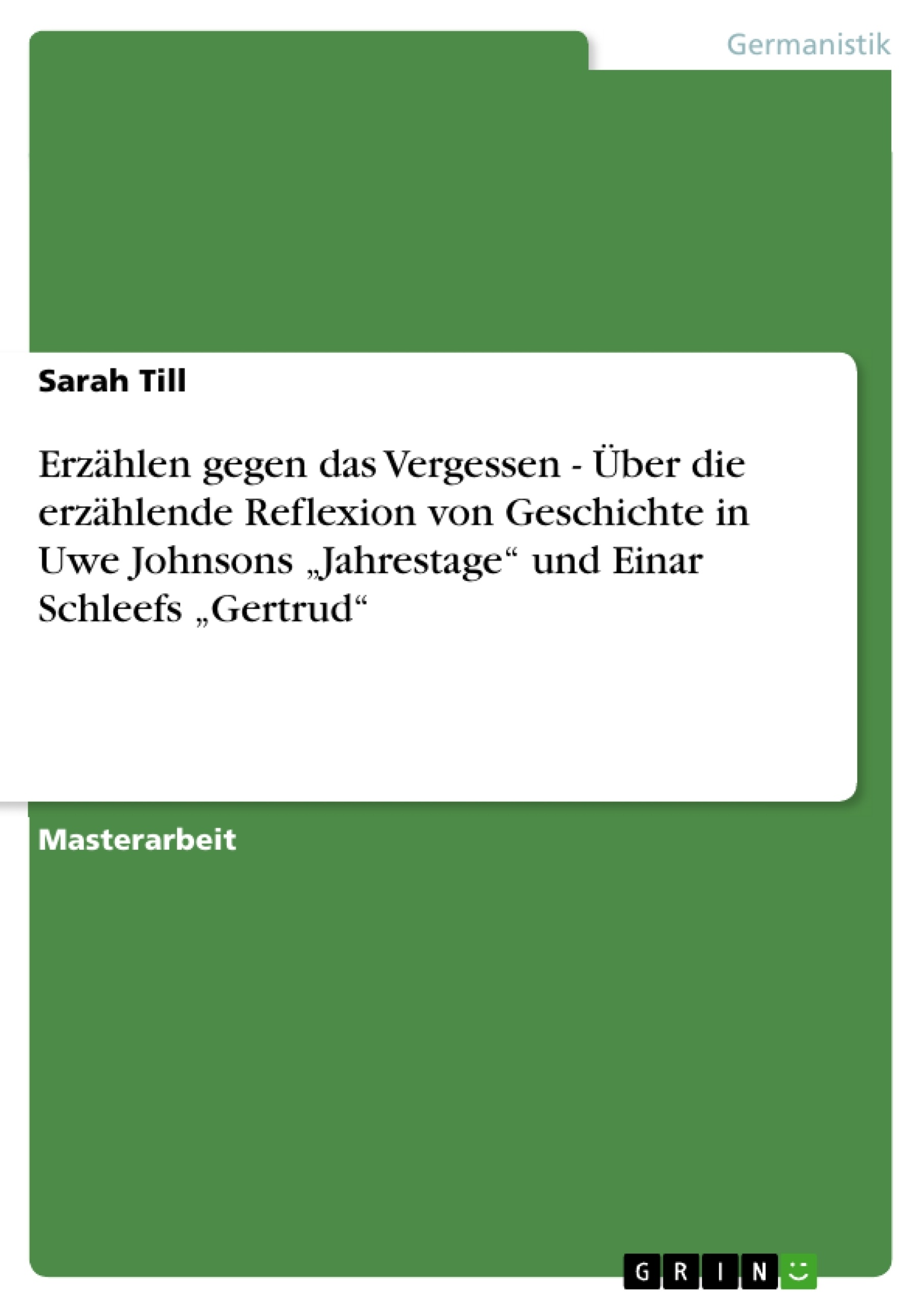Im Vorwort des Sammelbands „Literatur als Erinnerung“1 weist der Herausgeber Bodo Plachta auf ein hochaktuelles Phänomen hin, wenn er von einem „'Höhepunkt' unserer gegenwärtigen Erinnerungskultur“2 spricht. Tatsächlich ist gerade in Deutschland der Erinnerung insbesondere an die Katastrophengeschichte des 20. Jahrhunderts mit fortschreitender Zeit ein immer bedeutenderer kultureller Stellenwert zuteil geworden. Ob durch die Neuerrichtung und Pflege von Gedenkstätten, Museen und Archiven oder durch die vermehrten Forderungen nach Symposien bzw. historischen Forschungsprojekten – die Erinnerung an Geschichte konstituierende Ereignisse ist zweifelsohne mittlerweile ein wichtiger Parameter des modernen Selbstverständnisses.
Im Folgenden soll nun erörtert werden, inwiefern literarische Werke einen Teil zu diesem großräumig angelegten Erinnerungsdiskurs beitragen und ihn gegebenenfalls komplettieren können. Diese Arbeit fragt danach, wie die Geschichte – im Sinne von Historie – in den Roman gelangt, sie fragt nach Schnittstellen und Wechselwirkungen zwischen Geschichtsschreibung und literarischer Fiktion und sie fragt nach dem Beitrag, den Literatur hinsichtlich der Aufarbeitung von jüngster Geschichte im Zeichen einer generationsübergreifenden Erhaltung von Erinnerung zu leisten vermag.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Poetisierte Geschichtsschreibung und historiographischer Roman
- Geschichte(n): Literatur und Geschichtsschreibung
- Das Romaneske an der Geschichtsschreibung
- Der historiographisch orientierte Roman
- Oral history und Mentalitätengeschichte
- Literarische Erinnerungskultur zwischen Erkenntnisgewinn und Neuperspektivierung
- Literatur als Beitrag zum kollektiven Gedächnis
- Sinnfindung durch Erkenntnisgewinn
- Sinnfindung durch Neuperspektivierung
- Das narrative Programm des Schoah-Gedächtnisses
- Die Poetik moderner Literatur
- Schreiben nach Auschwitz: Ein Widerspruch?
- Die Betroffenheit der Nachgeborenen-Generation
- Reflexion von Geschichte in Uwe Johnsons Jahrestage
- Erzählsituation: „Schreib mir zehn Worte für mich, Genosse Schriftsteller“
- Poetisierte oral history: „[A]ber du warst doch dabei, wenn in einem Moment Geschichte gemacht wurde“
- Ewige Wiederkehr des Gleichen: „Wie oft noch“
- Erinnerung als Voraussetzung für das Erzählen von Geschichte: „Wenn ich die Erinnerung will, kann ich sie nicht sehen“
- Experimentelle Geschichtsschreibung mithilfe von Fiktionalität: „Geschichte ist ein Entwurf“
- Reflexion von Geschichte in Einar Schleefs Gertrud
- Erzählsituation: „Wenn ich das aufschreibe, wird es nicht wieder in Details zerfallen“
- Poetisierte oral history: „Mich quälen Daten, Geschichten“
- Ewige Wiederkehr des Gleichen: „Die Umstände verändern sich, es bleibt ewig dasselbe“
- Erinnerung als Voraussetzung für das Erzählen von Geschichte: „Mich erinnern, was bringt das, flennen, jeden Tag“
- Experimentelle Geschichtsschreibung mithilfe von Fiktionalität: „Wie ist es und wie könnte es sein“
- Schluss
- Bibliographie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, inwiefern literarische Werke einen Beitrag zum Erinnerungsdiskurs leisten können, insbesondere im Kontext der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts. Sie untersucht die Schnittstellen zwischen Geschichtsschreibung und literarischer Fiktion und analysiert, wie die Geschichte in den Roman gelangt und welche Rolle die Literatur bei der Aufarbeitung von jüngster Geschichte spielt. Die Arbeit verfolgt einen interdisziplinären Ansatz, der Berührungspunkte zwischen Literaturwissenschaft, Geschichtswissenschaft und Kulturwissenschaft beleuchtet.
- Die Beziehung zwischen Literatur und Geschichtsschreibung
- Die Rolle der Literatur bei der Aufarbeitung von Geschichte
- Die Bedeutung von Erinnerungskultur in der Literatur
- Die Verwendung von oral history und Mentalitätengeschichte in der Literatur
- Der Vergleich von Uwe Johnsons Jahrestage und Einar Schleefs Gertrud
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und stellt die Relevanz von Erinnerungskultur in der heutigen Zeit dar. Sie beleuchtet die Rolle der Literatur im Erinnerungsdiskurs und die Bedeutung der interdisziplinären Betrachtungsweise.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der poetisierten Geschichtsschreibung und dem historiographischen Roman. Es analysiert die Beziehung zwischen Literatur und Geschichtsschreibung und die Entwicklung eines neuen methodischen Denkansatzes in der Geschichtsbetrachtung.
Das dritte Kapitel untersucht die literarische Erinnerungskultur und ihre Rolle bei der Aufarbeitung von Geschichte. Es beleuchtet die Bedeutung von Literatur als Beitrag zum kollektiven Gedächtnis und die Möglichkeiten der Sinnfindung durch Erkenntnisgewinn und Neuperspektivierung.
Das vierte Kapitel widmet sich dem narrativen Programm des Schoah-Gedächtnisses und analysiert die Poetik moderner Literatur im Kontext der Aufarbeitung des Holocaust. Es beleuchtet die Herausforderungen des Schreibens nach Auschwitz und die Betroffenheit der Nachgeborenen-Generation.
Das fünfte Kapitel analysiert Uwe Johnsons Jahrestage und untersucht die Reflexion von Geschichte in diesem Roman. Es beleuchtet die Erzählsituation, die Verwendung von poetisierter oral history, die Thematik der ewigen Wiederkehr des Gleichen, die Bedeutung von Erinnerung für das Erzählen von Geschichte und die experimentelle Geschichtsschreibung mithilfe von Fiktionalität.
Das sechste Kapitel analysiert Einar Schleefs Gertrud und untersucht die Reflexion von Geschichte in diesem Roman. Es beleuchtet die Erzählsituation, die Verwendung von poetisierter oral history, die Thematik der ewigen Wiederkehr des Gleichen, die Bedeutung von Erinnerung für das Erzählen von Geschichte und die experimentelle Geschichtsschreibung mithilfe von Fiktionalität.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die literarische Erinnerungskultur, die poetisierte Geschichtsschreibung, den historiographischen Roman, die Aufarbeitung von Geschichte, die Rolle der Literatur im Erinnerungsdiskurs, die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts, Uwe Johnson, Einar Schleef, Jahrestage, Gertrud, oral history, Mentalitätengeschichte, Holocaust, Schoah-Gedächtnis, Erkenntnisgewinn, Neuperspektivierung, interdisziplinäre Betrachtungsweise.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt Literatur für die Erinnerungskultur?
Literatur dient als Medium des kollektiven Gedächtnisses. Sie kann historische Ereignisse durch fiktionale Erzählweisen neu perspektivieren und so einen individuellen Zugang zur Geschichte ermöglichen, der über reine Fakten hinausgeht.
Was ist ein historiographisch orientierter Roman?
Dies ist ein Roman, der historische Fakten mit literarischer Fiktion verknüpft. Er nutzt geschichtliche Ereignisse als Rahmen, um durch Erzählung tiefere Wahrheiten über Mentalitäten und menschliche Erfahrungen zu vermitteln.
Wie setzt Uwe Johnson in "Jahrestage" Geschichte um?
Johnson nutzt eine experimentelle Erzählweise, die Zeitungsberichte (New York Times) und Erinnerungen verwebt. Er thematisiert die Schwierigkeit des Erinnerns und begreift Geschichte als einen "Entwurf", der durch Erzählen lebendig gehalten wird.
Was zeichnet Einar Schleefs "Gertrud" im Hinblick auf die Geschichte aus?
Schleef nutzt eine "poetisierte oral history". Der Roman spiegelt die Qual durch Daten und Geschichten wider und zeigt, dass sich trotz wechselnder Umstände grundlegende menschliche Erfahrungen oft wiederholen.
Was bedeutet "Schreiben nach Auschwitz" in diesem Kontext?
Es bezieht sich auf die Herausforderung, nach dem Holocaust angemessene literarische Formen zu finden, um das Unfassbare festzuhalten und die Betroffenheit nachfolgender Generationen auszudrücken.
- Citar trabajo
- Sarah Till (Autor), 2009, Erzählen gegen das Vergessen - Über die erzählende Reflexion von Geschichte in Uwe Johnsons „Jahrestage“ und Einar Schleefs „Gertrud“, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/126580