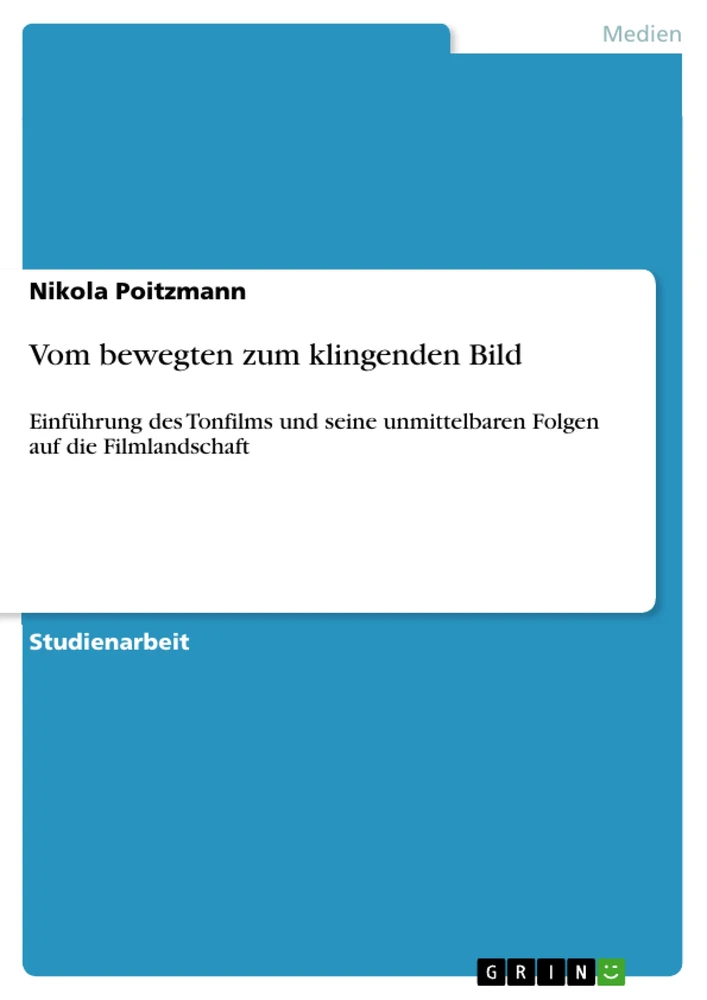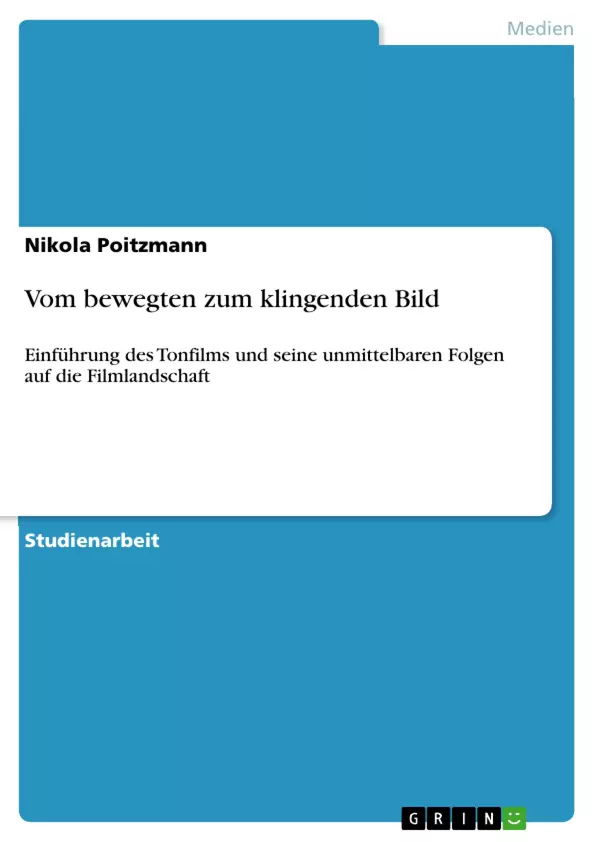Anläßlich seiner Europareise 1928 bestätigte Jesse L. Lasky, Präsident der amerikanischen „Fa-mous Players“-Gesellschaft, offiziell die aus Hollywood kommenden Gerüchte, nach denen es mit dem Stummfilm zu Ende gehe. Die ersten Ton- und Sprechfilme hätten wie Bomben einge-schlagen und die neue Spezies würde sich binnen kurzem die Weltleinwand erobern. Mir und Gleichgesinnten war es apokalyptisch zumute.
Mit diesen Worten kommentierte der französische Filmregisseur René Clair die Zeit des großen Umbruchs vom Stumm- zum Tonfilm, die für viele Zeitzeugen mit Ängsten, Unsicherheit, aber auch Hoffnung verbunden war.
Die Verfasserin dieser Hausarbeit möchte sich mit diesem Einschnitt in die Filmgeschichte befassen und die Einführung des Tonfilms unter technischen, ökonomischen und ästhetischen Gesichtspunkten beleuchten. Die Untersuchungsfrage ist jeweils, inwiefern der Tonfilm im Vergleich zum vorangegangen Stummfilm die gesellschaftlichen Gegebenheiten verändert hat. Der Betrachtungswinkel liegt hierbei überwiegend auf europäischer bzw. nicht-englischsprachiger Seite.
Die Arbeit soll zu Beginn einen kurzen geschichtlichen Abriss über die technische Entwicklung liefern (Nadeltonverfahren – Lichttonverfahren), danach werden die wirt-schaftlichen und sozialen Folgen beleuchtet (ökonomische Probleme der Filmwirtschaft, Schauspielerkarrieren und -niederlagen, Berufsstand der Kinomusiker) und dann intensiv die neue ästhetische Umsetzung der neuen Technik herausgearbeitet (visuelle Spra-che durch Sprache, Kameraeinsatz, Montage und Schauspiel). Auch die Aufnahme des Tonfilms durch die Filmschaffenden wird kurz angerissen. Der Schwerpunkt liegt auf der Zeit von 1928 bis 1933 – also in den frühen Jahren des Tonfilms und den späten Jahren der Weimarer Republik.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Einordnung ins historische Umfeld
- II. Wie die Bilder sprechen lernten
- II. 1 Das Nadeltonverfahren
- II. 2 Das Lichttonverfahren
- II. 3 Übernahme des Tonfilms durch die Filmindustrie
- III. Der Tonfilm und seine Konsequenzen
- III. 1 Wirtschaftliche und soziale Folgen
- III. 2 Ästhetik des Tonfilms
- III. 2.1 Sprache
- III. 2.2 Kameraarbeit
- III. 2.3 Montage
- III. 2.4 Schauspiel
- III. 3 Resonanz auf den Tonfilm
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Einführung des Tonfilms in der Filmgeschichte unter technischen, ökonomischen und ästhetischen Aspekten. Der Fokus liegt auf dem Vergleich zum Stummfilm und den daraus resultierenden gesellschaftlichen Veränderungen, hauptsächlich im europäischen, nicht-englischsprachigen Raum. Die Arbeit beleuchtet die technische Entwicklung (Nadelton- und Lichttonverfahren), die wirtschaftlichen und sozialen Folgen (inkl. Auswirkungen auf die Filmwirtschaft und Schauspieler), und die ästhetische Neugestaltung des Films (Sprache, Kamera, Montage und Schauspiel).
- Technische Entwicklung des Tonfilms (Nadeltonverfahren und Lichttonverfahren)
- Wirtschaftliche und soziale Auswirkungen der Tonfilm-Einführung
- Ästhetische Veränderungen im Film durch die Tontechnologie
- Übernahme des Tonfilms durch die Filmindustrie
- Rezeption des Tonfilms in der Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Übergang vom Stumm- zum Tonfilm als einen bedeutenden Umbruch in der Filmgeschichte, der mit Ängsten, Unsicherheiten, aber auch Hoffnungen verbunden war. Die Arbeit kündigt ihre Untersuchung der technischen, ökonomischen und ästhetischen Aspekte der Tonfilmeinführung an, mit besonderem Augenmerk auf die Veränderungen der gesellschaftlichen Gegebenheiten im Vergleich zum Stummfilm. Der Fokus liegt auf dem europäischen und nicht-englischsprachigen Raum, insbesondere auf der Zeit von 1928 bis 1933.
I. Einordnung ins historische Umfeld: Dieses Kapitel ordnet die Entstehung des Tonfilms in das historische Umfeld der „goldenen Zwanziger“ der Weimarer Republik ein. Es beschreibt die rasante Entwicklung von Film, Theater und Literatur in dieser Zeit und hebt die Verbindung des Films mit anderen Künsten hervor. Das Kino der Weimarer Republik wird als politisches Medium dargestellt, das bürgerliche Denkmuster in Frage stellte und reale gesellschaftliche Probleme aufzeigte. Die Entstehung des Tonfilms wird auch im Kontext der Filmarchivierung betrachtet, da er ein „Bewusstsein für Filmgeschichte“ schuf, das zuvor nur schwach ausgeprägt war.
II. Wie die Bilder sprechen lernten: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung des Tonfilms von den frühen Versuchen der musikalischen Untermalung von Stummfilmen bis hin zur Entwicklung von Tonfilmen mit synchroner Verbindung von Bild und Ton. Es werden die verschiedenen Verfahren erläutert: das Nadeltonverfahren, das zunächst mit Schallplatten funktionierte, und das Lichttonverfahren, welches die internationale Verbreitung des Tonfilms ermöglichte. Die Entwicklung und der Erfolg des Lichttonverfahrens, trotz anfänglicher Schwierigkeiten, werden detailliert dargestellt.
II. 3 Übernahme des Tonfilms durch die Filmindustrie: Dieses Kapitel behandelt die Gründung der Tobis als Ton-Bild-Syndikat AG und deren Bemühungen um die Standardisierung der europäischen Tonfilmtechnik. Der Fokus liegt auf der Notwendigkeit für die deutsche Filmindustrie, die Absatzmärkte zu sichern und die Tonfilmpatente gewinnbringend zu verwerten. Die Strategien und die Rolle der Tobis im Gegensatz zur Ufa, die zunächst zögerlicher agierte, werden hier analysiert.
Schlüsselwörter
Tonfilm, Stummfilm, Weimarer Republik, Nadeltonverfahren, Lichttonverfahren, Filmindustrie, ökonomische Folgen, soziale Folgen, Ästhetik, Tri-Ergon, Tobis, Ufa.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Aufsatz: Die Einführung des Tonfilms
Was ist der Gegenstand des Aufsatzes?
Der Aufsatz untersucht die Einführung des Tonfilms in der Filmgeschichte unter technischen, ökonomischen und ästhetischen Aspekten. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Vergleich zum Stummfilm und den daraus resultierenden gesellschaftlichen Veränderungen, hauptsächlich im europäischen, nicht-englischsprachigen Raum (fokussiert auf die Zeit von 1928 bis 1933).
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Der Aufsatz behandelt die technische Entwicklung des Tonfilms (Nadelton- und Lichttonverfahren), die wirtschaftlichen und sozialen Folgen (inkl. Auswirkungen auf die Filmwirtschaft und Schauspieler), und die ästhetische Neugestaltung des Films (Sprache, Kamera, Montage und Schauspiel). Die Übernahme des Tonfilms durch die Filmindustrie und die gesellschaftliche Rezeption werden ebenfalls beleuchtet.
Welche technischen Verfahren werden im Detail erklärt?
Der Aufsatz erläutert detailliert das Nadeltonverfahren (mit Schallplatten) und das Lichttonverfahren, welches die internationale Verbreitung des Tonfilms ermöglichte. Die Entwicklung und der Erfolg des Lichttonverfahrens werden im Kontext der Schwierigkeiten und Herausforderungen seiner Einführung dargestellt.
Welche wirtschaftlichen und sozialen Folgen werden diskutiert?
Der Aufsatz analysiert die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der Tonfilmeinführung auf die Filmindustrie und die Schauspieler. Er beleuchtet die Strategien der Tobis und Ufa bei der Standardisierung und Verwertung der Tonfilmpatente.
Welche ästhetischen Veränderungen werden im Aufsatz beschrieben?
Der Aufsatz untersucht die ästhetischen Veränderungen im Film durch die Tontechnologie, indem er die Auswirkungen auf Sprache, Kameraarbeit, Montage und Schauspiel analysiert und mit den ästhetischen Merkmalen des Stummfilms vergleicht.
Welche Rolle spielte die Tobis im Prozess der Tonfilmeinführung?
Der Aufsatz beschreibt die Gründung der Tobis als Ton-Bild-Syndikat AG und deren Rolle bei der Standardisierung der europäischen Tonfilmtechnik und der Sicherung der Absatzmärkte. Die Strategien der Tobis werden im Vergleich zu denen der Ufa analysiert.
Wie wird die Einführung des Tonfilms im historischen Kontext eingeordnet?
Der Aufsatz ordnet die Entstehung des Tonfilms in das historische Umfeld der „goldenen Zwanziger“ der Weimarer Republik ein, wobei die Verbindungen des Films zu anderen Künsten und seine Rolle als politisches Medium hervorgehoben werden. Die Entstehung des Tonfilms wird auch im Kontext der Filmarchivierung und des entstehenden „Bewusstseins für Filmgeschichte“ betrachtet.
Welche Kapitel umfasst der Aufsatz?
Der Aufsatz umfasst eine Einleitung, ein Kapitel zur Einordnung ins historische Umfeld, ein Kapitel über die Entwicklung des Tonfilms (inkl. Unterkapitel zu den Verfahren und der Übernahme durch die Industrie), ein Kapitel über die Konsequenzen des Tonfilms (inkl. wirtschaftlicher, sozialer und ästhetischer Aspekte) und ein Fazit.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Aufsatz?
Schlüsselwörter sind: Tonfilm, Stummfilm, Weimarer Republik, Nadeltonverfahren, Lichttonverfahren, Filmindustrie, ökonomische Folgen, soziale Folgen, Ästhetik, Tri-Ergon, Tobis, Ufa.
- Quote paper
- M. A. Nikola Poitzmann (Author), 2009, Vom bewegten zum klingenden Bild, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/126603