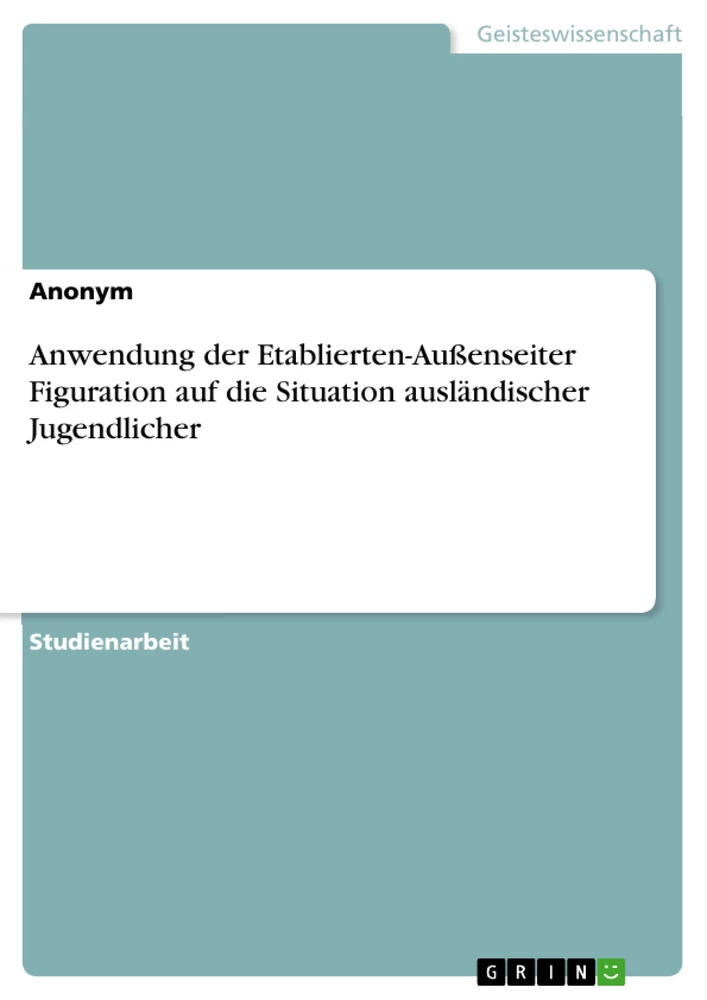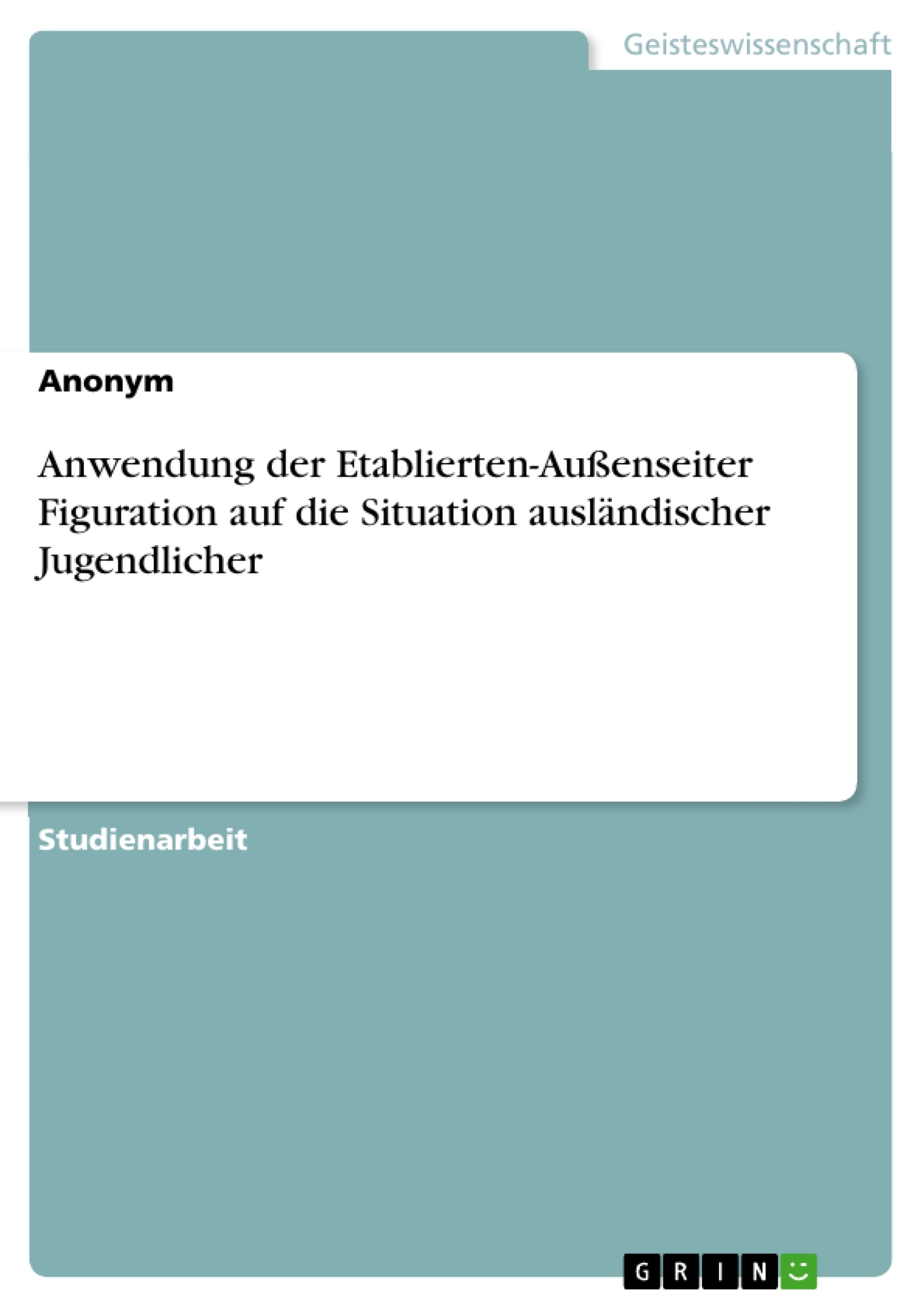In dieser Arbeit soll dargelegt werden, dass jugendliche AusländerInnen und die deutsche Mehrheitsgesellschaft in einer ganz bestimmten Positionierung, beziehungsweise Hierarchie, zueinanderstehen. Deshalb lautet die Forschungsfrage der Arbeit: Anwendung der Etablierten-Außenseiter-Figuration auf die Situation ausländischer Jugendlicher. Inwiefern lässt sich die Figuration jugendlicher AusländerInnen an deutschen Schulen auf die Etablierten-Außenseiter-Figuration nach Norbert Elias übertragen?
Zur Beantwortung dieser Frage wird im ersten Kapitel die Figurationssoziologie von Norbert Elias vorgestellt. Der Begriff Figuration wird zunächst definiert, außerdem wird in diesem Zusammenhang erklärt, was Elias unter Machtbalancen versteht und wie er seine theoretischen Schlüsse hierzu in seine Figurationssoziologie einbindet. In Kapitel drei wird das Etablierten-Außenseiter-Modell konkret vorgestellt und es wird auf die von Elias, zusammen mit seinem Schüler John L. Scotson im Jahr 1960, durchgeführte Studie mit dem Titel "Etablierte und Außenseiter" eingegangen. Das darauffolgende Kapitel behandelt die Stigmatisierung junger AusländerInnen in Deutschland. Dabei wird zunächst unter Bezugnahme von Goffman (1967) der Begriff Stigmatisierung definiert.
Anschließend wird auf die Auswirkungen von Stigmatisierung und die Stigma-Identitäts-These eingegangen. Um sich auf die Situation der jugendlichen AusländerInnen zu konkretisieren, wird das gesellschaftliche Leitbild und die Situation in den Schulen erläutert. In Kapitel fünf wird das Etablierten-Außenseiter-Modell auf die Situation ausländischer SchülerInnen angewendet. Abschließend werden die Ergebnisse im Fazit zusammengefasst. Die theoretische Ausarbeitung dieser Arbeit, geschieht anhand von themenspezifisch ausgewählter Literatur.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Figurationssoziologie nach Norbert Elias
- Der Begriff Figuration
- Machtbalancen
- Das Etablierten-Außenseiter-Modell
- Definition und Auswirkungen von Stigmatisierung
- Definition von Stigmatisierung
- Auswirkungen von Stigmatisierung
- Die Stigma-Identitäts-These
- Bildungsbenachteiligung & Stigmatisierung jugendlicher Ausländer
- Entstehung eines gesellschaftlichen Leitbildes
- Jugendliche Ausländer an deutschen Schulen
- Anwendung des Etablierten-Außenseiter-Modells
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Anwendung des Etablierten-Außenseiter-Modells von Norbert Elias auf die Situation ausländischer Jugendlicher an deutschen Schulen. Ziel ist es, die Positionierung und Hierarchie zwischen jugendlichen Ausländern und der deutschen Mehrheitsgesellschaft zu beleuchten und die Übertragbarkeit des Elias'schen Modells auf diesen Kontext zu analysieren.
- Stigmatisierung ausländischer Jugendlicher in Deutschland
- Bildungsbenachteiligung und ihre Ursachen
- Das Etablierten-Außenseiter-Modell von Norbert Elias
- Machtbalancen und soziale Interdependenz
- Die Rolle von Stereotypen und Vorurteilen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt anhand eines Rap-Zitates die Thematik der Stigmatisierung ausländischer Jugendlicher in Deutschland ein und beleuchtet die Anpassung des Verhaltens an gesellschaftliche Vorurteile. Sie hebt die Bedeutung der Schule als Sozialisationsinstanz hervor und verweist auf die Bildungsbenachteiligung ausländischer Schüler. Die Forschungsfrage wird formuliert: Inwiefern lässt sich die Figuration jugendlicher AusländerInnen an deutschen Schulen auf die Etablierten-Außenseiter-Figuration nach Norbert Elias übertragen?
Figurationssoziologie nach Norbert Elias: Dieses Kapitel beschreibt Elias' Figurationssoziologie, die die Interdependenz von Individuen und Gesellschaft betont. Der Begriff der Figuration wird definiert als ein Geflecht wechselseitiger Abhängigkeiten zwischen Menschen, und die Bedeutung von Machtbalancen in diesem Kontext wird erklärt. Elias' Konzept des „sozialen Menschen“ und die Rolle von gesellschaftlichen Symbolen für die Integration werden erläutert.
Das Etablierten-Außenseiter-Modell: Hier wird das von Elias und Scotson entwickelte Etablierten-Außenseiter-Modell detailliert vorgestellt. Es wird auf die Studie „Etablierte und Außenseiter“ Bezug genommen und die zentralen Aspekte des Modells im Hinblick auf soziale Ungleichheiten und Machtverhältnisse erläutert. Die Relevanz des Modells für die Analyse sozialer Ungleichheiten wird betont.
Definition und Auswirkungen von Stigmatisierung: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Stigmatisierung anhand der Arbeiten von Goffman und diskutiert die Auswirkungen von Stigmatisierung auf Betroffene. Die Stigma-Identitäts-These wird vorgestellt und die Verbindung zur Bildungsbenachteiligung hergestellt. Es wird gezeigt, wie Stigmatisierung die Lebensqualität und -chancen einschränkt.
Bildungsbenachteiligung & Stigmatisierung jugendlicher Ausländer: Der Abschnitt beleuchtet die Entstehung eines gesellschaftlichen Leitbildes und dessen Einfluss auf die Situation ausländischer Jugendlicher an deutschen Schulen. Die spezifischen Herausforderungen und Benachteiligungen, denen diese Jugendlichen ausgesetzt sind, werden analysiert und mit der vorherigen Diskussion der Stigmatisierung verbunden.
Anwendung des Etablierten-Außenseiter-Modells: Dieses Kapitel analysiert die Situation ausländischer Schüler im Lichte des Etablierten-Außenseiter-Modells. Es wird untersucht, wie sich die Dynamiken von Macht und Abhängigkeit zwischen der Mehrheitsgesellschaft und ausländischen Jugendlichen an deutschen Schulen manifestieren. Die Ergebnisse dieser Anwendung werden diskutiert.
Schlüsselwörter
Figurationssoziologie, Norbert Elias, Etablierte-Außenseiter-Modell, Stigmatisierung, Bildungsbenachteiligung, ausländische Jugendliche, deutsche Schulen, soziale Ungleichheit, Machtbalancen, Stereotype, Vorurteile, Integration.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Bildungsbenachteiligung und Stigmatisierung Jugendlicher mit Migrationshintergrund
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Anwendung des Etablierten-Außenseiter-Modells von Norbert Elias auf die Situation ausländischer Jugendlicher an deutschen Schulen. Sie analysiert die Positionierung und Hierarchie zwischen diesen Jugendlichen und der deutschen Mehrheitsgesellschaft und die Übertragbarkeit des Elias'schen Modells auf diesen Kontext. Die Arbeit konzentriert sich auf die Stigmatisierung und Bildungsbenachteiligung dieser Jugendlichen.
Welche Theorien und Konzepte werden verwendet?
Die zentrale Theorie ist die Figurationssoziologie von Norbert Elias, insbesondere das Etablierten-Außenseiter-Modell. Weitere relevante Konzepte sind Stigmatisierung (nach Goffman), soziale Ungleichheit, Machtbalancen, Stereotype und Vorurteile. Die Arbeit beleuchtet auch die Rolle von gesellschaftlichen Leitbildern und deren Einfluss auf die Integration von Jugendlichen mit Migrationshintergrund.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Figurationssoziologie nach Norbert Elias (inkl. Begriff der Figuration und Machtbalancen), Das Etablierten-Außenseiter-Modell, Definition und Auswirkungen von Stigmatisierung (inkl. Stigma-Identitäts-These), Bildungsbenachteiligung & Stigmatisierung jugendlicher Ausländer (inkl. Entstehung gesellschaftlicher Leitbilder), Anwendung des Etablierten-Außenseiter-Modells und Fazit.
Wie wird das Etablierten-Außenseiter-Modell angewendet?
Das Etablierten-Außenseiter-Modell wird verwendet, um die Machtverhältnisse und Abhängigkeiten zwischen deutschen Schülern und Schülern mit Migrationshintergrund an deutschen Schulen zu analysieren. Die Arbeit untersucht, wie sich die Dynamiken von Macht und Abhängigkeit zwischen der Mehrheitsgesellschaft und ausländischen Jugendlichen manifestieren.
Welche Forschungsfrage wird gestellt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Inwiefern lässt sich die Figuration jugendlicher AusländerInnen an deutschen Schulen auf die Etablierten-Außenseiter-Figuration nach Norbert Elias übertragen?
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Figurationssoziologie, Norbert Elias, Etablierten-Außenseiter-Modell, Stigmatisierung, Bildungsbenachteiligung, ausländische Jugendliche, deutsche Schulen, soziale Ungleichheit, Machtbalancen, Stereotype, Vorurteile und Integration.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, die Situation ausländischer Jugendlicher an deutschen Schulen im Hinblick auf Stigmatisierung und Bildungsbenachteiligung zu untersuchen und zu analysieren, inwieweit das Etablierten-Außenseiter-Modell von Norbert Elias diese Situation erklären kann.
Welche Zusammenfassung der Kapitel wird geboten?
Die Zusammenfassung der Kapitel bietet einen Überblick über die einzelnen Kapitel, beginnend mit der Einleitung, die die Thematik einführt und die Forschungsfrage formuliert. Anschließend werden die Konzepte der Figurationssoziologie und des Etablierten-Außenseiter-Modells erläutert. Die Kapitel zur Stigmatisierung und Bildungsbenachteiligung beleuchten die Auswirkungen auf ausländische Jugendliche. Das Kapitel zur Anwendung des Modells analysiert die Situation an deutschen Schulen und das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2020, Anwendung der Etablierten-Außenseiter Figuration auf die Situation ausländischer Jugendlicher, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1266266