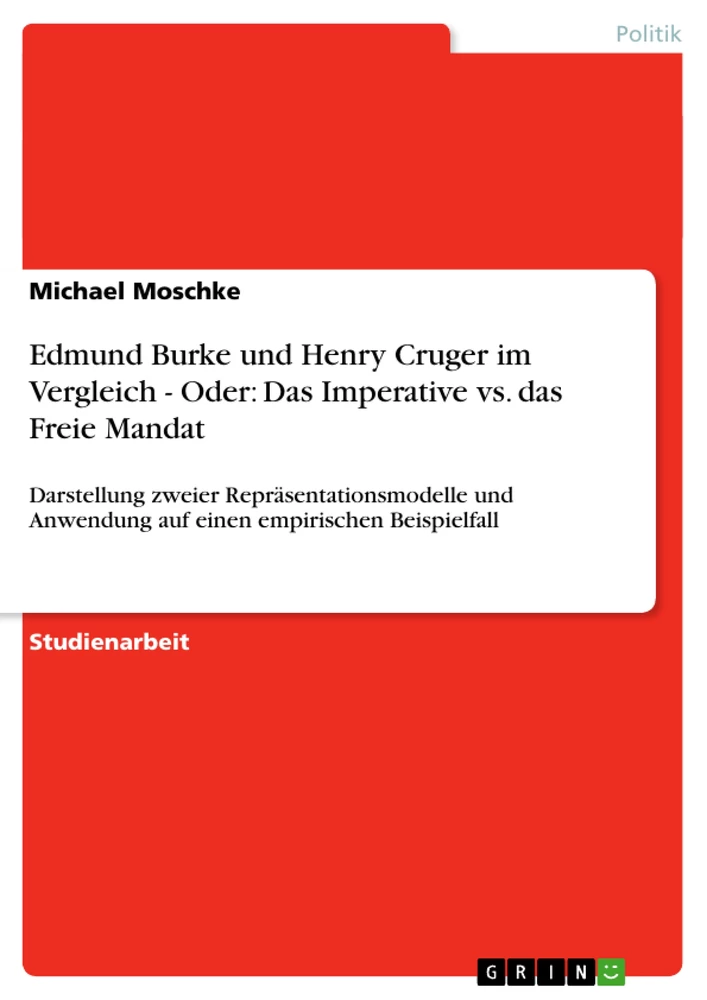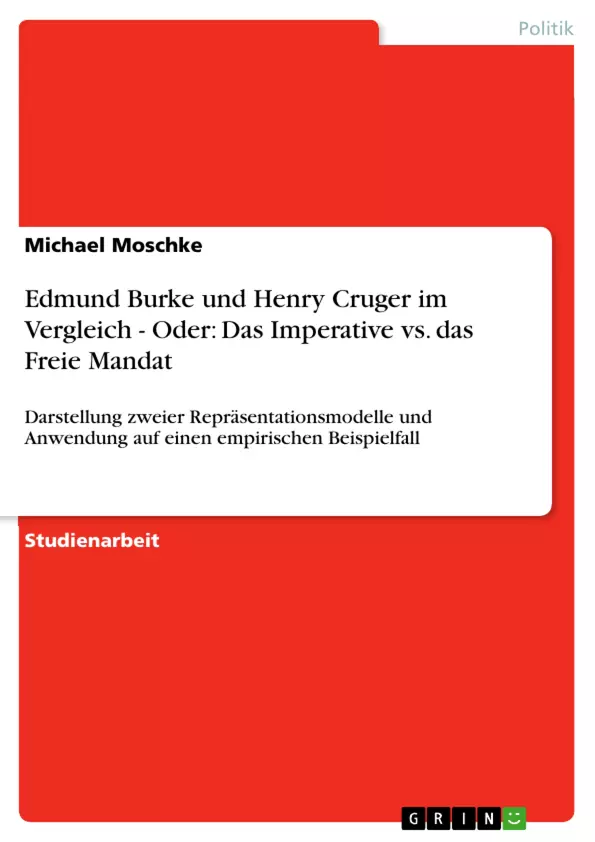Diese Arbeit wird sich zunächst mit den diametral entgegensetzten Repräsentationsvorstellungen - bezogen auf das Verhältnis von Abgeordneten und ihren Wahlkreisen - von Henry Cruger und Edmund Burke beschäftigen und diese sowohl ein einem – für diesen Zweck ausgezeichneten – Modellrahmen verorten sowie aus den Grundpositionen der beiden Politiker die intendierten Handlungspfade extrapolieren.
Im Anschluss gilt es ein – mikrosoziologisches – repräsentatives System auf seine repräsentativen Eigenschaften hin zu überprüfen und in Bezug auf die Positionen von Edmund Burke und Henry Cruger zu verorten.
Inhaltsverzeichnis
- Repräsentation – Eine Begriffsklärung und Einleitung
- Anzuwendende Theoretische Modelle
- Edmund Burke und Henry Cruger – Historischer Hintergrund
- Das imperative Mandat mit Focus auf den District – vertreten durch Henry Cruger
- Das Freie Mandat mit nationalem Focus - Vertreten durch Edmund Burke
- Einordnung der Theorie in die Repräsentationsmodelle
- Fallanalyse: Repräsentativprinzip in der Satzung der Studierendenschaft der TU Dresden
- Untersuchung
- Auswertung
- Bibliographie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Verhältnis von Abgeordneten und ihren Wählerschaften im Kontext politischer Repräsentation. Sie analysiert zwei gegensätzliche Repräsentationsmodelle, die von Edmund Burke und Henry Cruger vertreten werden, und ordnet diese in einen theoretischen Rahmen ein. Die Arbeit untersucht zudem ein konkretes Beispiel, die Satzung der Studierendenschaft der TU Dresden, um das Repräsentativprinzip in der Praxis zu beleuchten.
- Begriffsklärung und Definition von Repräsentation
- Vergleich der Repräsentationsmodelle von Edmund Burke und Henry Cruger
- Anwendung der Modelle auf ein empirisches Beispiel
- Analyse des Repräsentativprinzips in der Satzung der Studierendenschaft der TU Dresden
- Einordnung der Modelle in den theoretischen Rahmen der Repräsentationstheorie
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel widmet sich der Begriffsklärung von Repräsentation und beleuchtet die Schwierigkeiten, die mit einer eindeutigen Definition verbunden sind. Es wird auf die unterschiedlichen Ansätze in der Literatur eingegangen und die Arbeit von Pittkin zur Definition von Repräsentation als „making present in some sense of something which is nevertheless not present literally or in fact“ vorgestellt. Das Kapitel stellt die beiden zentralen Figuren der Arbeit, Edmund Burke und Henry Cruger, vor und skizziert ihren historischen Hintergrund.
Das zweite Kapitel stellt die beiden theoretischen Modelle vor, die für die Analyse der Repräsentationsmodelle von Burke und Cruger verwendet werden. Das erste Modell von Eulau et al. unterscheidet zwischen dem Fokus (lokal oder national) und dem Style (weisungsgebunden oder frei) der Repräsentation. Das zweite Modell, das Müller-Strokes-Modell, analysiert die Entscheidungspfade von Abgeordneten anhand von drei unabhängigen Variablen: der Politikpräferenz der Bürger, der Position des Abgeordneten und seiner persönlichen Einschätzung der dominanten Position im Wahlkreis.
Das dritte Kapitel widmet sich dem imperativen Mandat, das von Henry Cruger vertreten wird. Es wird erläutert, wie Cruger die Rolle des Abgeordneten als weisungsgebundenen Vertreter des Wahlkreises sah und welche Handlungspfade er aus dieser Position heraus ableitete. Das vierte Kapitel behandelt das freie Mandat, das von Edmund Burke vertreten wird. Es wird dargestellt, wie Burke die Rolle des Abgeordneten als freien Treuhänder sah, der sich nicht an die Weisungen seiner Wähler gebunden fühlte, sondern nach seinem eigenen Gewissen und dem Wohl des Landes handelte.
Das fünfte Kapitel ordnet die Theorien von Burke und Cruger in die beiden zuvor vorgestellten Modelle ein. Es wird gezeigt, wie sich die Positionen der beiden Politiker in Bezug auf Fokus und Style der Repräsentation sowie in Bezug auf die Entscheidungspfade von Abgeordneten im Müller-Strokes-Modell verorten lassen. Das sechste Kapitel analysiert das Repräsentativprinzip in der Satzung der Studierendenschaft der TU Dresden. Es werden die relevanten Passagen der Satzung untersucht und in Bezug auf die Positionen von Burke und Cruger eingeordnet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen politische Repräsentation, Edmund Burke, Henry Cruger, imperatives Mandat, freies Mandat, Fokus und Style der Repräsentation, Entscheidungspfade von Abgeordneten, Satzung der Studierendenschaft der TU Dresden, Repräsentativprinzip.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen dem freien und dem imperativen Mandat?
Beim freien Mandat (Burke) ist der Abgeordnete nur seinem Gewissen verpflichtet. Beim imperativen Mandat (Cruger) ist er an die Weisungen seiner Wähler bzw. seines Wahlkreises gebunden.
Welche Repräsentationsvorstellung vertrat Edmund Burke?
Burke sah den Abgeordneten als Treuhänder der gesamten Nation, der unabhängig von lokalen Wünschen nach dem Allgemeinwohl entscheiden sollte.
Wofür stand Henry Cruger in der Repräsentationsdebatte?
Cruger forderte eine enge Rückbindung des Abgeordneten an die Interessen und Instruktionen seines spezifischen Distrikts.
Was analysiert das Müller-Strokes-Modell?
Es untersucht Entscheidungspfade von Abgeordneten basierend auf Bürgerpräferenzen, der eigenen Position des Politikers und seiner Wahrnehmung der Wählermeinung.
Wie wird Repräsentation bei der Studierendenschaft der TU Dresden umgesetzt?
Die Satzung wird daraufhin untersucht, ob die gewählten Vertreter eher freien oder weisungsgebundenen Prinzipien folgen und wie der Fokus ihrer Arbeit definiert ist.
- Quote paper
- Michael Moschke (Author), 2009, Edmund Burke und Henry Cruger im Vergleich - Oder: Das Imperative vs. das Freie Mandat, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/126632