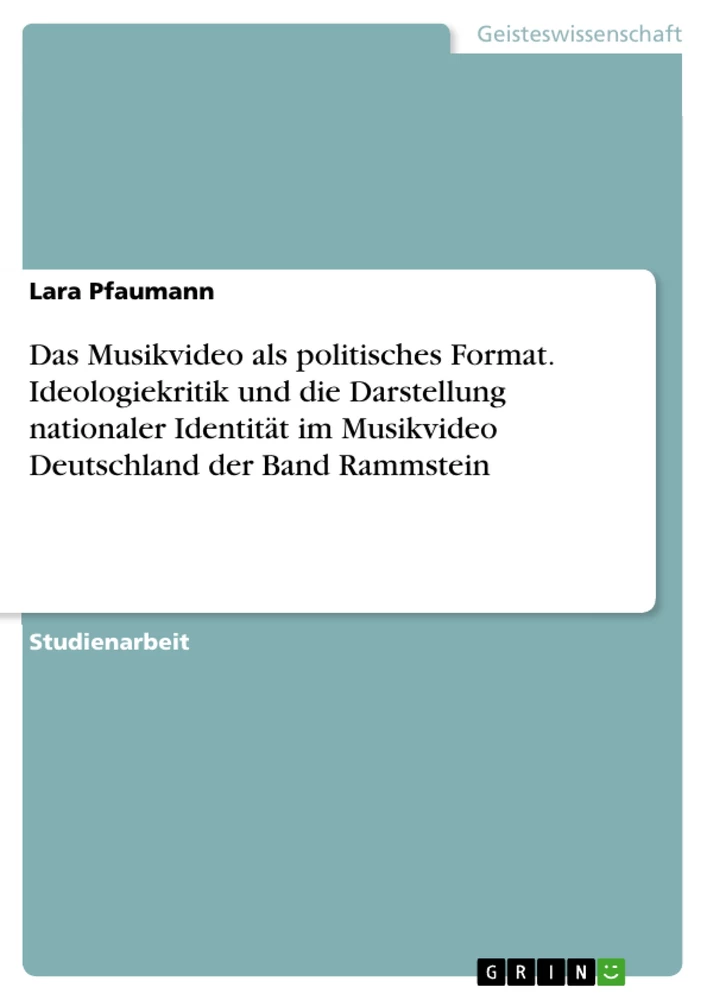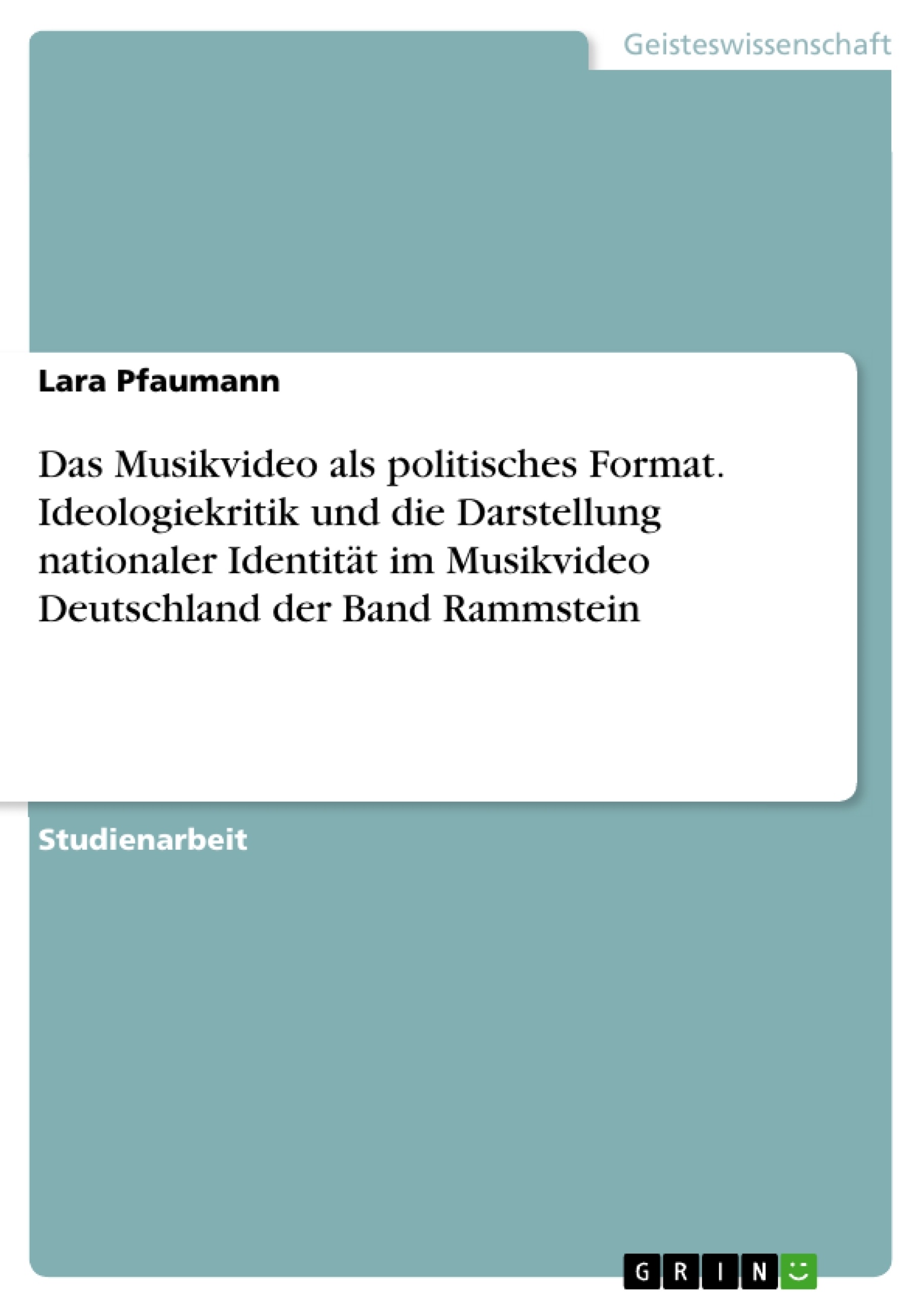Es soll die Funktion des Musikvideos als politisches Format am Beispiel von Deutschland untersucht werden, indem die Ideologiekritik und die Darstellung nationaler Identität im Video analysiert wird. Hierfür soll in einem ersten Schritt das Musikvideo als politisches Format bestimmt und dafür sowohl Politisierungspotentiale aufgezeigt als auch auf die Möglichkeiten eines Beitrags digitaler Medienformate zur Erinnerungskultur eingegangen werden.
Im Anschluss daran folgt zum besseren Verständnis nach einer kurzen Vorstellung der Band Rammstein sowie der charakteristischen Merkmale ihrer musikalischen, textuellen und visuellen Inszenierung eine komprimierte Analyse einiger der im Video dargestellten historischen Ereignisse, um daraufhin davon ausgehend die Darstellung des ambivalenten Verhältnisses zu nationaler Identität im Video zu analysieren und die damit verbundene Ideologiekritik herauszustellen. Außerdem sollen an dieser Stelle aktuelle Bezüge des Videos aufgezeigt und so dessen politischer Charakter unterstrichen werden.
Abschließend soll dann auf die Funktion des Musikvideos Deutschland als Erinnerungsanlass und die Möglichkeit eines Beitrags digitaler Medien zur Erinnerungskultur, etwa durch die Teilbarkeit und globale Kommunikationsangebote, sowie die sich daraus ergebenden mehrfachen Diskursebenen eingegangen werden, um so zu zeigen, dass das Musikvideo als digitales Format des Mediums YouTube das Potenzial besitzt, einen Beitrag zum kollektiven Gedächtnis der visuellen Medienkultur zu leisten und in räumlicher Hinsicht die Verbreitung und in zeitlicher die Tradierung von Inhalten des kollektiven Gedächtnisses zu ermöglichen. So soll im Zuge der Ausarbeitung die Funktion des Musikvideos als potenziell politisches Format herausgestellt und zudem eine Einordnung des analysierten Musikvideos Deutschland in aktuelle gesellschaftliche Diskurse vorgenommen werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Musikvideo als politisches Format
- 2.1 Charakteristika des Formats Musikvideo
- 2.2 Musikvideo und Erinnerungskultur
- 2.3 Möglichkeiten der Politisierung im Musikvideo
- 3. Charakteristika der Inszenierung der Band Rammstein
- 4. Rammsteins Musikvideo zu Deutschland (2019)
- 4.1 Analyse der historischen Verweise in Deutschland
- 4.2 Ideologiekritik und Darstellung nationaler Identität in Deutschland
- 5. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Funktion des Musikvideos als politisches Format am Beispiel von Rammsteins Musikvideo "Deutschland" (2019). Die Analyse fokussiert auf die Ideologiekritik und die Darstellung nationaler Identität in dem Video.
- Das Musikvideo als Format und seine Politisierungspotentiale
- Die Bedeutung des Musikvideos für die Erinnerungskultur
- Die Inszenierung der Band Rammstein und deren charakteristische Merkmale
- Analyse der historischen Verweise und symbolischen Bedeutungen im Musikvideo "Deutschland"
- Die Darstellung des ambivalenten Verhältnisses zu nationaler Identität im Video und die damit verbundene Ideologiekritik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung präsentiert die Ausgangslage und stellt das Musikvideo "Deutschland" der Band Rammstein vor. Es wird auf die kontroverse Debatte um den Skandal-Teaser eingegangen und der Forschungsgegenstand der Arbeit definiert.
Kapitel 2 erörtert den Begriff des Musikvideos als Format. Es werden die spezifischen Charakteristika des Formats, seine Bedeutung für die Erinnerungskultur und die Möglichkeiten der Politisierung im Musikvideo erläutert.
Kapitel 3 bietet eine kurze Vorstellung der Band Rammstein sowie ihrer charakteristischen Inszenierung. Die Kapitel 4.1 und 4.2 analysieren das Musikvideo "Deutschland" im Detail. Es werden die historischen Verweise im Video beleuchtet und die Darstellung des ambivalenten Verhältnisses zu nationaler Identität untersucht.
Schlüsselwörter
Musikvideo, Politisierung, Erinnerungskultur, Ideologiekritik, nationale Identität, Rammstein, Deutschland, Geschichte, Symbolismus, visuelle Medien, YouTube, kollektives Gedächtnis.
Häufig gestellte Fragen
Warum gilt das Rammstein-Video "Deutschland" als politisches Format?
Es nutzt eine Vielzahl historischer Verweise und Symbole, um die deutsche Geschichte kritisch zu reflektieren und nationale Identität zu hinterfragen.
Welche Rolle spielt die Erinnerungskultur in dem Musikvideo?
Das Video fungiert als Erinnerungsanlass, der durch digitale Medien (YouTube) globale Diskurse über die deutsche Vergangenheit anstößt.
Was wird an der nationalen Identität im Video kritisiert?
Die Arbeit analysiert das ambivalente Verhältnis ("Deutschland – meine Liebe kann ich dir nicht geben"), das zwischen Stolz, Schuld und Abscheu schwankt.
Welche historischen Epochen werden im Video thematisiert?
Das Video zeigt Szenen von der Römerzeit über das Mittelalter, die Hexenverbrennung und das Kaiserreich bis hin zum Nationalsozialismus und der DDR.
Wie trägt YouTube zum kollektiven Gedächtnis bei?
Durch die globale Teilbarkeit und die Kommentarfunktionen ermöglicht YouTube eine zeitliche Tradierung und räumliche Verbreitung von Inhalten des kollektiven Gedächtnisses.
- Arbeit zitieren
- Lara Pfaumann (Autor:in), 2022, Das Musikvideo als politisches Format. Ideologiekritik und die Darstellung nationaler Identität im Musikvideo Deutschland der Band Rammstein, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1267982