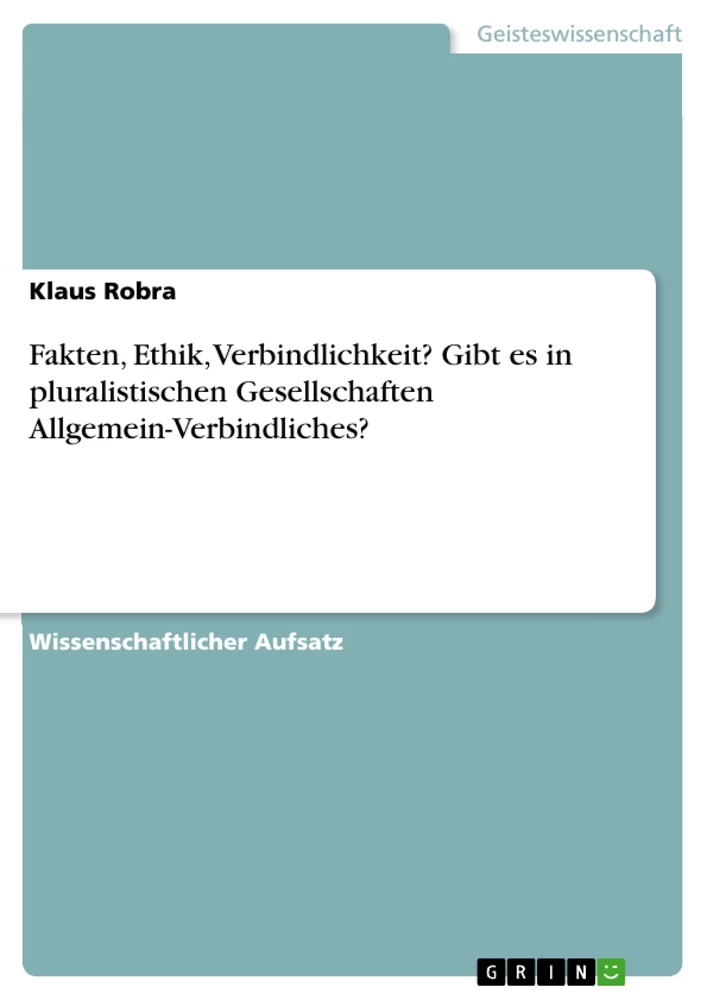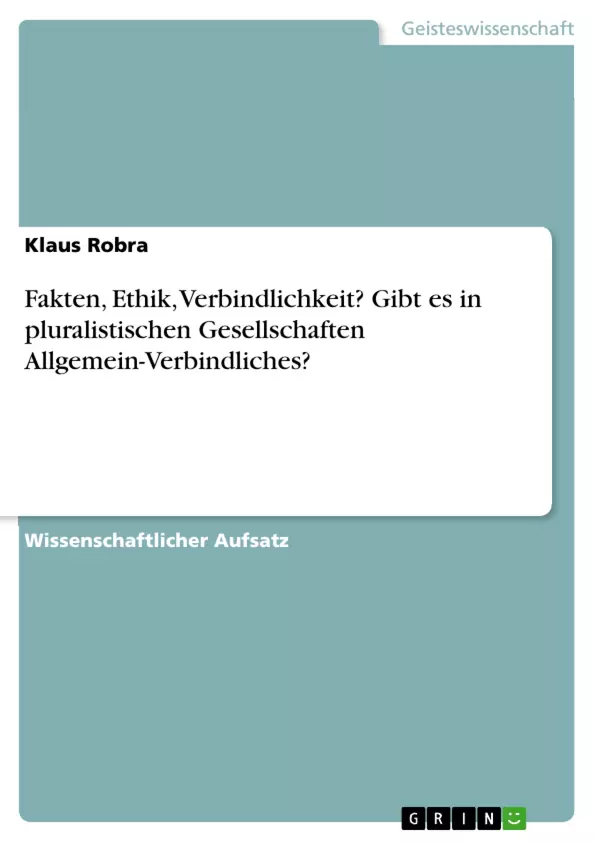Nicht selten wird behauptet, in einer pluralistischen Gesellschaft könne es keine allgemeine Verbindlichkeit geben. Was ist davon zu halten? Nun, verbindlich kann zweifellos nur das sein, was tatsächlich verbindet. Was aber nicht leicht herauszufinden ist, jedenfalls nicht in einer pluralistischen Gesellschaft, in der jede individuelle Ansicht gleich gültig zu sein beansprucht. Hilft da vielleicht nur noch eine "Chaos-Theorie" weiter, in der ein Schmetterling mit seinem Flügelschlag angeblich einen Tornado auslösen kann?
Wenn alles gleich gültig ist, sind permanente Konflikte vorprogrammiert. Nationalisten vertragen sich nicht mit Internationalisten, Kapitalisten verabscheuen Sozialisten und umgekehrt, Fundamentalisten lassen Andersgläubige nicht gelten; für sie ist nicht alles "gleich gültig". Schon an diesen wenigen Beispielen zeigt sich, dass Pluralismus nicht einfach in der allgemeinen Akzeptanz aller Meinungen bestehen kann. So dass sich erst recht die Frage aufdrängt, was denn überhaupt einen gesellschaftlichen Pluralismus ermöglichen kann.
Fakten, Ethik, Verbindlichkeit?
Gibt es in pluralistischen Gesellschaften Allgemein-Verbindliches?
Nicht selten wird behauptet, in einer pluralistischen Gesellschaft könne es keine allgemeine Verbindlichkeit geben. Was ist davon zu halten? Nun, verbindlich kann zweifellos nur das sein, was tatsächlich verbindet. Was aber nicht leicht herauszufinden ist, jedenfalls nicht in einer pluralistischen Gesellschaft, in der jede individuelle Ansicht gleich gültig zu sein beansprucht. Hilft da vielleicht nur noch eine „Chaos-Theorie“ weiter, in der ein Schmetterling mit seinem Flügel-schlag angeblich einen Tornado auslösen kann?
Wenn alles gleich gültig ist, sind permanente Konflikte vorprogrammiert. Natio-nalisten vertragen sich nicht mit Internationalisten, Kapitalisten verabscheuen Sozialisten und umgekehrt, Fundamentalisten lassen Andersgläubige nicht gelten; für sie ist nicht alles „gleich gültig“. Schon an diesen wenigen Beispielen zeigt sich, dass Pluralismus nicht einfach in der allgemeinen Akzeptanz aller Meinungen bestehen kann. So dass sich erst recht die Frage aufdrängt, was denn überhaupt einen gesellschaftlichen Pluralismus ermöglichen kann.
Wenn nicht alle Individuen einander gelten lassen, besteht die Gefahr, dass Un-recht bzw. rechtswidriges Verhalten gerechtfertigt wird. Eine Gefahr, die überdies in der Natur des Menschen zu liegen scheint, die anscheinend nicht nur das Gute, sondern auch das Böse aus dem Tierreich ererbt hat.1 So dass die ethische Dimen-sion unbedingt in die Diskussion über den Pluralismus einzubeziehen ist.
Wie Kant gezeigt hat, ist die Anerkennung des Individuums als Rechtsperson Grundvoraussetzung für jegliche Möglichkeit, subjektive Überzeugungen („die Maxime deines Willens“) mit der Allgemeinen Gesetzgebung in Einklang zu bringen und hierdurch moralische Verbindlichkeit zu erreichen, und zwar – auf Grund der angeblich unbedingten Gültigkeit des Kategorischen Imperativs – absolute Verbindlichkeit, zumal Kant die Würde der zurechnungsfähigen Person für absolut hält.2 Niemand steht über dem Gesetz, und es gibt keine unfehlbare Gesetzgebung, wie sich in der Menschheitsgeschichte immer wieder auch in bitteren Erfahrungen gezeigt hat. Schon Kant war sich dessen durchaus bewusst. Daher lautete seine Frage, wie die subjektive Maxime „Grundlage“ einer allgemeinen Gesetzgebung werden könne. Maßstäbe hierfür findet er im Sittengesetz, dem sowohl gegenüber der Rechtsperson als auch gegenüber der Gesetzgebung eine wesentliche Orientierungs- und Kontrollfunktion zukomme. Erweist sich ein Gesetz als unzulänglich – oder gibt es gar eine Gesetzeslücke –, muss jedermann das Recht auf Petition und Teilhabe an der Gesetzgebung zugebilligt werden, was zugleich eine der Grundlagen jeglicher demokratischer Verfassung und vernünftiger Rechtsstaatlichkeit ist. Auch jegliche Rechts-philosophie hat dies zu berücksichtigen.
Kompliziert wird die Sachlage (bzw. die Tatsachen-Lage) dadurch, dass Kants Kategorischer Imperativ sich als teilweise revisionsbedürftig oder gar hinfällig erwiesen hat. Diesbezüglich bin ich relativ spät auf Grund intensiver Nach-forschung zu folgendem Ergebnis gekommen:
„Kant weiß sehr wohl, dass es bestimmte Kräfte der Materie und des Geistes sind, die das Ding an sich ausmachen und als solches die Sinne und den Verstand des Subjekts berühren, „affizieren“. Dennoch hält er an der Annahme fest, dass die Materie der Welt der Erscheinungen angehört, so dass er mit dem Begriff Materie das Ding an sich nicht bestimmen kann. Darin sehe ich einen Widerspruch, der sich erst auflöst, wenn klar ist, dass die Materie in der Evolutionsgeschichte lange vor dem menschlichen Geist existiert hat, so dass „die unvollendete Entelechie der Materie“ (Bloch) mit ihrem In-Möglichkeiten-Sein sowohl dem Ding an sich als auch der Erscheinungswelt zu Grunde liegt. Dies bedeutet allerdings
1., dass der Begriff ‚Ding an sich‘ hinfällig wird und durch Ausdrücke wie ‚das Erschienene und das (noch) nicht Erschienene‘, ‚das Bekannte und das Unbekannte‘, ‚das Erkannte und das (noch) Unerkannte‘, das ‚Noch-Nicht‘, zu ersetzen ist, und
2., dass der Begriff ‚Ding an sich‘ ebenfalls nicht geeignet ist, die angeblich „unbedingte“ Freiheit transzendental zu fundieren. Hierfür kommt wahrscheinlich eher die „unvollendete Entelechie der Materie“ in Frage, zumal Freiheitsmomente sowohl im Geist als auch in der Natur zu beobachten sind. …
Generell kann man den Begriff ‚Ding an sich‘ wohl durch Ernst Blochs NOCH NICHT ersetzen. Gegen einen solchen radikalen Verzicht scheint die Tatsache zu sprechen, dass wir in Folge unserer Gebundenheit an Sinne und Verstand doch wirklich nicht wissen können, ob wir die Dinge so erkennen, wie sie sind. Vollständig abgedeckt und neu interpretiert wird dieser Aspekt jedoch durch Karl Popper s Falsifikationstheorie, wonach man für jedwede Aussage einen Anspruch auf Wahrheit, Stimmigkeit, Richtigkeit und Gültigkeit nur so lange erheben kann, wie keine neuen Fakten dagegen sprechen.
Entfällt der Dualismus von Ding an sich und Erscheinung, werden auch die Verabsolutierungen der Kantschen Sollensethik fragwürdig oder hin-fällig, darunter vor allem die „Allgemeine Gesetzgebung“ sowie die Begriffe Pflicht und Sollen.
Gutes wollen und es dann auch tun, reicht Kant nicht. Gleiches gilt für den von ihm so hoch geschätzten „guten Willen“: Erst wenn das Wollen sich in ein Sollen verwandelt hat, kann der Kategorische Imperativ befolgt werden. Dabei verkennt Kant wesentliche Eigenschaften des Willens. Dieser ist nämlich per se nicht nur im unterbewussten Sein, sondern auch in Verstand und Vernunft verankert. Ethisch hochwertiges Wollen, das Wollen des Guten, kann durchaus auch bei der Umsetzung in vernünftige Taten rational begleitet und kontrolliert werden.“3
Hieraus leite ich allerdings – trotz aller Kritik – eine legitime Forderung ab, die an die Stelle des teilweise obsolet gewordenen Kategorischen Imperativs treten und eine neue Verbindlichkeit schaffen kann, die auch dem Zusammenhalt einer plu-ralistischen Gesellschaft dient. – Wobei sich sogleich die Frage stellt, ob es sich dabei um eine absolute, „endgültige“ oder nur um eine relative, provisorische Verbindlichkeit handelt (s.u.).
Die legitime Forderung lautet:
Achte bei allem, was Du tust, darauf, Dich selbst und Deine Mit-Menschen als Rechtspersonen und Persönlichkeiten zu respektieren und möglichst stets das Sittengesetz zu befolgen.
„Möglichst“ deshalb, weil es Ausnahmesituationen gibt, wie z.B. die der Notwehr, in denen die Rechte der eigenen Person gegen existenzielle Bedrohungen und Rechtsbrüche jeder Art zu verteidigen sind.
Es ist eine Forderung, die erst recht im Zusammenhang einer Erweiterten soziali-stischen Öko-Ethik ihre Wirksamkeit voll entfaltet. Zeitgemäße Öko-, Natur- und Tier-Ethik ergänzt die legitime Forderung. Demgemäß lautet meine weiter gehende Forderung:
Verhalte Dich so, dass Du die Natur in jeder Person und in jeder anderen Erscheinungsform stets als Zweck – und als Mittel nur zu ethisch begründbaren und moralisch vertretbaren Zwecken – behandelst.4
Was mit dem Sittengesetz heutzutage gemeint sein kann, wird somit deutlich. Im Rahmen der neu gefassten Öko-Ethik vermag das Sittengesetz, den gesellschaftlichen Pluralismus – verstehbar u.a. als eher zufällige Ansammlung von Individuen – so abzusichern, dass er sich für die Einzelpersonen nicht schädlich auswirkt. Unterschiedliche Meinungen und Überzeugungen sind zu akzeptieren, aber: als Eigenschaften von Rechtspersonen, die im Sittengesetz Halt und Orientierung finden können. Zumal das Sittengesetz auch die Allgemeine Gesetzgebung umfasst.
Nichtsdestoweniger gibt es Grenzen der Ethik, die zu beachten sind. Darunter vor allem:
a) Ethik kann nicht mit der Mathematik konkurrieren, nichts Unumstößliches festlegen.
b) Die tatsächlichen Wirkungsbereiche und -möglichkeiten der Individuen und der Gesellschaften sind nicht überschaubar und reichen zuweilen nur so weit wie deren Urteilskraft. Es sind Wirkungsbereiche, die von keiner Ethik in allen Details bestimmt werden können.
c) Zielkonflikte sind nicht selten nur vorläufig mit Mitteln der Ethik zu bewältigen.5
Zu den Fakten, den Tatsachen
Was eine Tatsache ist, erklärt Walter Schulz kurz und bündig folgendermaßen:
„Sachverhalt und Tatsache sind dialektische Bestimmungen. Tatsache ist der bestehende Sachverhalt, und Sachverhalt ist das, was möglicherweise der Fall ist; …“6
Damit aber begnügt Ludwig Wittgenstein sich nicht. Für ihn ist die Welt a) „alles, was der Fall ist“ und b) „die Gesamtheit der Tatsachen, nicht der Dinge“.7 Womit er jedoch schlagartig die Zukunft ausblendet und die Gegenwart ihrer möglicher-weise wertvollsten Perspektiven beraubt. Wittgenstein ignoriert, was noch nicht der Fall ist; und er negiert die Tatsache, dass es neben Geschehenem auch Unge-schehenes, neben der (be)greifbaren Realität auch die Utopie gibt. Darüber hinaus entgeht ihm die ethische Perspektive, die im Blick auf die Verbindung von Moral- und Tatsachenwelt aufblüht, behauptet er doch:
„Es ist klar, daß sich die Ethik nicht aussprechen läßt. Die Ethik ist trans-cendental.“8
Dagegen betone ich, dass Ethik nicht bloß „transcendental“ ist oder gar sich „nicht aussprechen läßt“, sondern auf Tatsachen, darunter vorzüglich diejenigen der Moral (!), abhebt.
Fakten-Analyse
Auch alle ethischen Werte und Normen beruhen auf den Ergebnissen von Arbeit und somit auf Tatsachen. Wer diese analysiert, bewegt sich in dialektischen Subjekt-Objekt-Beziehungen. Neue Objekte erweitern meinen subjektiven Hori-zont, den ich nutze, um die Objekte zu verstehen und zu erklären. Nicht ohne mir der Tatsache bewusst zu sein, dass in beiden Bereichen, d.h. sowohl im Subjekti-ven als auch im Objektiven, umfangreiche Differenzierungen erforderlich sind. Objekte erscheinen in der Innenwelt, d.h. im Bewusstsein, als mentale Objekte, die folglich nicht mit „Objekten“ bzw. Gegenständen der Außenwelt („Objekt-Schutz“ etc.) identisch sind. Nichtsdestoweniger können mentale Objekte durch Referenz-Objekte aller Art erzeugt werden, d.h. durch Gegenstände sowohl der Außenwelt als auch der Innenwelt. Obwohl Letztere mit den mentalen Objekten weitgehend identisch sind, lassen diese sich ihrer Herkunft gemäß weiter unter-scheiden, und zwar in a) solche, die, aus der Außenwelt oder dem eigenen Körper stammend, durch Sinneswahrnehmungen ins Bewusstsein gelangen, und b) solche, die in der Innenwelt selbst entstehen, und zwar 1. durch Wahrnehmung, 2. durch Information, 3. durch Vorstellungen, also aus dem Gedächtnis abgerufen, 4. durch begriffliches und/oder nicht-sprachliches Denken.
Bei allen diesen Bewusstseins-Vorgängen tritt Sprache quasi automatisch in Aktion. Zwar gibt es auch nicht-sprachliches Denken, z.B. in Bildern und nicht-sprachlichen Vorstellungen, aber stets werden für die Bewusstseins-Inhalte sprachliche Bezeichnungen gesucht und durchweg auch gefunden. So dass Fak-ten-Analysen durchweg in sprachlicher Form als vorrangigem Mittel der Kommu-nikation erfolgen, ohne dabei von bestimmten natürlichen Einzelsprachen abzu-hängen. Und ohne die Tatsache zu leugnen, dass in wissenschaftlicher Forschung Einsichten, Entdeckungen und Erkenntnisse sich auch in nicht-sprachlicher Form vollziehen können, wie u.a. Einstein und Heisenberg berichtet haben.
Unmöglich sind hingegen Fakten-Analysen ohne vorgängiges Wissen als Voraus-setzung des Verstehens; eine Tatsache, aus der sich auch das scheinbare Über-gewicht des subjektiven Faktors beim Verstehen erklärt. „Man versteht anders, wenn man überhaupt versteht“, sagt Gadamer, ohne dabei jedwede Objektivität, z.B. in Form von „Horizontverschmelzungen“, auszuschließen. Lässt sich dann aber überhaupt noch eine Grenze zwischen Analyse und Interpretation ziehen? Wohl nur dann, wenn man berücksichtigt, dass Wissen und Verstehen notwen-dige, aber nicht hinreichende Bedingungen der Fakten-Analyse sind. Denn trotz aller Subjektivität des Wissens und des Verstehens beruht Fakten-Analyse stets auch auf Tatsachen-Behauptungen und untersteht somit dem Anspruch auf Wahrheit. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, muss die Aussage über einen Sachverhalt bzw. eine Tatsache überprüfbar zutreffen. Wobei neben der elementaren Korrespondenz-Theorie häufig die Kohärenz- und Konsens-Theorien der Wahrheit zum Zuge kommen. Mit der Komplikation, dass „auch Konzilien können irren“, d.h. auch Experten-Meinungen nicht unfehlbar sind. Behebbar wohl nur durch Karl Popper s Falsifikations-Theorie, die der Theorie-Abhängigkeit jeglichen Wissens, Verstehens und Erklärens Rechnung trägt. Jedwede Behauptung mit Wahrheitsanspruch ist nur so lange konsensfähig, wie neue Fakten dies nicht ausschließen. Womit auch über die Frage nach der Verbindlichkeit mehr Klarheit zu gewinnen sein dürfte (s.u.).
Daten-Analyse
ist die in unserem Zeitalter der Digitalisierung wohl gängigste Form der Fakten-Analyse. Beispiele hierfür können und müssen die obigen, vorwiegende theore-tischen Überlegungen ergänzen. In weiten Praxis-Bereichen hat diese Form der Analyse quasi existenzielle Relevanz gewonnen, so insbesondere im Wirtschafts-leben. Wobei zugestanden wird, dass die Zuordnung von Besonderem und All-gemeinen hier durchgängig unter dem Vorzeichen einer bestimmten Zweckset-zung, nämlich derjenigen der Profitmaximierung, erfolgt. Was jedoch der grund-sätzlichen, generellen Bedeutung dieser Zuordnung für wahrscheinlich fast alle anderen Praxis-Bereiche keinen Abbruch tut. Die im Folgenden referierten Formen der Daten-Analyse lassen sich nämlich durch geeignete Umformulie-rungen auf nahezu sämtliche Praxis-Bereiche übertragen. Dennoch halte ich mich zunächst an den Wortlaut der Präsentation, in der zwischen „Business Intelli-gence“ und „Business Analytics“ wie folgt unterschieden wird:
„Sowohl Business Intelligence als auch Business Analytics sind Datenmanagement-Lösungen, die die in einem Unternehmen anfallenden aktuellen und historischen Daten sammeln, sie analysieren und Einsichten in die verschiedenen Prozesse zur Unterstützung von Entscheidungs-prozessen ermöglichen. Sie unterscheiden sich jedoch in ihrer Zielsetzung und der Art wie sie dies tun und welche Informationen sie bereitstellen.
Business Intelligence beschäftigt sich mit der Fragestellung: "Was ist in der Vergangenheit bis heute geschehen und warum ist es geschehen?". Die Business Intelligence findet Muster und Trends, zielt aber nicht darauf ab, die zukünftigen Entwicklungen vorherzusagen.
Business Analytics konzentriert sich auf die Fragestellung: "Warum ist etwas geschehen und was bedeutet das für die Zukunft?". Es werden die verantwortlichen Faktoren und kausalen Zusammenhänge für die Geschehnisse und Abläufe ermittelt. Diese nutzt Business Analytics, um Vorhersagen über zukünftige Entwicklungen zu machen.
Entsprechend der Unterscheidung von Business Intelligence und Business Analytics lassen sich die relevanten Analysemethoden in verschiedene übergeordnete Kategorien einteilen. Wir nehmen eine Unterteilung in diese fünf Kategorien vor:
die deskriptive Analyse
die explorative Analyse
die diagnostische Analyse
die prädiktive Analyse
die präskriptive Analyse
Beginnend bei der Kategorie der deskriptiven Analyse bis zur Kategorie der präskriptiven Analyse steigen Komplexität und Aufwand der Datenauswertung, aber auch der Mehrwert für das Unternehmen. Im Folgenden stellen wir Ihnen die fünf Kategorien näher vor.
a) Die deskriptive Datenanalyse
Die deskriptive Datenanalyse, auch als beschreibende Datenauswertung bezeichnet, konzentriert sich auf die Daten aus der Vergangenheit. Sie ordnet und strukturiert empirische Daten. Durch die Datenauswertung soll die Fragestellung beantwortet werden: "Was ist passiert?". Beispielsweise liefert sie Informationen wie den Umsatz im letzten Quartal oder die Art und die Anzahl von Serviceanfragen. Um diese Ergebnisse zu liefern, kann die deskriptive Analyse Daten aus verschiedenen Quellen extrahieren und die Informationen aggregieren, ordnen und strukturieren. Die deskriptive Analyse liefert aber keine Antworten auf Fragen wie: "Warum ist etwas geschehen?". Oft werden deskriptive Datenanalysen mit anderen Analysemethoden kombiniert.
b) Die explorative Datenanalyse
Ziel der explorativen Datenanalyse ist es, Zusammenhänge in Daten zu finden und Hypothesen zu generieren. Vor der explorativen Analyse existiert nur ein begrenztes Wissen über die Zusammenhänge der Daten und Variablen. Typischer Anwendungsbereich für die explorative Datenanalyse ist das Data Mining. Durch das Aufdecken von Zusammenhängen mit Hilfe der explorativen Datenanalyse lassen sich Rückschlüsse auf die Ursachen der Vorgänge ziehen.
c) Die diagnostische Datenanalyse
Die diagnostische Datenanalyse beschäftigt sich ganz konkret mit der Fragestellung: "Warum ist etwas geschehen?". Indem sie historische und andere Daten vergleicht, Muster identifiziert und Zusammenhänge aufdeckt, findet sie Ursachen oder gegenseitige Wechselwirkungen. Mit Hilfe der diagnostischen Datenanalyse können Unternehmen konkrete Problemstellungen lösen, da die Ursachen aufgezeigt werden.
d) Die prädiktive Datenanalyse
Die prädiktive Datenanalyse, auch als Vorhersageanalyse bzw. Predictive Analytics bezeichnet, gestattet den Blick in die Zukunft. Es wird die Fragestellung beantwortet: "Was wird passieren?". Um die richtigen Vorhersagen zu treffen, nutzt die prädiktive Datenanalyse die Ergebnisse der zuvor beschriebenen deskriptiven, explorativen oder diagnostischen Analysemethoden sowie Algorithmen und Methoden der Künstlichen Intelligenz (KI) und des Maschinellen Lernens (ML). Durch das Finden von Zusammenhängen, Ursachen und zeitlichen Tendenzen werden zukünftige Trends vorhersagbar. Die Vorhersagewahrscheinlichkeit und -genauigkeit hängen maßgeblich von der Qualität der Daten, den gefundenen Mustern, Zusammenhängen und Trends sowie von der Intelligenz der Algorithmen ab. Beispielsweise lassen sich zukünftige Umsätze vorhersagen oder das Kundenverhalten prognostizieren.
e) Die präskriptive Datenanalyse
Die präskriptive Datenanalyse ist die komplexeste und aufwendigste Analysekategorie. Sie liefert Unternehmen aber einen immensen Mehrwert, indem Sie die Fragestellung beantwortet: "Mit welchen Maßnahmen lassen sich Probleme beseitigen, zukünftige Entwicklungen positiv beeinflussen oder die gesetzten Ziele erreichen?". Präskriptive Datenauswertungen basieren auf historischen und aktuellen Daten interner und externer Datenquellen. Sie nutzen Ergebnisse zuvor beschriebener Analysekategorien. Die Vorhersagen werden kontinuierlich aktualisiert. Zum Einsatz kommen ML- und KI-Algorithmen, neuronale Netzwerke, Simulationen und Business Regeln.“9
Es kommt also darauf an, nicht nur die Fakten als solche, sondern auch die Zu-sammenhänge zwischen ihnen zu erkennen; was am besten mittels der dialekti-schen Methode möglich zu sein scheint. In der Präsentation wird Datenanalyse – in aufsteigender Komplexität – dargestellt als
a) deskriptiv, mit dem Ziel, die empirischen Daten über vergangene Ereig-nisse zu ordnen und zu strukturieren,
b) explorativ, insbesondere zur Erforschung von Zusammenhängen und zur Gewinnung von Hypothesen,
c) diagnostisch, speziell zur Ermittlung von Ursachen und deren Wirkungen,
d) prädiktisch, mithin auf die Zukunft gerichtet, und zwar anhand der mit a) bis c) erzielten Ergebnisse, zu ergänzen durch KI und Maschinelles Lernen, sodass Trends und Tendenzen der Entwicklung erkennbar werden,
e) präskriptiv, mit dem höchsten Anspruch, anhand der Daten-Auswertung Probleme zu lösen, Entwicklungen zu steuern und die gesetzten Ziele zu erreichen.
Mit meinen theoretischen Überlegungen (s.o.) ist diese Differenzierung durch-weg kompatibel. Nur auf Grund von Vor-Wissen lässt sich aus Daten neues Wissen gewinnen. Analytiker/innen müssen sich ihrer Methoden sicher sein. Nur dann kann wissensbasiertes Verstehen zu Fakten-Analysen verhelfen, die dem Wahrheitsanspruch gerecht werden.
Verbindlichkeit kann nicht auf grund ideologischer, politischer und religiöser Argumente erreicht werden, wohl aber durch philosophische Reflexion, die vor allem auf Synthesen aus rechtlichen, moralischen, ethischen und erkenntnistheoretischen Faktoren abzielt. Nur wenn die Individuen als Rechtspersonen anerkannt werden, können sie wirksam geschützt werden, können Rechtsverstöße geahndet – und mögli-cherweise in Gewalt ausartende – Konflikte vermieden oder entschärft werden. Dann erst können die Einzelpersonen sich am Sittengesetz einschließlich der Allgemeinen Gesetzgebung orientieren und sowohl das eigene Verhalten als auch das der Anderen bewerten und kontrollieren.
In Verbindung mit neuer Öko-, Natur- und Tier-Ethik wird Verbindlichkeit möglich, allerdings nicht in absoluter, sondern in relativer, provisorischer Art und Weise. Denn auch die neue, am Sittengesetz orientierte Öko-Ethik bleibt auf die philosophische Aufarbeitung und Systematisierung der Moral angewiesen und somit – in ihren Grenzen (s.o.) – dynamisch gebunden an die handfesten, ver-änderlichen Tatsachen des Lebens und des Geistes. Auch die Wahrheitsansprüche der Tatsachen-Behauptungen unterliegen dem Gebot der Falsifizierbarkeit und der Überprüfbarkeit der ihnen zu- und übergeordneten Theorien; so dass – ethisch basiert – in pluralistischen Gesellschaften nur relative, nicht absolute Verbindlich-keit erreichbar wird.
Literaturverzeichnis
Kant, Immanuel 1965: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (1785), Hamburg
Moderne Datenanalyse, in: https://www.datapine.com>de>atikel>datenanalyse-verfahren-methoden
Robra, Klaus o.J. (2020): Ethik der Verhaltenssteuerung. Eine Neubegründung, München (GRIN-Verlag)
Robra, Klaus 2022: Ethische Grundlagen des Sozialismus, München (GRIN-Verlag)
Schulz, Walter 1979: Wittgenstein. Die Negation der Philosophie, Pfullingen 1967, 2. Auflage 1979
[...]
1 Vgl. Robra 2022, S. 2; ferner auch: K. Robra: Politik ohne Moral? Zu: Norbert Bolz:‘Keine Macht der Moral. Politik jenseits von Gut und Böse (i. Vorb.)
2 Vgl. Kant 1965, S. 58 ff.
3 Vgl. Robra o.J. (2020), S. 11 f.
4 Vgl. Robra 2022, S. 28 ff.
5 Vgl. Robra o.J. (2020), S. 25-27
6 Schulz 1979, S. 24
7 Wittgenstein, in: Schulz a.a.O., S. 16
8 Wittgenstein, in: Schulz a.a.O. S. 34
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema des Textes "Fakten, Ethik, Verbindlichkeit?" Gibt es in pluralistischen Gesellschaften Allgemein-Verbindliches?"?
Der Text untersucht, ob es in pluralistischen Gesellschaften eine allgemeine Verbindlichkeit geben kann. Er erörtert die Herausforderungen des Pluralismus, die Rolle der Ethik, die Bedeutung der Anerkennung des Individuums als Rechtsperson und die Grenzen der Ethik.
Welche Rolle spielt die Ethik in Bezug auf den Pluralismus laut dem Text?
Der Text betont, dass die ethische Dimension unbedingt in die Diskussion über den Pluralismus einbezogen werden muss, da die Gefahr besteht, dass Unrecht oder rechtswidriges Verhalten gerechtfertigt wird, wenn nicht alle Individuen einander gelten lassen.
Was ist die "legitime Forderung", die an die Stelle des Kategorischen Imperativs treten soll?
Die legitime Forderung lautet: "Achte bei allem, was Du tust, darauf, Dich selbst und Deine Mit-Menschen als Rechtspersonen und Persönlichkeiten zu respektieren und möglichst stets das Sittengesetz zu befolgen."
Wie wird das Sittengesetz im Kontext der Öko-Ethik definiert?
Das Sittengesetz im Rahmen der neu gefassten Öko-Ethik dient dazu, den gesellschaftlichen Pluralismus abzusichern, so dass er sich für die Einzelpersonen nicht schädlich auswirkt. Es umfasst auch die Allgemeine Gesetzgebung.
Welche Grenzen der Ethik werden im Text genannt?
Die Grenzen der Ethik umfassen: a) Ethik kann nicht mit der Mathematik konkurrieren; b) Die tatsächlichen Wirkungsbereiche sind nicht überschaubar; c) Zielkonflikte sind oft nur vorläufig zu bewältigen.
Wie definiert Walter Schulz den Begriff "Tatsache"?
Walter Schulz definiert "Tatsache" als den bestehenden Sachverhalt, wobei Sachverhalt das ist, was möglicherweise der Fall ist.
Was sind die verschiedenen Kategorien der Datenanalyse, die im Text besprochen werden?
Die relevanten Analysemethoden werden in fünf Kategorien eingeteilt: die deskriptive Analyse, die explorative Analyse, die diagnostische Analyse, die prädiktive Analyse und die präskriptive Analyse.
Was ist der Unterschied zwischen Business Intelligence und Business Analytics laut dem Text?
Business Intelligence beschäftigt sich mit der Frage: "Was ist in der Vergangenheit bis heute geschehen und warum ist es geschehen?", während Business Analytics sich auf die Frage konzentriert: "Warum ist etwas geschehen und was bedeutet das für die Zukunft?".
Welche Rolle spielt die Falsifikationstheorie von Karl Popper im Zusammenhang mit Fakten-Analysen?
Die Falsifikationstheorie berücksichtigt die Theorie-Abhängigkeit jeglichen Wissens, Verstehens und Erklärens. Jedwede Behauptung mit Wahrheitsanspruch ist nur so lange konsensfähig, wie neue Fakten dies nicht ausschließen.
Kann Verbindlichkeit in pluralistischen Gesellschaften absolut erreicht werden?
Nein, in pluralistischen Gesellschaften kann Verbindlichkeit nicht in absoluter, sondern nur in relativer, provisorischer Art und Weise erreicht werden, da auch die neue Öko-Ethik an die veränderlichen Tatsachen des Lebens und des Geistes gebunden bleibt.
- Arbeit zitieren
- Dr. Klaus Robra (Autor:in), 2022, Fakten, Ethik, Verbindlichkeit? Gibt es in pluralistischen Gesellschaften Allgemein-Verbindliches?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1268160