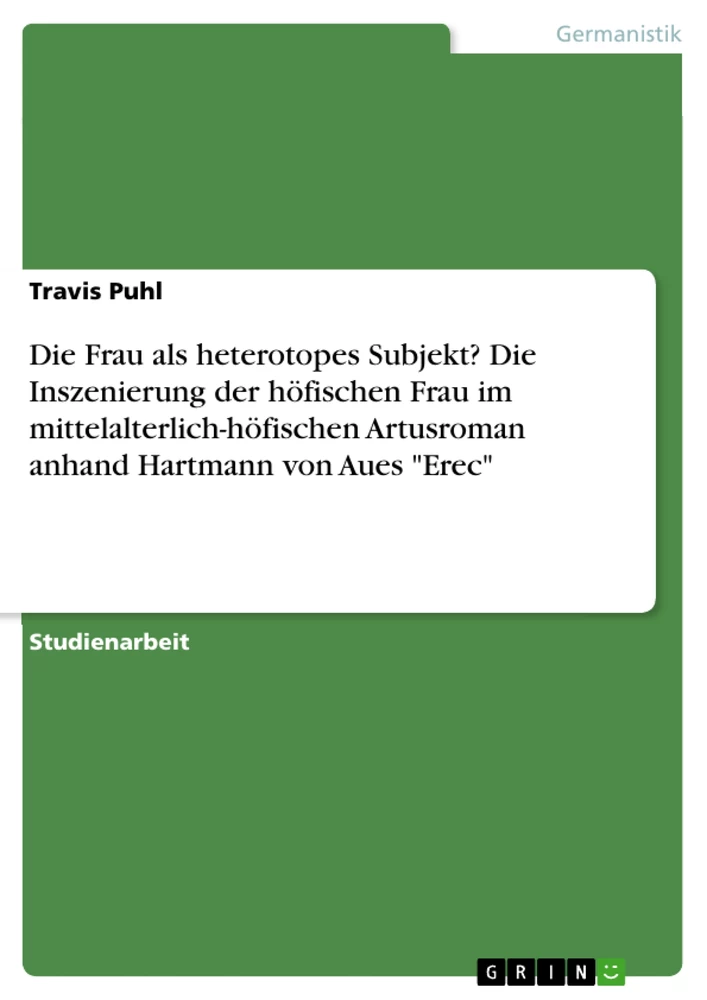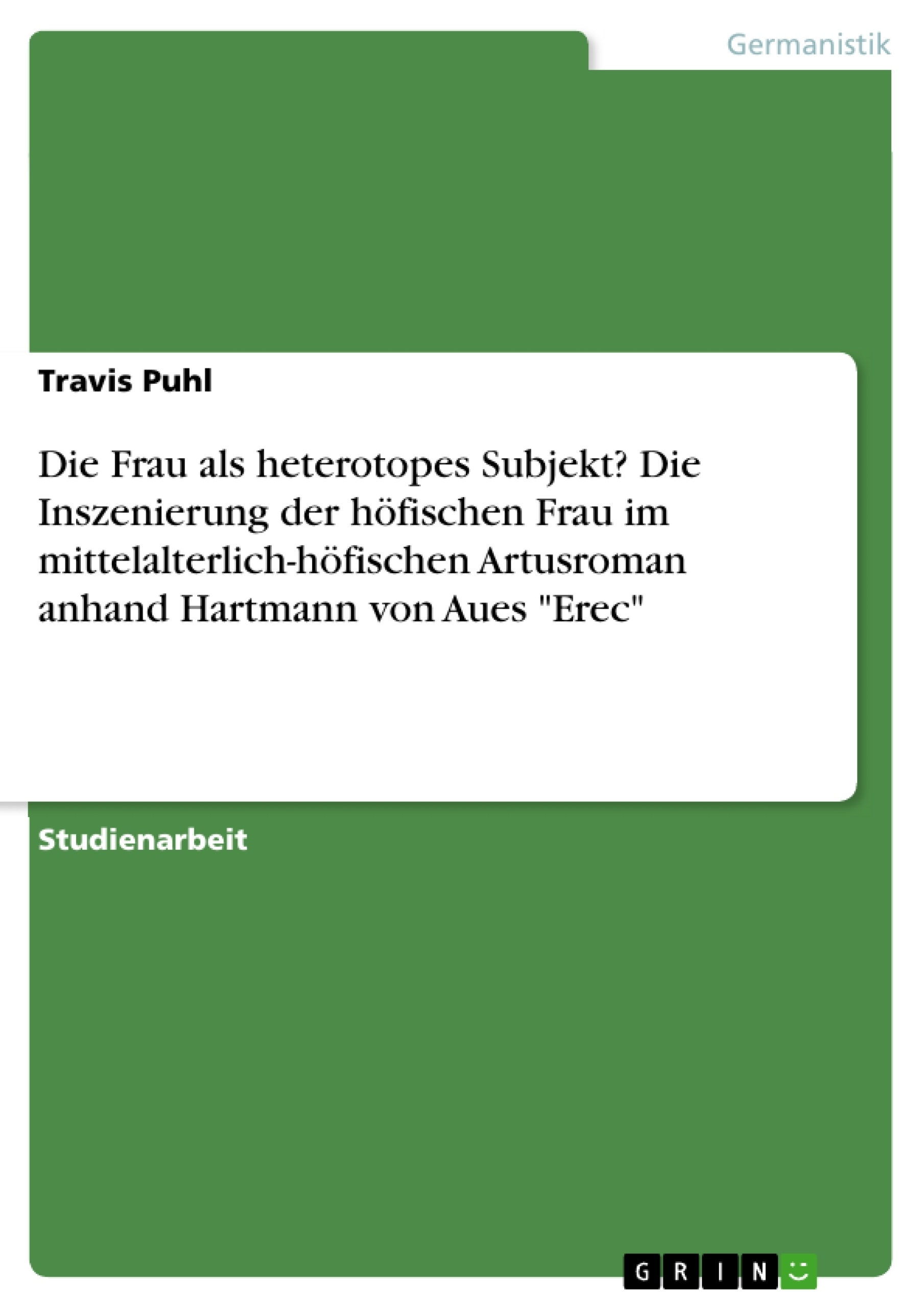Die Frage, was Räume oder was Orte per geisteswissenschaftlicher Definition sind, haben de Certeau und Foucault im vergangenen Jahrhundert erläutert und dargelegt. Ebenso gibt es Geschlechtertheorien für die Literatur des Mittelalters – Lyrik, höfischer Roman, Minnesang etc. pp. Jene Ausarbeitung folgt dem Ziel, zu erforschen, ob es eine Art geschlechterspezifische Raumtheorie gibt, die man für die Literatur des Mittelalters anwenden kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Teil
- Aspekte der Raumgestaltung in der Literatur des Mittelalters
- Die Heterotopie und Raumtheorie nach Foucault und de Certeau
- Raum und Geschlecht: eine Einleitung nach Laetitia Rimpau und Peter Ihring und einem Beispiel von Markus Stock
- Geschlechterkommunikation in mittelalterlicher Literatur nach Rüdiger Schnell
- Praktischer Teil
- Hartmann von Aues Erec unter raum-geschlechtlichen Aspekten
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit setzt sich zum Ziel, die Frau als heterotopes Subjekt in der Literatur des Mittelalters zu untersuchen. Sie analysiert, ob die Frau als "gender-Profil" (Rüdiger Schnell) agiert und dadurch einen eigenen Raum, eine "Heterotopie" (Michel Foucault), in der höfischen Gesellschaft des Mittelalters schafft.
- Raumtheorie und Heterotopie nach Foucault und de Certeau
- Geschlechterkommunikation in der Literatur des Mittelalters
- Die Frau als heterotopes Subjekt
- Die Inszenierung der Frau im höfischen Artusroman
- Analyse von Hartmann von Aues "Erec" unter raum-geschlechtlichen Aspekten
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die Forschungsfrage, ob es eine geschlechterspezifische Raumtheorie für die Literatur des Mittelalters gibt. Sie skizziert den theoretischen und praktischen Teil der Arbeit und erläutert den Ansatz, die Frau als Heterotopie zu betrachten.
- Aspekte der Raumgestaltung in der Literatur des Mittelalters: Dieses Kapitel zeigt anhand von Beispielen aus dem Otnit und den Artusromanen des Pleiers, dass es bereits raumtheoretische Ansätze in der Literatur des Mittelalters gibt. Es werden Aspekte der Raumgestaltung und der „Heterotopie“ (Foucault) in der Literatur des Mittelalters untersucht.
- Die Heterotopie und Raumtheorie nach Foucault und de Certeau: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Es wird die Raumtheorie von Michel Foucault und Michel de Certeau erläutert und deren Relevanz für die Untersuchung von Raum und Geschlecht in der Literatur des Mittelalters erörtert.
- Raum und Geschlecht: eine Einleitung nach Laetitia Rimpau und Peter Ihring und einem Beispiel von Markus Stock: Das Kapitel erweitert die Theorie des Raums und des Geschlechts, indem es die Ansätze von Rimpau, Ihring und Stock einbezieht. Es werden verschiedene Perspektiven auf die Beziehung zwischen Raum und Geschlecht in der Literatur des Mittelalters vorgestellt.
- Geschlechterkommunikation in mittelalterlicher Literatur nach Rüdiger Schnell: Das Kapitel beleuchtet die Geschlechterkommunikation in der Literatur des Mittelalters anhand der Ansätze von Rüdiger Schnell. Es wird gezeigt, wie gender-spezifische Rhetorik die Kommunikation zwischen Mann und Frau im mittelalterlichen höfischen Kontext prägte.
- Hartmann von Aues Erec unter raum-geschlechtlichen Aspekten: Dieses Kapitel befasst sich mit der Analyse von Hartmann von Aues "Erec" unter den theoretischen Gesichtspunkten der vorherigen Kapitel. Es wird untersucht, ob in "Erec" geschlechterspezifische "Un-Orte", also Heterotopien, vorhanden sind, und welche Rolle diese im Kontext der Geschlechterkommunikation und der Inszenierung der Frau im höfischen Raum spielen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema der Heterotopie, Raumtheorie, Geschlechterkommunikation, gender-Profile, höfischer Artusroman, Hartmann von Aues "Erec", mittelalterliche Literatur, Frauenrolle, und Geschlechterrollen in der mittelalterlichen Gesellschaft. Es werden die theoretischen Ansätze von Michel Foucault, Michel de Certeau und Rüdiger Schnell herangezogen, um die Inszenierung der Frau im höfischen Raum des Mittelalters zu analysieren.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein "heterotopes Subjekt" im mittelalterlichen Kontext?
Es beschreibt die Idee, dass Frauen in der höfischen Literatur durch ihr Handeln eigene, abgegrenzte Räume (Heterotopien) innerhalb der männlich dominierten Gesellschaft schaffen.
Welche Raumtheorien werden in der Arbeit herangezogen?
Die Analyse basiert auf den Raumtheorien von Michel Foucault (Heterotopie) und Michel de Certeau sowie auf Geschlechtertheorien von Rüdiger Schnell.
Wie wird Hartmann von Aues "Erec" unter raum-geschlechtlichen Aspekten analysiert?
Die Arbeit untersucht, wie Räume im "Erec" geschlechtsspezifisch kodiert sind und welche Rolle die Kommunikation zwischen Mann und Frau bei der Raumkonstituierung spielt.
Was versteht Rüdiger Schnell unter "gender-Profilen"?
Es bezeichnet die literarische Inszenierung von Geschlechterrollen, die durch spezifische Rhetorik und Verhaltensweisen in der mittelalterlichen Literatur vermittelt werden.
Gibt es im Mittelalter bereits Konzepte von "Un-Orten"?
Ja, die Arbeit zeigt auf, dass literarische Räume im höfischen Roman oft als Gegenorte oder Heterotopien fungieren, die von den geltenden gesellschaftlichen Normen abweichen.
- Quote paper
- Travis Puhl (Author), 2022, Die Frau als heterotopes Subjekt? Die Inszenierung der höfischen Frau im mittelalterlich-höfischen Artusroman anhand Hartmann von Aues "Erec", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1268164