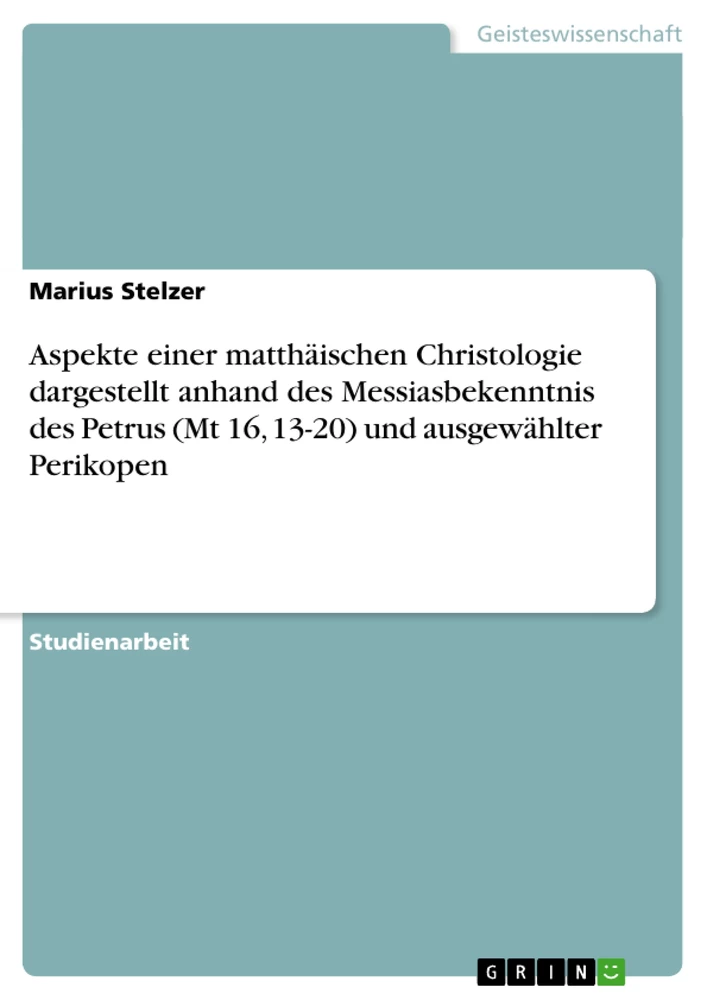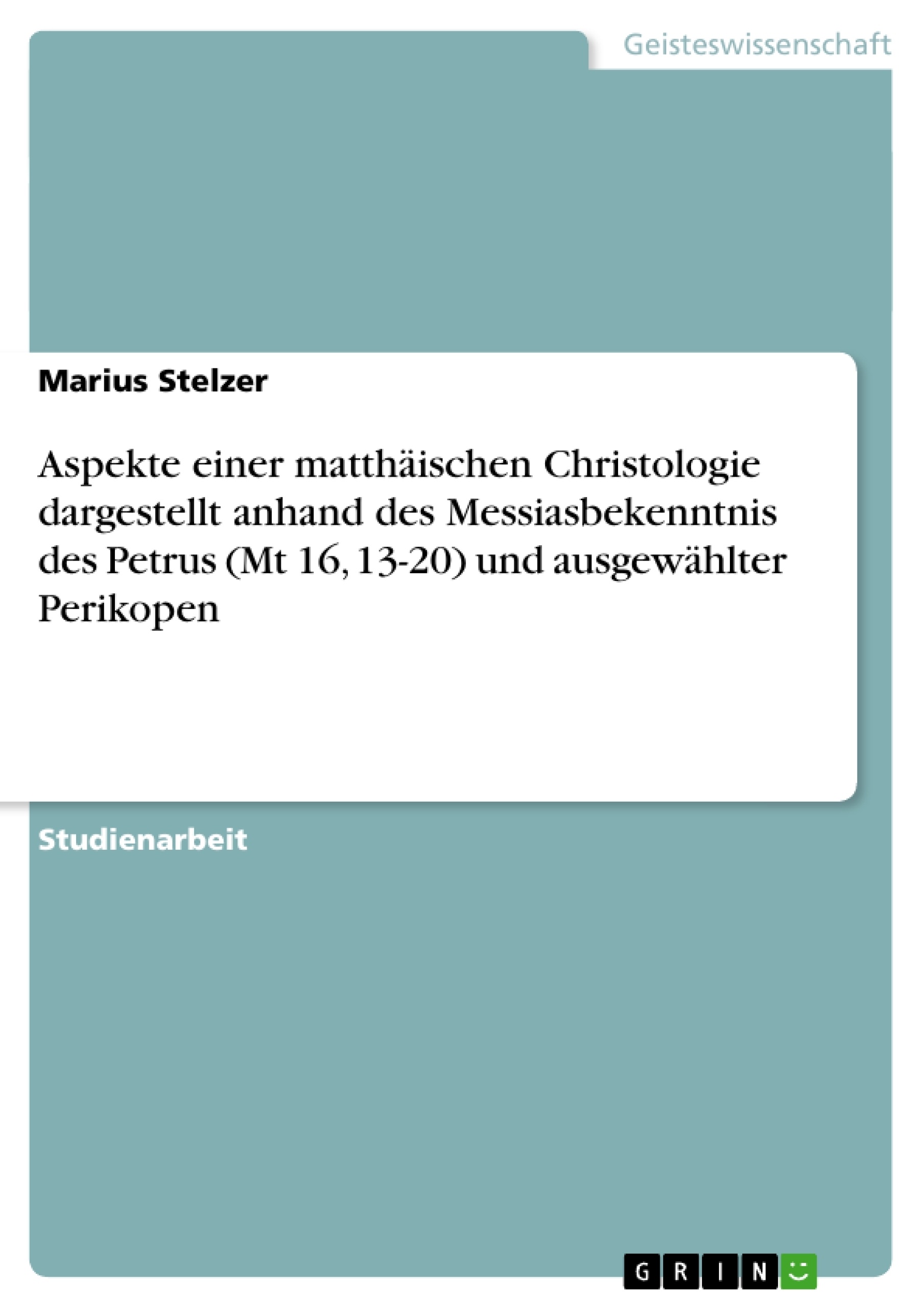„Jesus von Nazaret – Für wen sollen wir ihn halten?“1 Dieser Titel
eines Buches unter einer Fülle weiterer Bücher, die sich mit der
Person „Jesus von Nazaret“ auseinandersetzen, beschreibt
meines Erachtens treffend die momentane Situation des
christologischen Fragens und könnte ebenso die seit zweitausend
Jahren andauernde Auseinandersetzung um die Bedeutung der
Person Jesu Christi betiteln.
Die Meinungen der Exegeten und Fundamentaltheologen zeigen
sich umfassend wie differenziert. Dieser Sachverhalt scheint mir
im „Untersuchungsobjekt“ selbst begründet: KARL-JOSEF KUSCHEL
bringt es in einem Aufsatz in dem o.g. Buch deutlich zum
Ausdruck: „Jesus, ein göttlicher Mensch, ein menschlicher Gott?“2
Schon in den Schriften des NT zeigt sich eine Vielheit
christologischer und theologischer Denkrichtungen, doch nähern
sich sowohl die paulinischen Ansätze als auch die Entwürfe in den
Evangelien dem urchristlichen Kerygma in 1 Kor 15,3-5.
Will man nun „Christologie“ betreiben und einen Quellentext (sei
es nun der Galaterbrief, ein Evangelientext oder ein modernes
Gedicht von DOROTHEE SÖLLE) auf seinen christologischen Ansatz
hin untersuchen, scheint mir als Richtschnur die Frage nach dem
„Wer“ von gundlegender Bedeutung zu sein. Die erste Frage
könnte also lauten: Wer ist Jesus von Nazaret?
Ziel dieser Arbeit soll es sein, eine mögliche Antwort aus
matthäischer Sicht zu formulieren. Dabei dient das
Messiasbekenntnis des Petrus (Mt 16,13-20) als „Aufhänger“,
welches in seiner Struktur und Aussage bearbeitet werden soll.
Anhand weiterer Perikopen sowohl alt- als auch neutestamentlich
soll diese Textstelle auf ihren Gehalt und ihren Stellenwert
innerhalb des MtEv. näher untersucht werden. Unterstützend
werden Kommentare zum MtEv. hinzugezogen. Die Arbeit soll ihren Abschluß in der Darstellung möglicher
Konsequenzen für die heutige pastorale Praxis finden.
1HOHN-KEMLER, L. (Hrsg), Jesus von Nazaret – Für wen sollen wir ihn halten?,
Herder Sonderband, Freiburg 1997
2 Ebd. S. 14
Inhaltsverzeichnis
- Hinführung
- Aspekte einer matthäischen Christologie
- Formale Kriterien des Matthäusevangeliums
- Text: Matthäus Kapitel 16, Verse 13-20
- Textverständnis
- Syntaktische Analyse
- Semantische Analyse
- Zusammenfassung
- Konsequenzen für die Praxis pastoralen Handelns
- Literaturübersicht
- Abkürzungsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der matthäischen Christologie und untersucht das Messiasbekenntnis des Petrus (Mt 16,13-20) als zentralen Bezugspunkt. Ziel ist es, die christologische Sichtweise des Matthäusevangeliums anhand dieser Textstelle zu beleuchten und ihre Relevanz für die heutige pastorale Praxis zu erörtern.
- Die Interpretation des Petrusbekenntnisses im Kontext des Matthäusevangeliums
- Die Bedeutung des Begriffs "Christus" im Matthäusevangelium
- Die Rolle des Petrus in der matthäischen Christologie
- Die Konsequenzen des Petrusbekenntnisses für das pastorale Handeln
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel führt in die Thematik ein und verdeutlicht die aktuelle Relevanz des christologischen Fragens. Es wird die Vielheit christologischer Denkrichtungen im Neuen Testament beleuchtet und die zentrale Frage nach dem "Wer" von Jesus von Nazaret gestellt.
- Im zweiten Kapitel werden die formalen Kriterien des Matthäusevangeliums analysiert und der Text des Petrusbekenntnisses (Mt 16,13-20) vorgestellt. Es erfolgt eine syntaktische und semantische Analyse der Textstelle.
Schlüsselwörter
Matthäusevangelium, Christologie, Petrusbekenntnis, Messias, Kirche, pastorales Handeln, Textanalyse, Synoptische Evangelien, urchristliches Kerygma.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das zentrale Thema von Matthäus 16, 13-20?
Zentrales Thema ist das Messiasbekenntnis des Petrus, in dem er Jesus als den Christus, den Sohn des lebendigen Gottes, identifiziert.
Welche Rolle spielt Petrus in dieser Textstelle?
Petrus wird als Fundament der Kirche („Fels“) dargestellt, dem die Schlüssel des Himmelreichs und eine besondere Vollmacht übertragen werden.
Was bedeutet der Begriff „Christus“ im Matthäusevangelium?
Der Begriff bezeichnet den gesalbten Retter und Messias, wobei Matthäus besonders die Erfüllung alttestamentlicher Verheißungen betont.
Welche Analysemethoden werden in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit nutzt syntaktische und semantische Analysen, um das Textverständnis von Mt 16, 13-20 zu vertiefen.
Welche Konsequenzen ergeben sich für die pastorale Praxis?
Die Arbeit leitet aus der matthäischen Christologie Impulse für das heutige kirchliche Handeln und das Amtsverständnis ab.
Was ist das „urchristliche Kerygma“ in diesem Kontext?
Es bezeichnet die zentrale Glaubensverkündigung der frühen Christenheit über den Tod und die Auferstehung Jesu Christi.
- Arbeit zitieren
- Marius Stelzer (Autor:in), 1999, Aspekte einer matthäischen Christologie dargestellt anhand des Messiasbekenntnis des Petrus (Mt 16, 13-20) und ausgewählter Perikopen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/12684