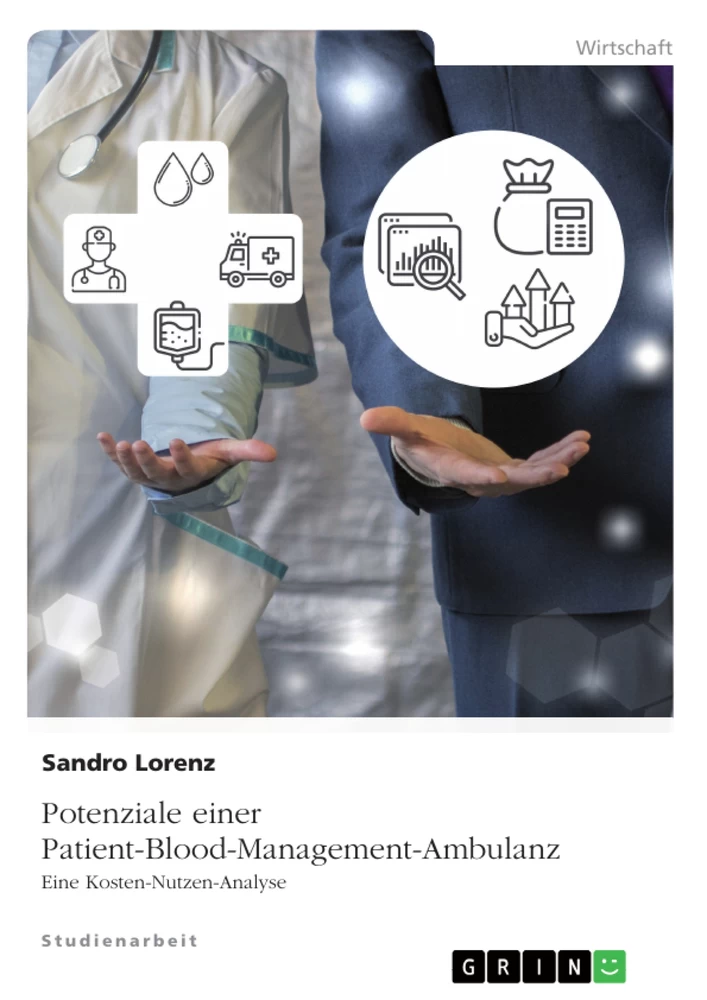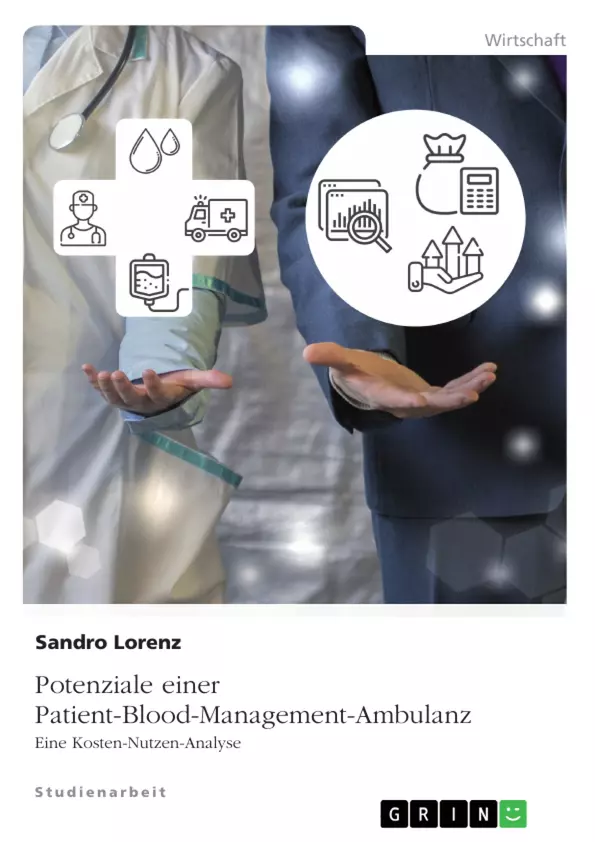Die vorliegende Studienarbeit soll klären, inwieweit die Etablierung einer Patient-Blood-Management-Ambulanz am Universitätsklinikum Wuppertal die Zahl der verabreichten Erythrozytenkonzentrate reduzieren kann und zusätzlich das Potenzial hat, die Patientenversorgung und Patientensicherheit, in Bezug auf transfusions-assoziierte Morbidität und Mortalität, zu verbessern. Zusätzlich sollen, aus gesundheitsökonomischer Sicht, die Kosten eines solchen Vorhabens näher beleuchtet und in Beziehung zu dem Nutzen gesetzt werden.
Das wichtigste Problem bei der Gabe von Fremdblutkomponenten war viele Jahre die Gefahr der transfusions-assoziierten Infektion mit z. B. Hepatis B, C oder HIV. Durch eine deutlich verbesserte Diagnostik und einen optimierten Herstellungsprozess ist dieses Risiko mittlerweile kleiner als 1:1 Million und daher nahezu nicht mehr relevant. Viel mehr im Fokus sind die immunologischen Auswirken nach erfolgter Transfusion mit Fremdblutprodukten gerückt. Es hat geradezu ein Paradigmenwechsel stattgefunden von der ursprünglich als heilbringend und lebensrettend empfunden Bluttransfusion, die sowohl die Sauerstoffversorgung des Gewebes und eine kardiovaskuläre Stabilisierung bewirkt, hin zu einer immunkompromittierenden Transplantation von einem ‚Fremdorgan‘ und negativen Folgen für die Immunkompetenz.
Aus diesem Grunde scheint die Transfusion von allogenen Erythrozyten auch negative Auswirkungen auf die Morbidität und Mortalität und damit auch auf konsekutive Parameter wie die Krankenhausverweildauer und Behandlungskosten zu haben. Aus diesem Grunde hat sich das Patient Blood Management (PBM), auch in Deutschland, seit 2013/2014 erstmals in Forschung und Klinik etabliert, mit dem zugrundeliegenden Verständnis, die Transfusion von allogenen Blutprodukten so gering wie möglich zu halten, um positive Effekte auf Morbidität/Mortalität, Kosten und die effiziente Ressourcennutzung, bei limitiertem Angebot, zu erreichen.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Abkürzungsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- I. Einleitung
- 1. Ausgangslage
- 2. Ziele
- 3. Gliederung
- II. Hintergrund
- 4. Patient Blood Management - Allgemeine Betrachtung
- 5. Patient Blood Management – Morbidität und Mortalität
- 6. Patient Blood Management - Kosten
- III. Empirische Studie
- 7. Simulation Etablierung PBM-Konzept am Universitätsklinikum Wuppertal
- 8. Ergebnisse
- IV. Zusammenfassung
- 9. Diskussion
- V. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Studienarbeit befasst sich mit der Etablierung einer Patient Blood Management-Ambulanz und untersucht deren Kosten-Nutzen-Verhältnis. Sie analysiert das Konzept des Patient Blood Management (PBM) und seine Auswirkungen auf Morbidität, Mortalität und Kosten im Gesundheitswesen. Die Arbeit zielt darauf ab, die Potenziale und Herausforderungen bei der Implementierung eines PBM-Konzepts in der Praxis aufzuzeigen und die Kostenentwicklung in diesem Zusammenhang zu simulieren.
- Patient Blood Management als innovativer Ansatz zur Reduktion von Fremdbluttransfusionen
- Bedeutung von PBM für Morbidität und Mortalität von Patienten
- Kostenanalyse von PBM im Vergleich zu herkömmlichen Behandlungsmethoden
- Empirische Untersuchung der Etablierung eines PBM-Konzepts
- Diskussion der Herausforderungen und Potenziale von PBM in der Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel I: Einleitung Dieses Kapitel legt den Grundstein für die Arbeit und führt in das Thema Patient Blood Management ein. Es erläutert die Ausgangslage und die Ziele der Studienarbeit sowie die Gliederung des Textes.
- Kapitel II: Hintergrund In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen des Patient Blood Management vorgestellt. Es werden die allgemeinen Aspekte des Konzepts sowie die Auswirkungen auf Morbidität, Mortalität und Kosten beleuchtet.
- Kapitel III: Empirische Studie Hier wird eine Simulation zur Etablierung eines PBM-Konzepts am Universitätsklinikum Wuppertal durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Simulation werden dargestellt und analysiert.
Schlüsselwörter
Patient Blood Management, Fremdbluttransfusion, Morbidität, Mortalität, Kosten, Kosten-Nutzen-Analyse, Simulation, Universitätsklinikum Wuppertal, Erythrozytenkonzentrate, Krankenhausverweildauer, Wundinfektionsrate.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Patient Blood Management (PBM)?
PBM ist ein multidisziplinäres Konzept, das darauf abzielt, die Transfusion von Fremdblutprodukten zu minimieren und stattdessen die körpereigenen Blutressourcen des Patienten zu schonen.
Warum ist die Gabe von Fremdblut heute kritischer zu sehen?
Neben Infektionsrisiken stehen heute immunologische Auswirkungen im Fokus, die Morbidität und Mortalität sowie die Krankenhausverweildauer negativ beeinflussen können.
Welchen Nutzen hat eine PBM-Ambulanz?
Sie kann die Patientensicherheit erhöhen, Transfusionsrisiken senken und durch effizientere Ressourcennutzung Behandlungskosten im Krankenhaus reduzieren.
Wie wirkt sich PBM auf die Krankenhausverweildauer aus?
Studien deuten darauf hin, dass Patienten durch PBM weniger Komplikationen erleiden und somit die Dauer des stationären Aufenthalts verkürzt werden kann.
Was war das Ergebnis der Simulation am Universitätsklinikum Wuppertal?
Die Simulation untersuchte das Potenzial zur Reduktion von Erythrozytenkonzentraten und die damit verbundenen gesundheitsökonomischen Vorteile.
- Citar trabajo
- Dr. med. Sandro Lorenz (Autor), 2020, Potenziale einer Patient-Blood-Management-Ambulanz. Eine Kosten-Nutzen-Analyse, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1268682