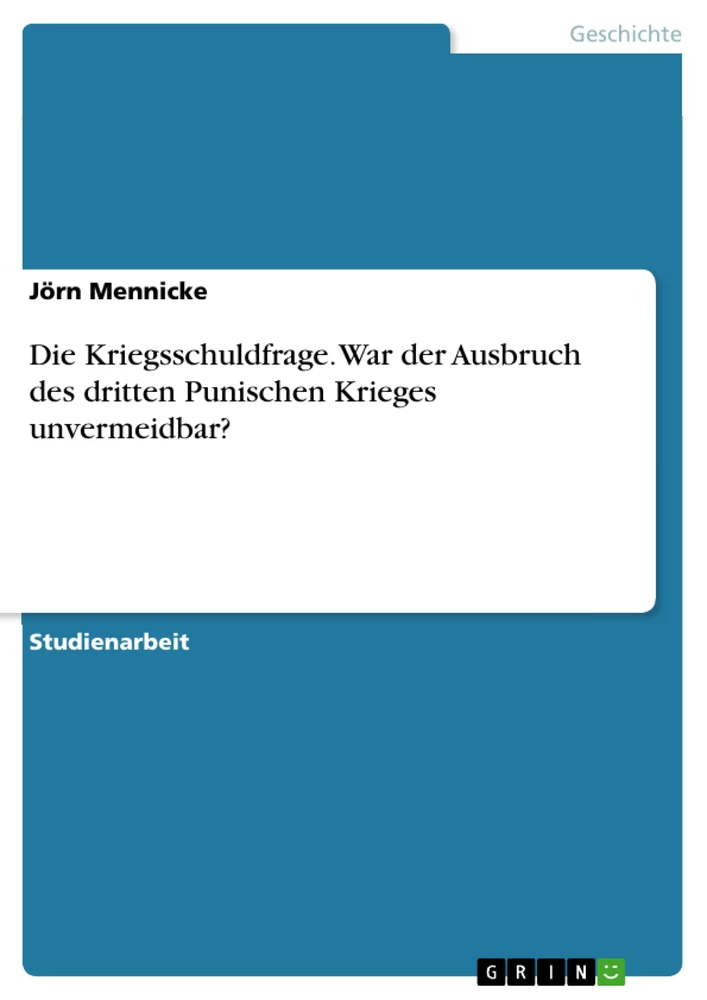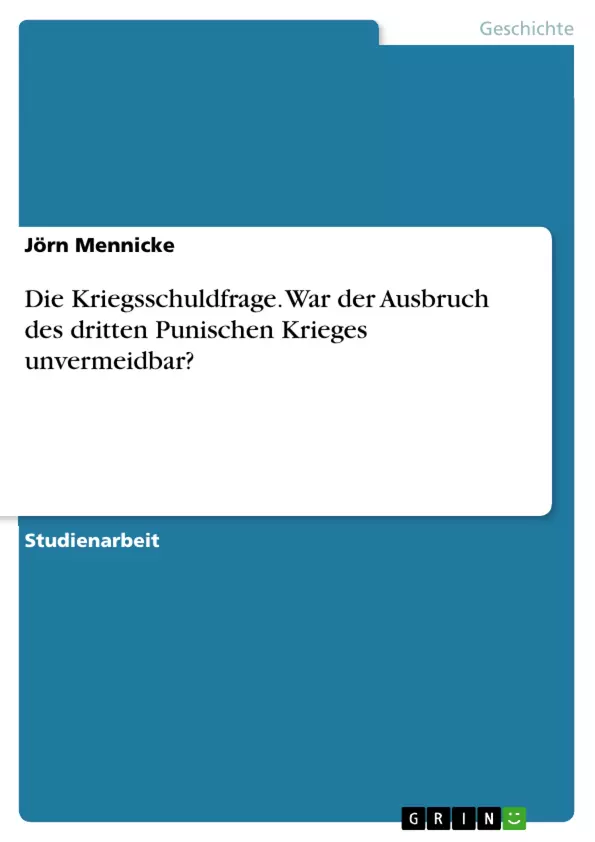Im Rahmen dieser Hausarbeit wird versucht, zu erklären, wie es zum dritten Punischen Krieg und dem Ende Karthagos kam. Dazu werden zunächst kurz die chronologisch naheliegendsten Ereignisse dargelegt, bevor zu dem Friedensvertrag 201v.Chr. übergegangen wird. Er ist der Knackpunkt, in dem die Römer den Anlass für die Kriegserklärung an Karthago sehen. Daraufhin wirft der Autor seinen Blick etwas genauer auf die Zwischenzeit des Zweiten und Dritten Punischen Krieges. Dabei liegen seine Schwerpunkte auf den Zuständen in Nordafrika und dem römischen Senat sowie deren Beweggründe für die Zerstörung Karthagos. Für seine Betrachtung stützt sich der Autor mit Ausnahme der Lektüre größtenteils auf Polybios und Livius. Polybios zählt dabei als der verlässlichste, weil er die letzten Schlachten Karthagos miterlebte. Schlussendlich wird sich mit der Frage befasst, ob der dritte punische Krieg vermeidbar war, oder ob ein Anteilhaber den Krieg als Notwendigkeit ansah.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Erbfeind Roms
- Der Friedensvertrag 201 v.Chr.
- Die Zeit zwischen den Kriegen
- Die Zustände in Nordafrika
- Der Senat Roms
- Casus belli
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Frage, wie es zum dritten Punischen Krieg und dem Ende Karthagos kam. Im Fokus steht dabei die Analyse der Ereignisse, die zum Konflikt führten, insbesondere die Rolle des Friedensvertrags von 201 v.Chr. und die Entwicklungen in der Zeit zwischen dem zweiten und dritten Punischen Krieg. Die Arbeit untersucht die Zustände in Nordafrika und die Beweggründe des römischen Senats, um die Ursachen für die Zerstörung Karthagos zu ergründen.
- Der Friedensvertrag 201 v.Chr. als entscheidender Wendepunkt
- Die politische und soziale Lage in Nordafrika nach dem zweiten Punischen Krieg
- Die Rolle des römischen Senats in der Entscheidung für den Krieg gegen Karthago
- Die Kriegsschuldfrage und die Analyse der Kriegserklärung an Karthago
- Die Ursachen für das Ende der karthagischen Staatsmacht
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die These auf, dass es keine eindeutige Antwort auf die Frage nach der Kriegsschuld im dritten Punischen Krieg gibt. Sie skizziert die Forschungsfrage und das Vorgehen der Arbeit, das sich auf die Analyse der chronologischen Ereignisse konzentriert, insbesondere auf den Friedensvertrag 201 v.Chr. und die Zeit zwischen den Kriegen.
Der Erbfeind Roms
Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung der Feindschaft zwischen Rom und Karthago und schildert die wichtigsten Ereignisse der beiden ersten Punischen Kriege. Der Fokus liegt dabei auf den politischen und militärischen Aspekten der Konflikte.
Der Friedensvertrag 201 v.Chr.
Dieser Abschnitt untersucht den Friedensvertrag, der nach der Schlacht von Zama 202 v.Chr. geschlossen wurde. Es werden die Bedingungen des Vertrags und die unterschiedlichen Perspektiven der beteiligten Parteien beleuchtet.
Die Zeit zwischen den Kriegen
Hier werden die Zustände in Nordafrika nach dem zweiten Punischen Krieg und die Rolle des römischen Senats in der politischen und militärischen Entwicklung analysiert.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen und Konzepte der Arbeit sind der dritte Punische Krieg, die Kriegsschuldfrage, Karthago, Rom, der Friedensvertrag 201 v.Chr., die politische und soziale Situation in Nordafrika, der Einfluss des römischen Senats, und die Analyse der Ursachen für das Ende der karthagischen Staatsmacht.
Häufig gestellte Fragen
Was war der Auslöser für den Dritten Punischen Krieg?
Der formale Anlass war der Bruch des Friedensvertrags von 201 v. Chr. durch Karthago, als es sich ohne römische Erlaubnis gegen numidische Angriffe verteidigte.
War der Krieg gegen Karthago unvermeidbar?
Die Arbeit untersucht, ob der Krieg eine Notwendigkeit für Rom war oder ob wirtschaftliche Interessen und der Wunsch nach totaler Vernichtung des Erbfeinds überwogen.
Welche Rolle spielte der römische Senat?
Innerhalb des Senats gab es starke Bestrebungen (berühmt durch Cato den Älteren), Karthago endgültig zu zerstören, um die römische Vorherrschaft im Mittelmeer abzusichern.
Wer sind die wichtigsten historischen Quellen für diesen Konflikt?
Die Analyse stützt sich vor allem auf Polybios, der als Augenzeuge der letzten Schlachten gilt, sowie auf die Schriften von Livius.
Wie endete der Dritte Punische Krieg?
Der Krieg endete 146 v. Chr. mit der vollständigen Zerstörung Karthagos und der Eingliederung seines Territoriums als römische Provinz Africa.
- Arbeit zitieren
- Jörn Mennicke (Autor:in), 2019, Die Kriegsschuldfrage. War der Ausbruch des dritten Punischen Krieges unvermeidbar?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1268736