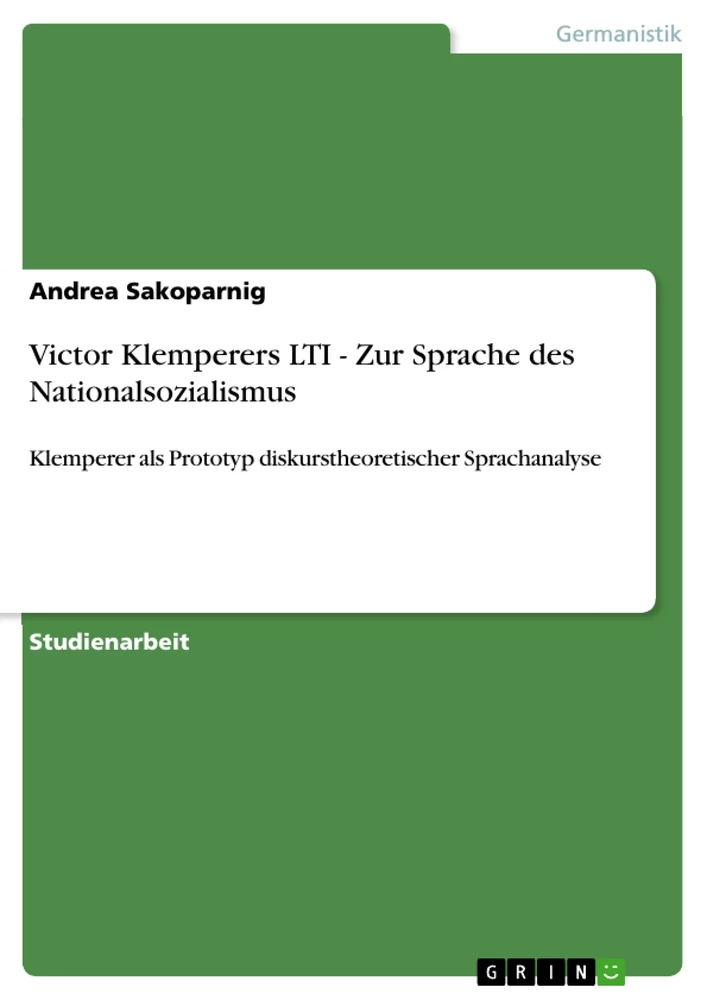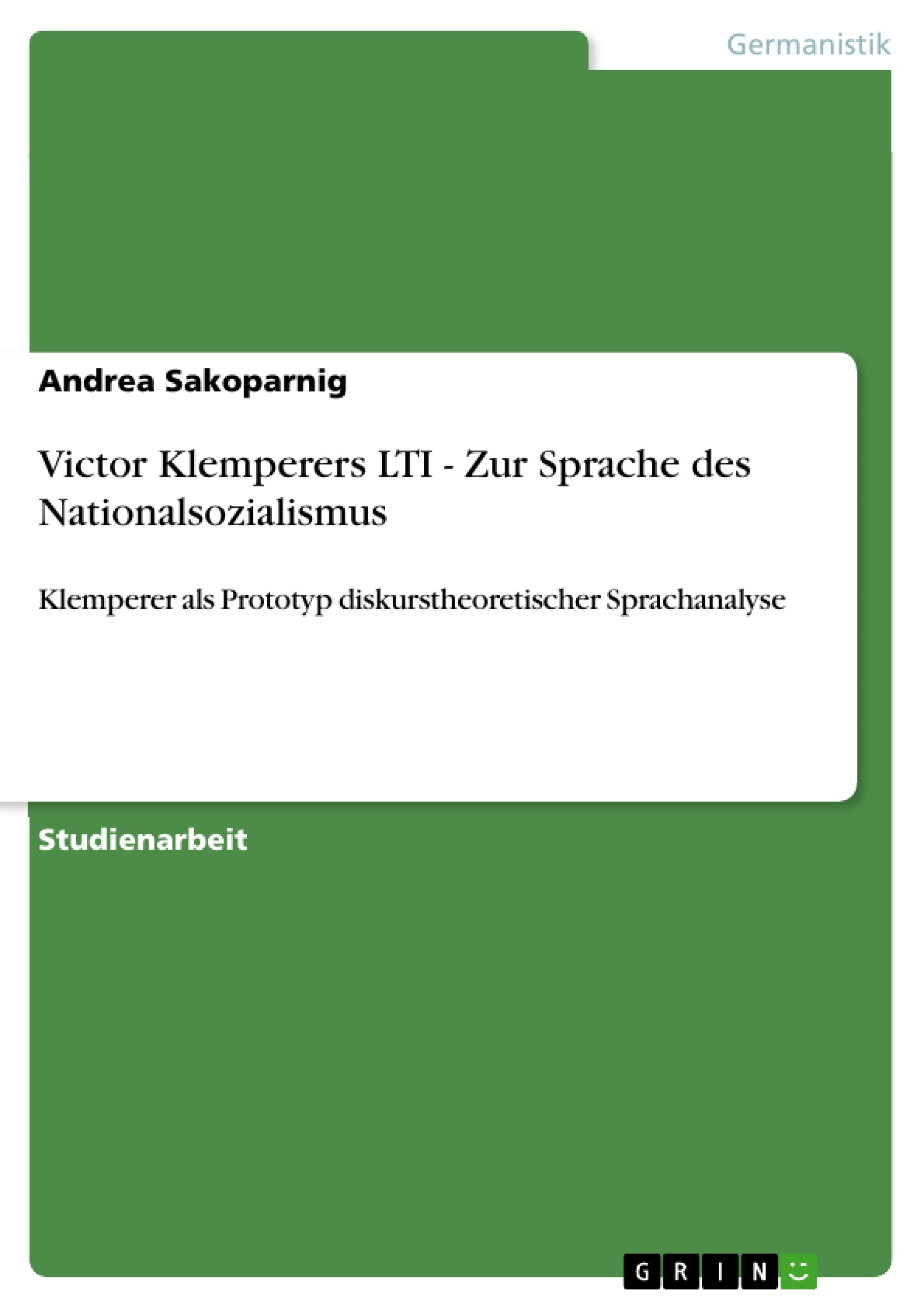Victor Klemperers „LTI- Notizbuch eines Philologen“ bringt den Interpreten in eine gewisse Verlegenheit. Einerseits ist dieser Text eines der ersten Zeugnisse der Sprache des Nationalsozialismus- also nicht übergehbar -, andererseits stellt die Bestimmung der Textsorte und der Methodik vor nicht allzu geringe Schwierigkeiten- ist also kaum ‚angehbar’. Ob dieser Schwierigkeiten blieb die wissenschaftliche Behandlung des Textes lange Zeit aus bzw. unzureichend. Die „LTI“ blieben, obwohl einer der grundlegendsten in der Zeit des Nationalsozialismus verfassten Texte über die Sprache des Nationalsozialismus- also unmittelbares Zeugnis „erlebter Sprache“ - lange unbeachtet.
Die „LTI“ ist aber nicht nur Zeugnis der Sprache des Nationalsozialismus, sondern auch Zeugnis des Ringens eines Philologen um die adäquate Darstellung einer Sprachgeschichte, die zugleich Geistes- und Kulturgeschichte zu sein beansprucht. Klemperer sieht sich durch die Aufgabe, das Phänomen „LTI“ zu beschreiben, vor ungeahnte wissenschaftliche Probleme gestellt, denen er nur mit Mühe begegnen kann.
Beachtlich ist, dass er, wenn auch ‚nur’ intuitiv, viele sprachliche Phänomene erfasst und gut beschreibt, obwohl es ihm am methodischen und theoretischen Rüstzeug, zum Teil aus wissenschaftshistorischen, zum Teil aus persönlichen Gründen, gebricht. Das macht ihn bzw. seinen Text gerade heute für eine linguistische Untersuchung so spannend.
Nachdem zunächst ein kurzer Überblick über die Entstehungs- und Veröffentlichungsbedingungen, den Aufbau und den Inhalt der „LTI“ gegeben wird, soll etwas ausführlicher auf die Problematik der Bestimmung der Textsorte und der wissenschaftlichen Methodik Klemperers eingegangen werden, um zuletzt auf dessen Sprachauffassung, die sich in der „LTI“ offenbart, einzugehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entstehung und Intention
- Entstehungsgeschichte
- Intention der „LTI“
- Aufbau
- Inhalt
- Bestimmung der Textsorte
- Rezeption in der Linguistik
- Klemperers „in lingua veritas“ - Sprachauffassung
- Klemperer als Vertreter einer idealistischen Sprachauffassung?
- Klemperer als Vorläufer einer diskurstheoretisch geprägten Sprachauffassung und Methodik?
- Zur Methode
- Schluss
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert Victor Klemperers „LTI - Notizbuch eines Philologen“ und untersucht die Entstehung, den Aufbau, die Textsorte und die Sprachauffassung des Werks. Der Fokus liegt auf der Frage, wie Klemperer die Sprache des Nationalsozialismus analysiert und welche methodischen und theoretischen Ansätze er dabei verfolgt.
- Entstehung und Intention der „LTI“
- Bestimmung der Textsorte und Methodik
- Klemperers Sprachauffassung
- Die „erlebte Sprache“ als Gegenstand der Analyse
- Die Rezeption der „LTI“ in der Linguistik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die „LTI“ als ein wichtiges Zeugnis der Sprache des Nationalsozialismus vor und beleuchtet die Schwierigkeiten, die sich bei der Bestimmung der Textsorte und der Methodik des Werks ergeben. Die Entstehung und Intention der „LTI“ werden im zweiten Kapitel behandelt. Klemperer sammelte über 14 Jahre hinweg Sprachmaterial, das er in seinen Tagebuchaufzeichnungen festhielt. Die Arbeit an den Tagebüchern, die die Textgrundlage für die „LTI“ bilden, wird in zwei Phasen unterteilt: die erste Phase erstreckt sich über die gesamte NS-Herrschaft (1933-45), die zweite Phase umfasst die Zeit nach dem Krieg, in der Klemperer seine Tagebuchaufzeichnungen zu einer Studie umarbeitete. Klemperer verfolgte mit seinen Beobachtungen der Sprache des Nationalsozialismus ein persönliches Anliegen, das sich in seinen Tagebuchaufzeichnungen als „stiller Widerstand“ gegen die Diktatur manifestierte.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Victor Klemperer, „LTI - Notizbuch eines Philologen“, Sprache des Nationalsozialismus, Textsorte, Methodik, Sprachauffassung, „erlebte Sprache“, Linguistik, Rezeption.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Victor Klemperers „LTI“?
„LTI – Lingua Tertii Imperii“ ist das Notizbuch eines Philologen, in dem Klemperer die Sprache des Nationalsozialismus während seiner Zeit im Untergrund und im „Judenhaus“ analysierte.
Was bedeutet Klemperers Grundsatz „in lingua veritas“?
„In der Sprache liegt die Wahrheit“ – Klemperer war überzeugt, dass die Sprache die wahren Denkweisen und die Unmenschlichkeit eines Systems offenbart, oft unbewusst.
Warum ist die Bestimmung der Textsorte der LTI schwierig?
Das Werk ist eine Mischung aus persönlichem Tagebuch, wissenschaftlicher Philologie, Zeitzeugnis und stiller Widerstandschronik.
Wie entstand das Sprachmaterial für die LTI?
Klemperer sammelte über 14 Jahre hinweg (1933–1945) heimlich Beobachtungen zu Begriffen, Redewendungen und der Rhetorik der Nationalsozialisten.
Welche Rolle spielt Klemperer in der modernen Linguistik?
Obwohl ihm teils das methodische Rüstzeug fehlte, gilt er als Vorläufer diskurstheoretischer Sprachanalyse, da er intuitiv die Macht der Sprache über das Denken erfasste.
- Quote paper
- Andrea Sakoparnig (Author), 2008, Victor Klemperers LTI - Zur Sprache des Nationalsozialismus , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/126929