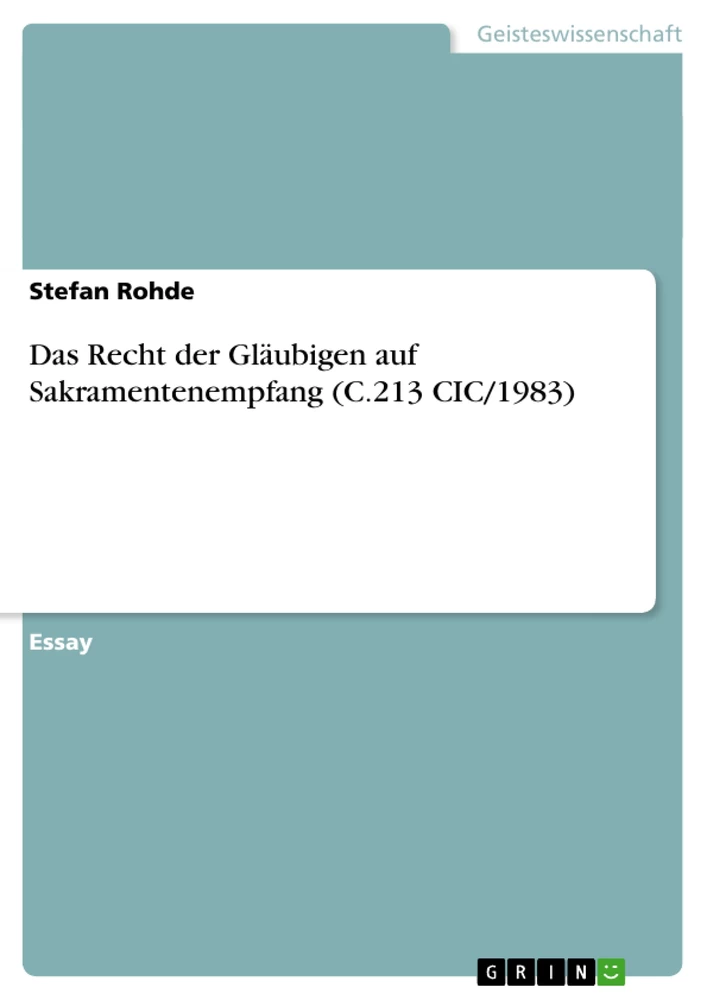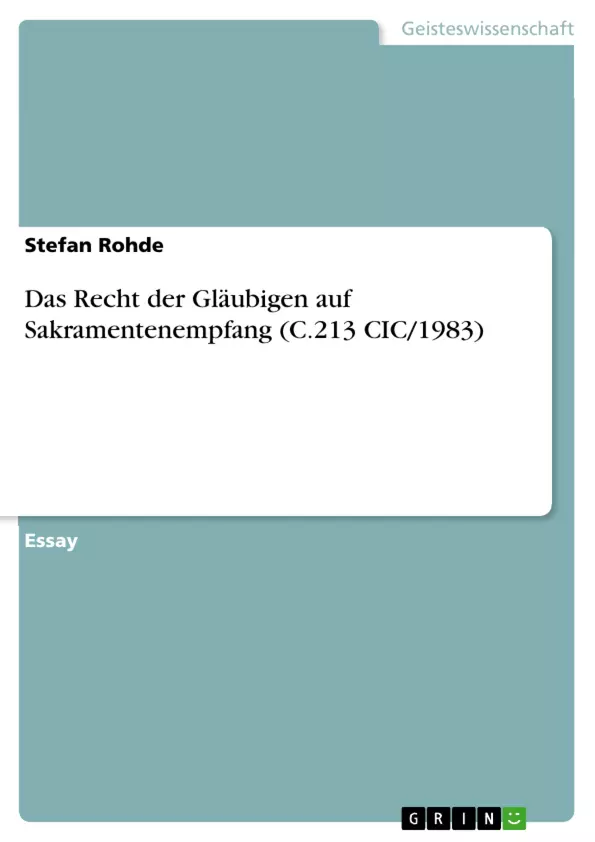Sakramente beschäftigen die katholische Kirche schon von Beginn an. So sieht Augustinus die Sakramente als „Gattung jener sichtbare[r] Zeichen, die von sich aus anderes erkennen lassen als ihre äußere Erscheinung anzeigt.“
Sakramente funktionieren hier „ex opere operato“, also unabhängig von der sittlichen Einstellung des Spenders.
Im II. Vatikanum wird in der Schrift „Lumen Gentium“ die Wichtigkeit der Spendung und des Empfangs von Sakramenten hervorgehoben:
„In jenem Leibe [gemeint: die Kirche) strömt Christi Leben auf die Gläubigen über, die durch die Sakramente auf geheimnisvolle und doch wirkliche Weise mit Christus, der gelitten hat und verherrlicht ist, vereint werden.“
Allerdings stellt sich angesichts der schwindenden religiösen Erziehung und daraus folgend der „rückläufigen Zahl des Kirchbesuches“ vehement die Frage, ob der Bitte der Gläubigen auf Sakramentenempfang in jedem Falle gefolgt werden müsse. Welche Vorraussetzungen sind notwendig um gültigen Empfang zu gewährleisten? Unter welchen Umständen darf und muss die Sendung kirchenrechtlich verweigert werden?
Ausgehend vom Canon 213 des Codex Iuris Canonici von 1983 beschäftigt sich die vorliegende Arbeit mit Fragestellungen dieser Art.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Umschreibung: Das Recht der Gläubigen auf Sakramentenempfang
- Das Recht auf Taufe
- Das Recht auf Eucharistie
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Recht der Gläubigen auf Sakramentenempfang in der katholischen Kirche. Sie untersucht die Voraussetzungen für einen gültigen Empfang der Sakramente und die Umstände, unter denen die Spendung kirchenrechtlich verweigert werden darf oder muss. Der Fokus liegt dabei auf den Kanones des Codex Iuris Canonici von 1983, insbesondere auf Canon 213.
- Das Recht der Gläubigen auf geistliche Güter der Kirche, insbesondere Sakramente
- Die Voraussetzungen für einen gültigen Empfang der Sakramente
- Die Pflicht der Kirche zur Schaffung der Voraussetzungen für den Empfang der Sakramente
- Die Eigenverantwortung der Gläubigen im Bezug auf den Empfang der Sakramente
- Die Rolle der kirchlichen Amtsträger bei der Spendung der Sakramente
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Bedeutung der Sakramente in der katholischen Kirche und stellt die Frage nach der Notwendigkeit des Sakramentenempfangs in Zeiten schwindender religiöser Erziehung. Sie führt die zentralen Fragestellungen der Arbeit ein, die sich mit den Voraussetzungen für einen gültigen Empfang der Sakramente und den möglichen Gründen für eine Verweigerung der Spendung befassen.
Das Kapitel "Umschreibung: Das Recht der Gläubigen auf Sakramentenempfang" erläutert den Kanon 213 des Codex Iuris Canonici von 1983, der das Recht der Gläubigen auf geistliche Güter der Kirche, insbesondere Sakramente, festschreibt. Es wird die Wechselbeziehung von Rechten und Pflichten der Gläubigen im Bezug auf den Sakramentenempfang beleuchtet, wobei die Taufe als Grundlage für den Empfang der übrigen Sakramente hervorgehoben wird. Zudem wird die Pflicht der Eltern, ihre Kinder zu den Sakramenten zu führen, betont.
Das Kapitel "Das Recht auf Taufe" behandelt die Taufe als Sakrament, das den Eintritt in das Christentum ermöglicht. Es wird die Heilsnotwendigkeit der Taufe und der Taufauftrag Jesu an seine Jünger als Grundlage für das Recht auf Taufe dargestellt. Die Voraussetzungen für den Empfang der Taufe durch Erwachsene werden erläutert, wobei die Bedeutung der Glaubensunterweisung und der Erprobung im christlichen Leben hervorgehoben wird.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt Canon 213 des CIC/1983?
Canon 213 legt fest, dass die Gläubigen das Recht haben, aus den geistlichen Gütern der Kirche, insbesondere dem Wort Gottes und den Sakramenten, Hilfe von den Hirten zu empfangen.
Unter welchen Umständen darf ein Sakrament verweigert werden?
Eine Verweigerung ist kirchenrechtlich nur zulässig, wenn die notwendigen Voraussetzungen (z. B. fehlender Glaube, schwere Sünde oder mangelnde Vorbereitung) nicht erfüllt sind.
Was ist die Voraussetzung für den Empfang der Eucharistie?
Grundvoraussetzung ist die Taufe sowie der Stand der Gnade und eine angemessene Vorbereitung bzw. das Verständnis des Sakraments.
Welche Pflicht haben Eltern beim Sakramentenempfang ihrer Kinder?
Eltern haben die Pflicht und das Recht, ihre Kinder zur christlichen Erziehung und damit auch zum rechtzeitigen Empfang der Sakramente (Taufe, Erstkommunion) zu führen.
Was bedeutet „ex opere operato“?
Es bedeutet, dass ein Sakrament durch den vollzogenen Ritus wirkt, unabhängig von der persönlichen Heiligkeit des Spenders, sofern dieser die Absicht der Kirche teilt.
- Arbeit zitieren
- Stefan Rohde (Autor:in), 2008, Das Recht der Gläubigen auf Sakramentenempfang (C.213 CIC/1983), München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/126965