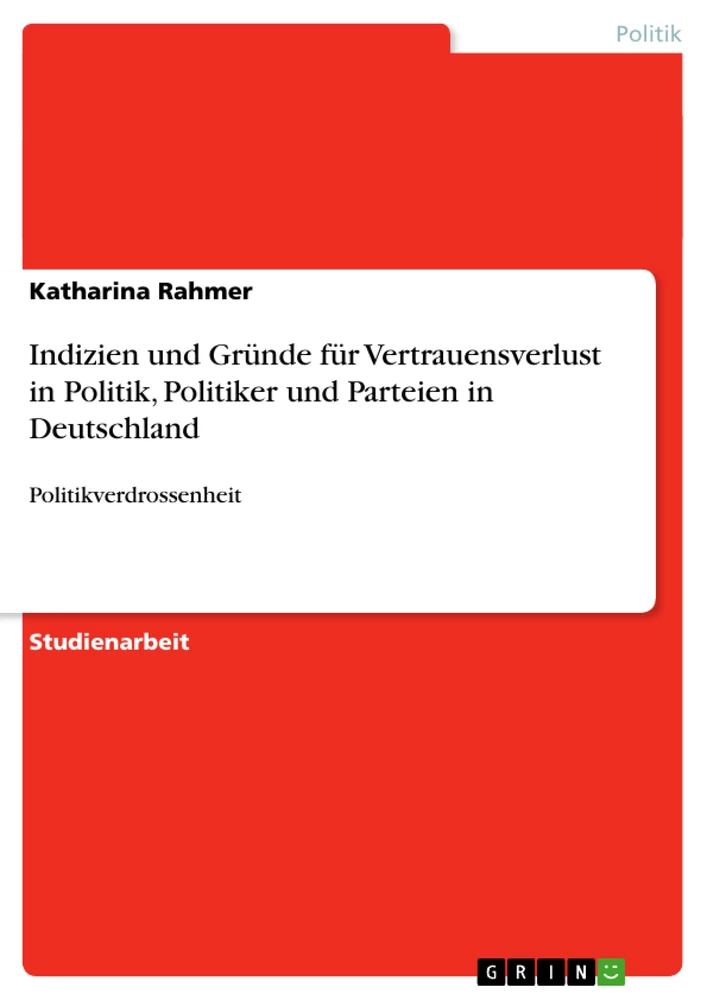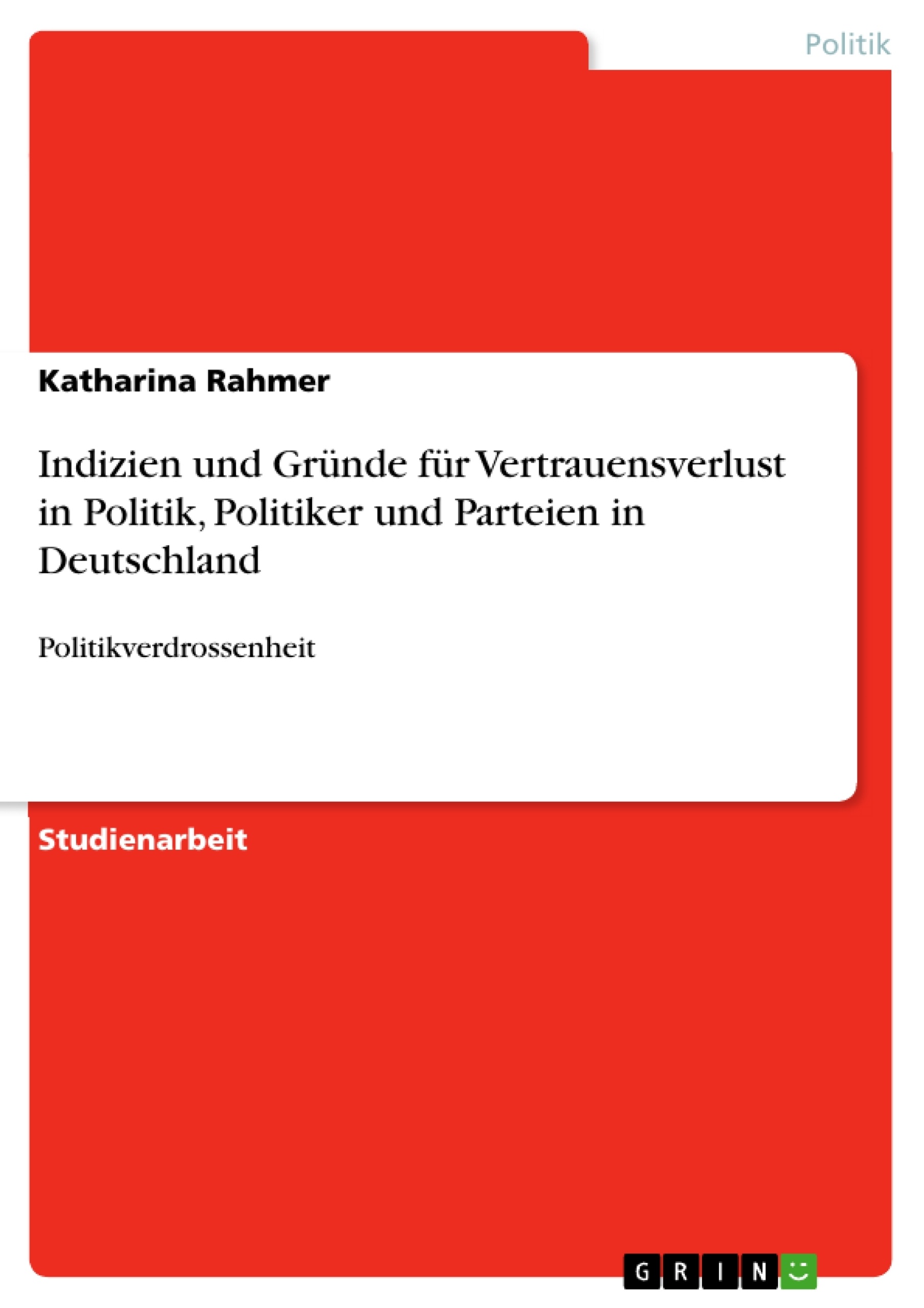Wie äußert sich unter anderem die steigende Politikverdrossenheit? Wie ändern sich die Wahleigenschaften von Jugendlichen in der heutigen Zeit, in der besonders diese Angst vor der Zukunft haben? Unter anderem versuche ich auch zu verstehen, aufgrund welcher Vertrauensaspekte sich ein Wähler für eine bestimmte Partei oder einen Politiker einer bestimmten Partei entscheidet. Wichtig erscheint auch, warum Vertrauen überhaupt so gewichtig ist bei der Auswahl eines bestimmten Politikers. Hier sehe ich viele Aspekte die Luhmann in seinem Text über Vertrauen entwickelt hat. Die Frage die ich mir zum Schluss stelle ist, ob es sinnvoller wäre als Politiker immer mit offenen Karten zu spielen. Hat man dann überhaupt eine Chance gewählt zu werden? Oder im Gegenteil, kann es sein, dass Ehrlichkeit Vertrauen fördert. Wenn politische Maßnahmen und ihre oft einschränkenden Folgen für den Wähler abzuwägen sind, entsteht dann nicht doch eher Vertrauen als wenn die nicht angekündigten Maßnahmen mit ihren oft einschränkenden Konsequenzen nicht zu erahnen sind?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vertrauen in der Politik/ Entscheidungsmechanismen für Vertrauen in eine bestimmte Partei
- Indizien für Vertrauensverlust und Politikverdrossenheit in Deutschland
- Rückläufige Wahlteilnahme
- Extremisierung des Wahlverhaltens
- Politikverdrossenheit
- Vertrauensverlust in die Politik
- Vertrauensverlust durch Skandale
- Vertrauensverlust durch „nicht eingehaltene“ Wahlversprechen
- Maßnahmen die Politiker ergreifen um dem Vertrauensverlust entgegenzuwirken
- Meine Schlussfolgerung - Was passiert wenn man die ganze Wahrheit sagt?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Vertrauensverlust in Politik, Politiker und Parteien in Deutschland. Sie analysiert die Ursachen dieses Vertrauensverlusts, seine Auswirkungen auf das Wahlverhalten und die Entstehung von Politikverdrossenheit. Die Arbeit beleuchtet zudem Strategien von Politikern zur Bekämpfung dieses Problems.
- Ursachen des Vertrauensverlusts in die Politik
- Auswirkungen des Vertrauensverlusts auf das Wahlverhalten
- Das Phänomen der Politikverdrossenheit
- Strategien von Politikern zur Wiederherstellung von Vertrauen
- Die Rolle der Ehrlichkeit in der Politik
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Vertrauensverlust in Politik, Politiker und Parteien ein und beschreibt die Forschungsfragen der Arbeit. Es werden zentrale Aspekte wie die Auswirkungen des Vertrauensverlusts, die Mechanismen, die zu diesem führen, und die Bemühungen der Politiker, dem entgegenzuwirken, genannt. Die Autorin stellt die Frage nach der optimalen Kommunikationsstrategie von Politikern in Bezug auf Transparenz und Ehrlichkeit.
Vertrauen in der Politik/ Entscheidungsmechanismen für Vertrauen in eine bestimmte Partei: Dieses Kapitel untersucht, wie Vertrauen in die Politik entsteht und welche Rolle es bei der Wahlentscheidung spielt. Es wird argumentiert, dass Wähler aufgrund von Interessen und Zielen bestimmte Parteien wählen. Die Autorin erklärt, dass der Vertrauensverlust oft auf einzelne Politiker fokussiert wird, anstatt die gesamte Partei zu diskreditieren, und analysiert die Stabilität der Wählerstimmenanteile großer Parteien trotz Vertrauensbrüchen. Ein Vergleich von Wahlbeteiligungen der SPD und CDU/CSU über verschiedene Jahre hinweg illustriert diese These.
Indizien für Vertrauensverlust und Politikverdrossenheit in Deutschland: Dieses Kapitel präsentiert zwei Indizien für den Vertrauensverlust in die deutsche Politik: die rückläufige Wahlbeteiligung und die Extremisierung des Wahlverhaltens. Beide werden als besorgniserregende Zeichen interpretiert, die den wachsenden Vertrauensverlust und die Politikverdrossenheit in der Bevölkerung widerspiegeln. Die Autorin argumentiert, dass diese Phänomene aufzeigen, wie sich der zunehmende Vertrauensverlust in der Bevölkerung manifestiert.
Schlüsselwörter
Vertrauensverlust, Politikverdrossenheit, Wahlverhalten, Politik, Politiker, Parteien, Wahlbeteiligung, Extremismus, Ehrlichkeit, Transparenz, Wahlversprechen, Skandale.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Vertrauensverlust in der Politik
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Vertrauensverlust in Politik, Politiker und Parteien in Deutschland. Sie analysiert die Ursachen dieses Vertrauensverlusts, seine Auswirkungen auf das Wahlverhalten und die Entstehung von Politikverdrossenheit. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Strategien von Politikern zur Bekämpfung dieses Problems und der Rolle von Ehrlichkeit und Transparenz.
Welche Aspekte werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Aspekte des Vertrauensverlusts, darunter:
- Ursachen des Vertrauensverlusts (z.B. Skandale, nicht eingehaltene Wahlversprechen)
- Auswirkungen auf das Wahlverhalten (z.B. sinkende Wahlbeteiligung, Extremisierung)
- Das Phänomen der Politikverdrossenheit
- Strategien von Politikern zur Wiederherstellung des Vertrauens
- Die Bedeutung von Ehrlichkeit und Transparenz in der Politik
- Entscheidungsmechanismen für das Vertrauen in eine bestimmte Partei
Welche Indizien für Vertrauensverlust werden genannt?
Die Arbeit nennt als Indizien für Vertrauensverlust in der deutschen Politik die rückläufige Wahlbeteiligung und die Extremisierung des Wahlverhaltens. Beide werden als besorgniserregende Zeichen für wachsenden Vertrauensverlust und Politikverdrossenheit interpretiert.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, Kapitel zu Vertrauen in der Politik und Entscheidungsmechanismen, Indizien für Vertrauensverlust und Politikverdrossenheit, Vertrauensverlust durch Skandale und nicht eingehaltene Wahlversprechen, Maßnahmen von Politikern zur Vertrauenswiederherstellung und eine Schlussfolgerung. Jedes Kapitel wird zusammengefasst.
Welche Schlussfolgerung zieht die Autorin?
Die Schlussfolgerung der Autorin befasst sich mit der Frage, was passiert, wenn Politiker die ganze Wahrheit sagen. Der genaue Inhalt der Schlussfolgerung ist im gegebenen Auszug nicht detailliert beschrieben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Vertrauensverlust, Politikverdrossenheit, Wahlverhalten, Politik, Politiker, Parteien, Wahlbeteiligung, Extremismus, Ehrlichkeit, Transparenz, Wahlversprechen, Skandale.
Wer ist die Zielgruppe dieser Arbeit?
Die Zielgruppe ist nicht explizit genannt, aber aufgrund des akademischen Inhalts und der strukturierten Analyse dürfte sie sich an ein akademisches Publikum richten.
- Quote paper
- Katharina Rahmer (Author), 2007, Indizien und Gründe für Vertrauensverlust in Politik, Politiker und Parteien in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/126989