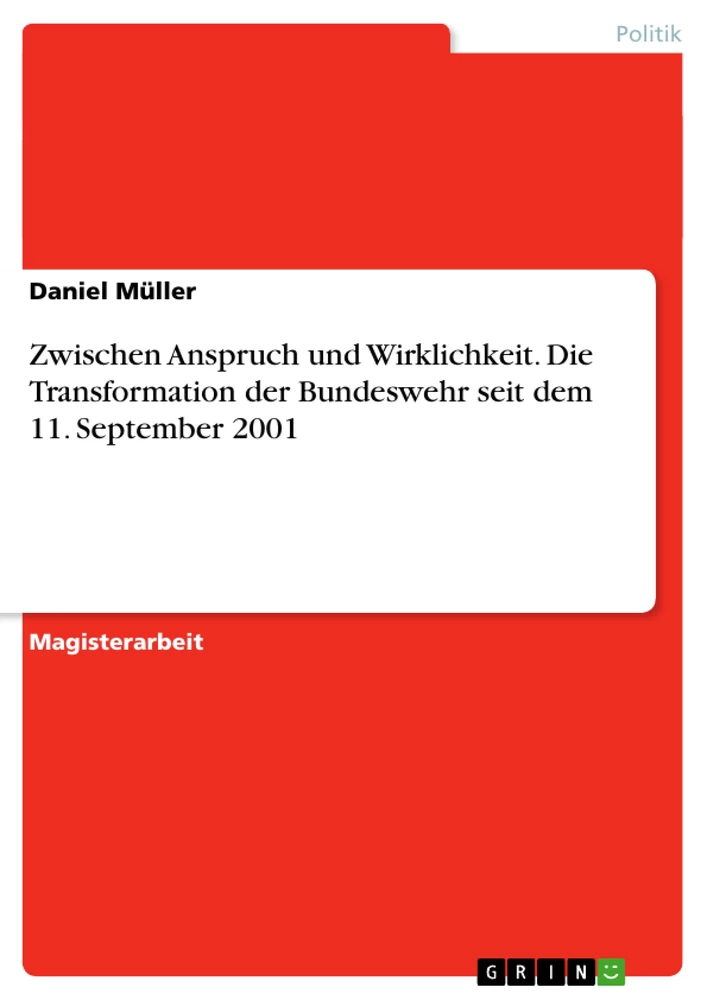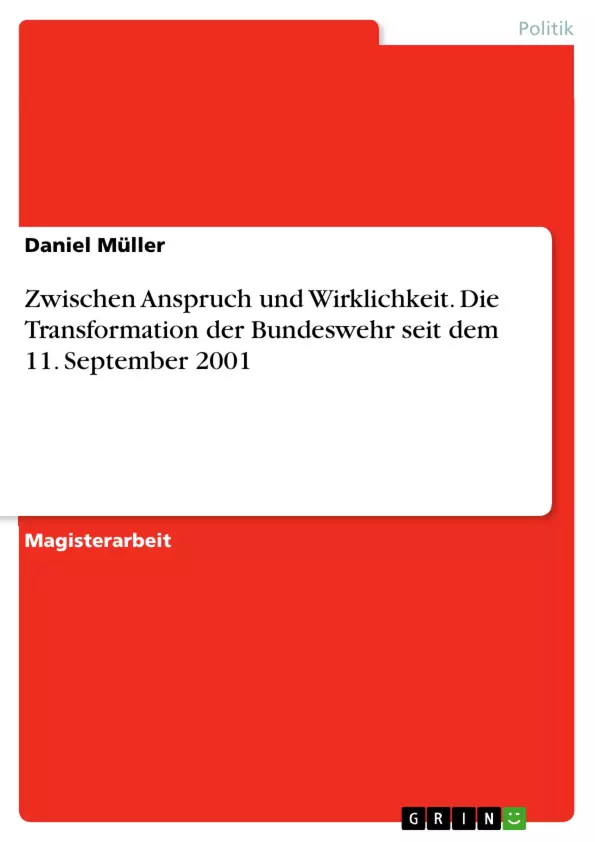Untersuchungsgegenstand dieser Magisterarbeit soll die Eruierung der Einsatzfähigkeit der Bundeswehr hinsichtlich der geforderten Aufgaben sein. Sind die Streitkräfte in ihrem gegenwärtigen Zustand den neuen Herausforderungen gewachsen? Dabei ist die Frage zu klären, ob Deutschland seinen Verpflichtungen nachkommen kann und wo Nachholbedarf besteht. Einer kritischen Würdigung müssen neben den strategischen Planungen vor allem die technischen, personellen, logistischen und finanziellen Aktiva unterzogen werden. Es ist zu erörtern, ob die Bundeswehr als eine moderne Armee, die den Anforderungen der Politik und Bündnispartner gerecht wird, gelten kann.
Wie sehr liegen Anspruch und Wirklichkeit auseinander, wenn es um die Frage nach schneller, flexibler Truppenverlegung, zeitgemäßer Ausbildung oder für den Einsatz geeigneter Ausrüstung geht?
Wie steht es um die technische Beschaffenheit in Heer, Luftwaffe und Marine? Kann man von einer zukunftsfähigen Armee sprechen?
Die Arbeit geht der Frage nach, wie gut die Bundeswehr auf die neuen Ziele hinsichtlich der Ausbildung ihrer Soldaten und Offiziere vorbereitet ist. Wie gut oder wie schlecht ist die Armee auf die medizinische und psychologische Versorgung vorbereitet?
Wie vermag die BRD mit ihrem jetzigen Heer den Verbindlichkeiten gegenüber den Bündnispartnern in der Europäischen Union und NATO nachzukommen? Welche Lehren hat die Hardthöhe aus den Operationen gezogen? Was wurde verbessert, was blieb bestehen? Wie ist die Meinung der Soldaten über den Stand der Bundeswehr und der Auslandseinsätze?
Die Diskussion über die Abschaffung der Wehrpflicht fließt mit ein. Ist das System „Wehrpflichtarmee“ noch zeitgemäß oder wäre eine Berufsarmee vorteilhafter? Politische Entscheidungen wie die Mandate des Bundestages zur Entsendung von Soldaten in Konfliktregionen müssen einer kritischen Würdigung unterzogen werden. Inwieweit ist die Zustimmung des Parlamentes nötig, wenn es um die Abkommandierung der Truppen geht? Wie wichtig bzw. wie bremsend wirken sie sich auf die tatsächliche Arbeit vor Ort aus? Ist die Mandatierung auch der kleineren Suboperationen ebenfalls nötig? Wieviel Spielraum muß man den Kommandeuren im Einsatzgebiet zubilligen, damit die Bundeswehr ihren Auftrag erfolgreich erfüllen und somit ihr Postulat einer modernen Armee zur Krisenbekämpfung und zum Wiederaufbau aufrecht erhalten kann? Besonderen Eingang finden beispielhaft die Einsätze der Bundeswehr in Afghanistan und am Horn von Afrika.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Untersuchungsgegenstand
- Problemstellung
- Forschungsstand
- Aufbau
- Abkürzungsverzeichnis
- Die Terroranschläge vom 11. September 2001
- Strategische Konzeption von Bundeswehr und NATO bis 2001
- Reaktionen von NATO und Vereinten Nationen
- Reaktion des Bundesverteidigungsministeriums auf die neue Situation
- Veränderte geopolitische Gefahrenpotenziale
- Juristische Grundlagen für Auslandseinsätze
- Ergebnis
- Anforderungen an die Bundeswehr des 21. Jahrhunderts
- Verteidigungspolitische Richtlinien von 2003
- Weißbuch des Verteidigungsministeriums 2006
- Aufgaben für die Streikräfte
- Herausforderungen für alle Truppengattungen
- Heer
- Luftwaffe
- Marine
- Ergebnis
- Zum Stand der Ausrüstung
- Entwicklung bis 2008
- Heer
- Gepanzerte Fahrzeuge
- „Infanterist der Zukunft“
- Transportmittel und Helikopter
- Luftwaffe
- Marine
- Ergebnis
- Sanitätswesen und psychologische Betreuung
- Medizinischer Dienst
- Psychologisch-Soziale Betreuung
- Theologische Seelsorge
- Ergebnis
- Ausbildungsstand der Offiziere und Soldaten
- Offiziere
- Unteroffiziere und Mannschaften
- Innere Führung und psychologische Komponente
- Nachwuchsgewinnung
- Die Stimmung unter den Soldaten
- Ergebnis
- Die politische Dimension
- Budget
- Wehrpflicht
- Ergebnis
- Bundestagsmandate als Hemmnis?
- Beispiel 1: Operation „Enduring Freedom“ am Horn von Afrika
- Beispiel 2: Afghanistan
- Alternativen zur parlamentarischen Mandatierung
- Ergebnis
- Die Wahrnehmung der Verpflichtungen gegenüber den Bündnispartnern in EU und NATO
- Ausgangslage
- Quick Reaction Force in Afghanistan
- Zu enge Mandatsgrenzen?
- Ergebnis
- Schlußbetrachtung
- Zusammenfassung
- Ausblick
- Literaturverzeichnis
- Monographien
- Sammelbände
- Zeitungen und Zeitschriften
- Internetseiten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Transformation der Bundeswehr seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001. Sie untersucht, inwieweit die deutsche Armee den neuen Herausforderungen gewachsen ist und welche Anpassungen in Struktur, Ausrüstung, Ausbildung und strategischer Ausrichtung notwendig waren. Die Arbeit beleuchtet die veränderten Bedrohungsszenarien, die neuen Aufgaben der Bundeswehr im internationalen Kontext und die Herausforderungen, die sich aus der veränderten Sicherheitslage ergeben.
- Die Auswirkungen der Terroranschläge vom 11. September 2001 auf die Bundeswehr
- Die Anpassung der Bundeswehr an die neuen Bedrohungsszenarien
- Die Rolle der Bundeswehr im internationalen Kontext
- Die Herausforderungen der Transformation der Bundeswehr
- Die politische Dimension der Bundeswehrreform
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Untersuchungsgegenstand, die Problemstellung, den Forschungsstand und den Aufbau der Arbeit dar. Sie beleuchtet die grundlegenden Veränderungen, die die Terroranschläge vom 11. September 2001 für die Bundeswehr mit sich brachten. Das zweite Kapitel analysiert die Reaktionen von NATO und Vereinten Nationen auf die Anschläge und die daraus resultierenden Veränderungen in der Sicherheitspolitik. Es beleuchtet die veränderten geopolitischen Gefahrenpotenziale und die juristischen Grundlagen für Auslandseinsätze der Bundeswehr. Das dritte Kapitel befasst sich mit den Anforderungen an die Bundeswehr des 21. Jahrhunderts. Es analysiert die Verteidigungspolitischen Richtlinien von 2003 und das Weißbuch des Verteidigungsministeriums 2006, die die neuen Aufgaben und Herausforderungen für die Bundeswehr definieren. Das vierte Kapitel untersucht den Stand der Ausrüstung der Bundeswehr. Es beleuchtet die Entwicklung der Ausrüstung bis 2008 und analysiert die Ausstattung der verschiedenen Truppengattungen. Das fünfte Kapitel befasst sich mit dem Sanitätswesen und der psychologischen Betreuung der Bundeswehr. Es analysiert die medizinische Versorgung und die psychologische Unterstützung der Soldaten im Einsatz. Das sechste Kapitel untersucht den Ausbildungsstand der Offiziere und Soldaten. Es beleuchtet die Ausbildungsstrukturen und die Herausforderungen der Nachwuchsgewinnung. Das siebte Kapitel analysiert die politische Dimension der Bundeswehrreform. Es befasst sich mit dem Budget der Bundeswehr und der Wehrpflicht. Das achte Kapitel untersucht die Rolle der Bundestagsmandate als Hemmnis für Auslandseinsätze der Bundeswehr. Es analysiert die Herausforderungen der parlamentarischen Mandatierung und die Notwendigkeit einer flexibleren Einsatzfähigkeit. Das neunte Kapitel befasst sich mit der Wahrnehmung der Verpflichtungen gegenüber den Bündnispartnern in EU und NATO. Es analysiert die Rolle der Bundeswehr in internationalen Einsätzen und die Herausforderungen der Zusammenarbeit mit anderen Staaten. Die Schlußbetrachtung fasst die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf die zukünftigen Herausforderungen für die Bundeswehr.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Transformation der Bundeswehr, die Terroranschläge vom 11. September 2001, die veränderten Bedrohungsszenarien, die neuen Aufgaben der Bundeswehr im internationalen Kontext, die Herausforderungen der Bundeswehrreform, die Ausrüstung, die Ausbildung, die politische Dimension, die Mandatierung von Auslandseinsätzen, die Zusammenarbeit mit den Bündnispartnern in EU und NATO.
Häufig gestellte Fragen
Wie hat sich die Bundeswehr seit dem 11. September 2001 verändert?
Die Bundeswehr durchlief eine Transformation von einer reinen Verteidigungsarmee hin zu einer Armee für internationale Kriseneinsätze und Stabilisierungsoperationen.
Was sind die größten Herausforderungen bei Auslandseinsätzen?
Zentrale Probleme sind die technische Ausrüstung, die logistische Truppenverlegung, die medizinische Versorgung sowie die psychologische Betreuung der Soldaten.
Welche Rolle spielt das Bundestagsmandat?
Jeder bewaffnete Auslandseinsatz benötigt die Zustimmung des Parlaments. Die Arbeit untersucht, ob diese Mandatierung die operative Arbeit vor Ort hemmen kann.
Ist die Wehrpflicht noch zeitgemäß?
Die Magisterarbeit diskutiert die Vor- und Nachteile einer Wehrpflichtarmee im Vergleich zu einer spezialisierten Berufsarmee angesichts neuer Bedrohungsszenarien.
In welchen Regionen war die Bundeswehr nach 2001 besonders aktiv?
Exemplarisch werden die Einsätze in Afghanistan (ISAF) und am Horn von Afrika (Operation Enduring Freedom) analysiert.
- Citation du texte
- Daniel Müller (Auteur), 2008, Zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Die Transformation der Bundeswehr seit dem 11. September 2001, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/127031