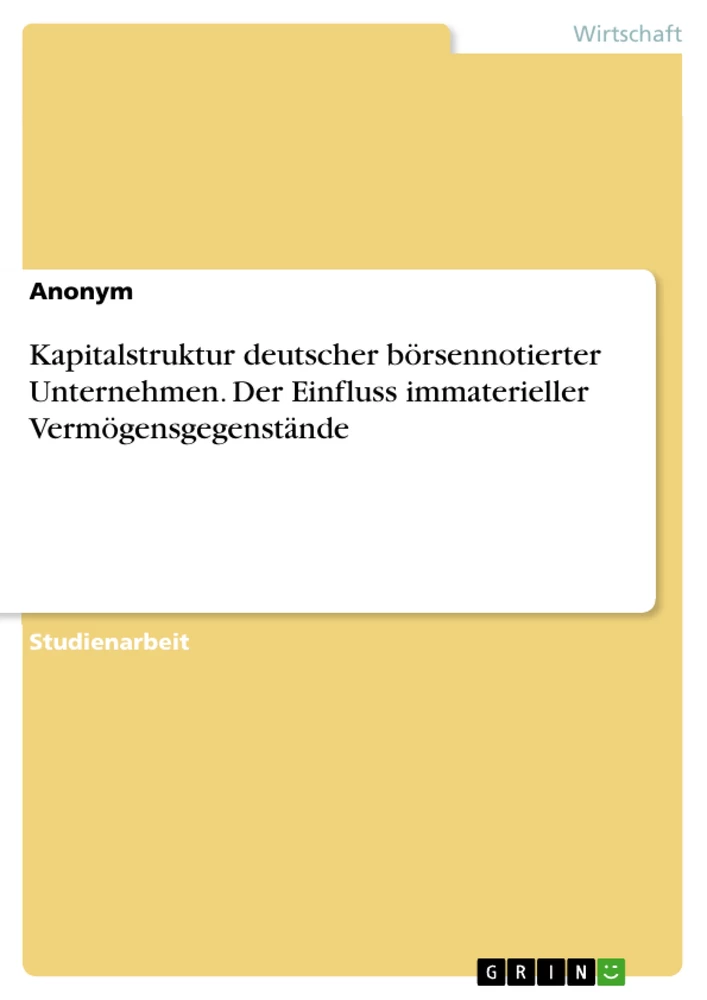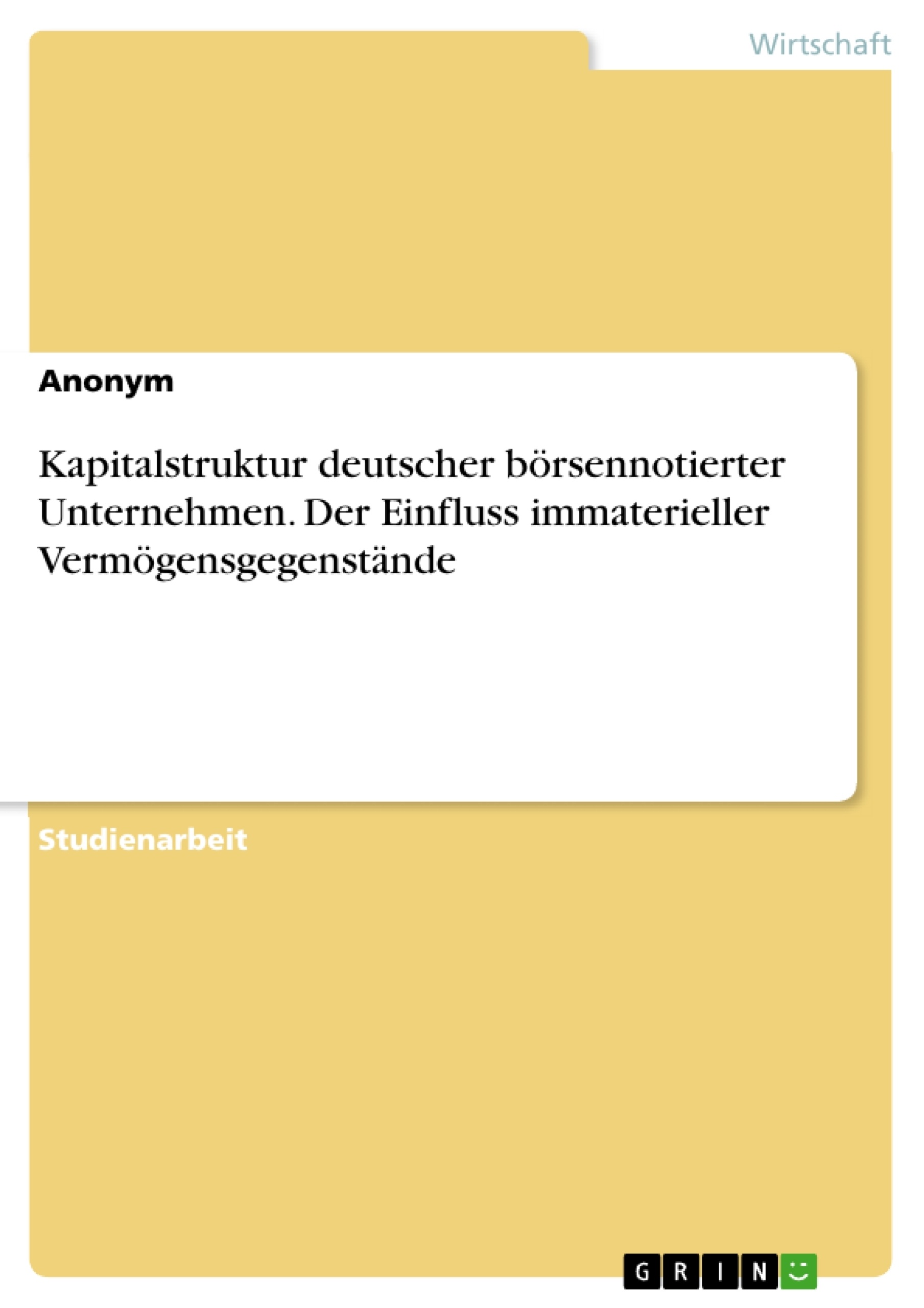Mit Blick auf die Relevanz der Kapitalstruktur unter dem Shareholder-Value Aspekt und der zunehmenden Bedeutung von immateriellen Vermögensgegenständen wird mit dieser wissenschaftlichen Untersuchung das Ziel verfolgt den Einfluss der immateriellen Vermögensgegenstände auf die Wahl der Kapitalstruktur bei deutschen börsennotierten Unternehmen zu eruieren.
Zur Verfolgung der Zielsetzung wird die folgende Null- und Alternativhypothese formuliert:
H0: Der Anteil der immateriellen Vermögensgegenstände am Gesamtvermögen hat keinen positiven Einfluss auf den Verschuldungsgrad aufgrund von Agency-Kosten der Eigenfinanzierung.
HA: Der Anteil der immateriellen Vermögensgegenstände am Gesamtvermögen hat einen positiven Einfluss auf den Verschuldungsgrad aufgrund von Agency-Kosten der Eigenfinanzierung.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Ausgangssituation und Problemstellung
- 1.2 Zielsetzung und Vorgehensweise
- 2 Theoretische Grundlagen der Kapitalstrukturtheorie
- 2.1 Irrelevanztheorem nach Modogliani und Miller
- 2.2 Statische Trade-off Theorie
- 2.3 Integrierte Trade-off Theorie
- 2.4 Stand der Forschung
- 3 Konzeption der empirischen Untersuchung und Methodik
- 3.1 Methodik und Prüfung der Regressionsfunktion
- 3.2 Operationalisierung der Variablen
- 3.3 Datenerhebung und Datengrundlage
- 4 Empirische Analyse des Einflusses von immateriellen Vermögensgegenständen auf die Wahl der Kapitalstruktur
- 4.1 Deskriptive Analyse
- 4.2 Regressionsdiagnostik
- 4.3 Ergebnisse der empirischen Untersuchung
- 4.4 Theoriekonformität und kritische Würdigung der Ergebnisse
- 5 Würdigung der Forschungshypothese und Fazit
- 5.1 Zusammenfassung der bisherigen Erkenntnisse und Würdigung der Forschungshypothese
- 5.2 Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Einfluss von immateriellen Vermögensgegenständen auf die Wahl der Kapitalstruktur deutscher börsennotierter Unternehmen. Ziel ist es, die theoretischen Grundlagen der Kapitalstrukturtheorie mit empirischen Ergebnissen zu verknüpfen und die Relevanz von immateriellen Vermögensgegenständen für die Finanzierungsentscheidungen von Unternehmen zu beleuchten.
- Theoretische Grundlagen der Kapitalstrukturtheorie (Irrelevanztheorem, Trade-off Theorie)
- Relevanz von immateriellen Vermögensgegenständen für die Kapitalstruktur
- Empirische Analyse des Einflusses von immateriellen Vermögensgegenständen auf die Wahl der Kapitalstruktur
- Würdigung der Forschungshypothese und Schlussfolgerungen
- Fazit und Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Problemstellung ein und erläutert die Zielsetzung der Arbeit. Kapitel 2 beleuchtet die theoretischen Grundlagen der Kapitalstrukturtheorie, insbesondere das Irrelevanztheorem von Modigliani und Miller sowie die Trade-off Theorie. Kapitel 3 erläutert die Methodik der empirischen Untersuchung und die Operationalisierung der Variablen. Kapitel 4 präsentiert die Ergebnisse der empirischen Analyse und diskutiert die Theoriekonformität der Ergebnisse. Kapitel 5 fasst die wichtigsten Erkenntnisse zusammen, würdigt die Forschungshypothese und zieht ein Fazit.
Schlüsselwörter
Immaterielle Vermögensgegenstände, Kapitalstruktur, Trade-off Theorie, Irrelevanztheorem, empirische Analyse, Regressionsanalyse, deutsche börsennotierte Unternehmen
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflussen immaterielle Vermögensgegenstände die Kapitalstruktur eines Unternehmens?
Die Arbeit untersucht, ob ein höherer Anteil an immateriellen Vermögenswerten (wie Patente oder Marken) einen positiven Einfluss auf den Verschuldungsgrad hat, insbesondere im Hinblick auf Agency-Kosten der Eigenfinanzierung.
Was besagt das Irrelevanztheorem nach Modigliani und Miller?
Es besagt unter idealen Marktbedingungen, dass der Wert eines Unternehmens und seine Kapitalkosten unabhängig von seiner Kapitalstruktur (Verhältnis von Eigen- zu Fremdkapital) sind.
Was ist der Kern der statischen Trade-off Theorie?
Unternehmen suchen ein optimales Verschuldungsniveau, indem sie die Steuervorteile der Fremdfinanzierung gegen die Kosten potenzieller finanzieller Notlagen und Agency-Kosten abwägen.
Welche Rolle spielt der Shareholder-Value Aspekt in dieser Untersuchung?
Die Kapitalstruktur wird dahingehend analysiert, wie sie den Unternehmenswert für die Aktionäre optimiert, wobei die zunehmende Bedeutung immaterieller Werte eine neue Variable darstellt.
Welche Methodik wurde für die empirische Analyse verwendet?
Es wurde eine Regressionsanalyse durchgeführt, um den statistischen Zusammenhang zwischen immateriellen Vermögensgegenständen und dem Verschuldungsgrad deutscher börsennotierter Unternehmen zu prüfen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2021, Kapitalstruktur deutscher börsennotierter Unternehmen. Der Einfluss immaterieller Vermögensgegenstände, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1270450