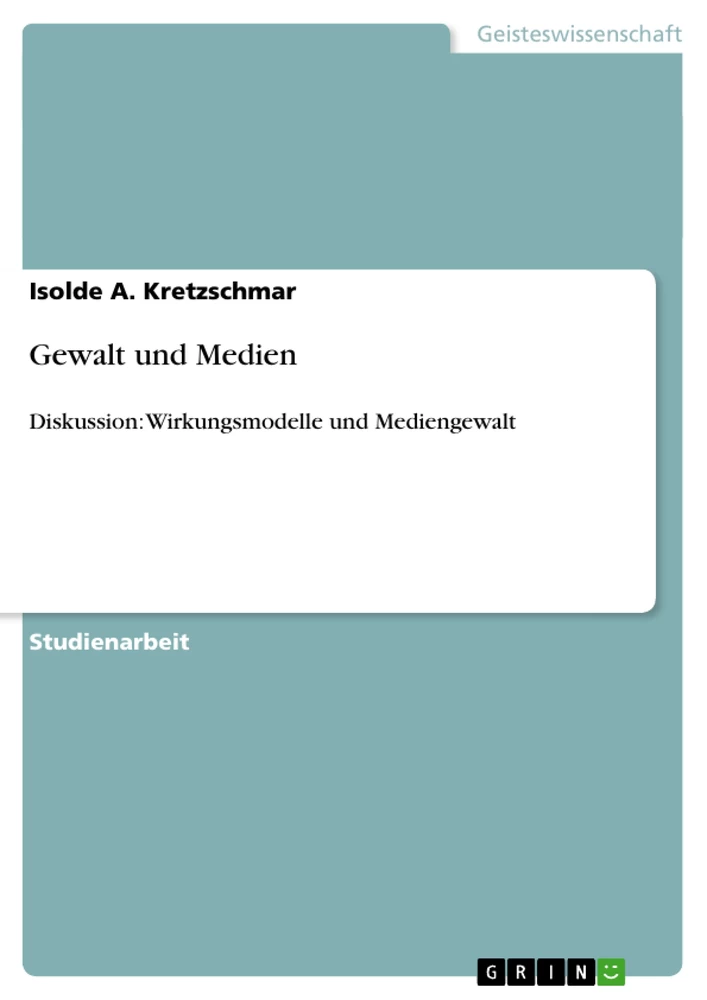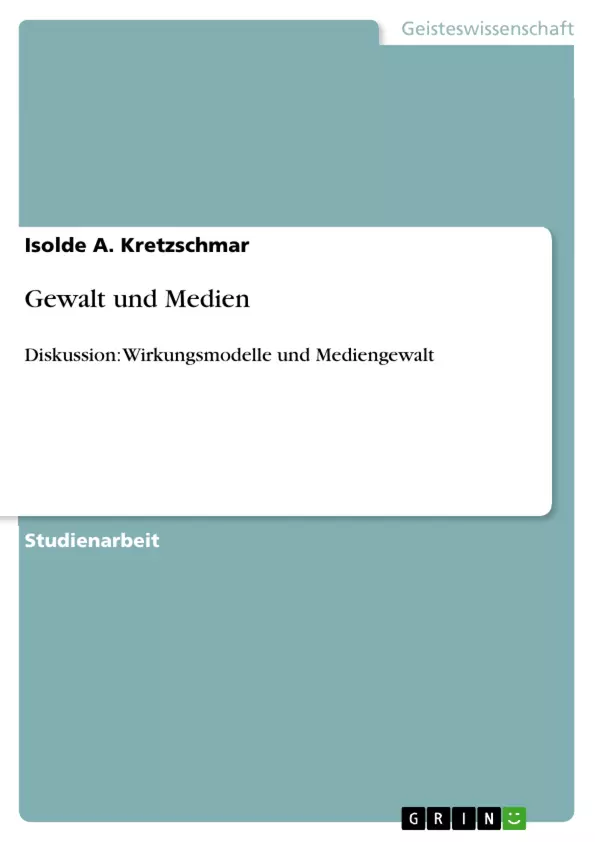Gegenwärtig wird eine Gewaltbereitschaft in der Gesellschaft festgestellt, die im Vergleich zur jüngsten Vergangenheit gestiegen sein soll. Aber so ist zu hinterfragen, ob die Qualität oder Quantität der Gewalt damit gemeint ist. Über aggressive Handlungen wurde bis 1950 eher nicht in den Medien bildhaft berichtet. Vor der Erfindung des Fernsehens wurden die Radio, Nachrichten durch Neuigkeiten per Zeitung oder mündlicher Mitteilung weitergeleitet. So wurden auch Berichte über kriminelle Handlungen gar nicht so stark verbreitet. Meistens blieben solche Nachrichten auf die nähere Region beschränkt. So nimmt die Berichterstattung mit Hilfe des Fernsehens einen ganz anderen Stellenwert in der heutigen Gesellschaft als damals ein. Nun ist auch zu bemerken, wann situativ Gewalt angewendet wird. So kann Gewalt eingesetzt werden, um Konflikte auf schnelle und scheinbar unkomplizierte Art und Weise zu lösen. Aber es ist nun zu hinterfragen, wie die Voraussetzung ist, dass jemand zur vermeintlichen Konfliktlösung in zwischenmenschlichen Beziehungen eine aggressive Handlung wählt. Es gibt ja auch schließlich andere Wege, um eine schwierige Situation zu bewältigen oder bei einer Auseinandersetzung seine eigene Meinung durchzusetzen oder zumindest Kompromisse zu finden. Allerdings liefert das visuelle Angebot und der Medienkonsum in den letzten Jahren auch einen wesentlichen Beitrag zur Gewaltbereitschaft. So ist nun die Aufgabe dieser Hausarbeit Modelle und Thesen über den Zusammenhang von Medienwirkungen der Gewaltpräsentation auf eine durch Zuschauer real nachfolgende aggressive Handlung hin zu erörtern. Wie wirken Gewaltdarstellungen auf den Fernsehkonsumenten? Gibt es weitere Faktoren, die bei der steigenden Rate der aggressiven Handlungen im realen Umfeld eine wesentliche Rolle spielen, zu berücksichtigen? Welche psychologischen Modelle sowie aufgestellte Thesen über die Medienwirkung sind bei der Beantwortung dieser oben gestellten Fragen aussagekräftig?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Motivation zum Thema
- Aufbau der Arbeit
- Gewalt und Aggression
- Gewalt
- Aggression
- Medienwirkungen
- Vier Annahmen
- Wirkungsmodelle
- Stimulus-Response-Modell (Kanonentheorie)
- Payne Fund Studies
- Kritik
- Trimodales transklassisches Wirkungsmodell
- Lernen am Modell
- Wirkung von Mediengewalt
- Katharsisthese
- Stimulationsthese
- Kultivierungsthese
- These der Wirkungslosigkeit
- These der Ambivalenz
- Persönlichkeitsmodell
- Sehr stark gefährdete Persönlichkeit
- Weniger stark gefährdete Persönlichkeit
- Zusammenfassung wichtiger Punkte
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Einfluss von Mediengewalt auf die Gewaltbereitschaft in der Gesellschaft. Ziel ist es, verschiedene Modelle und Thesen zum Zusammenhang zwischen fiktiven medialen Gewaltpräsentationen und realen aggressiven Handlungen zu erörtern und zu analysieren. Dabei werden die wichtigsten Annahmen, Wirkungsmodelle und Thesen zur Medienwirkung vorgestellt und kritisch betrachtet.
- Die Rolle von Mediengewalt in der Entstehung von Aggression
- Die verschiedenen Wirkungsmodelle und Thesen zur Medienwirkung
- Die Bedeutung des Persönlichkeitsmodells im Zusammenhang mit Mediengewalt und Aggression
- Die Kritik an den verschiedenen Thesen und Modellen
- Die Relevanz der Medienwirkung für die Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Gewalt und Medien ein und erläutert die Motivation der Autorin, sich mit diesem Thema zu befassen. Sie stellt den Aufbau der Arbeit vor und gibt einen Überblick über die behandelten Themen.
Im zweiten Kapitel werden die Begriffe Gewalt und Aggression definiert und voneinander abgegrenzt. Es werden verschiedene Formen von Gewalt und Aggression beschrieben und die Entstehung von Gewalt erläutert.
Das dritte Kapitel befasst sich mit den Medienwirkungen und stellt verschiedene Modelle und Thesen zum Zusammenhang zwischen Mediengewalt und Aggression vor. Es werden die vier Annahmen, das klassische Stimulus-Response-Modell, das trimodale transklassische Wirkungsmodell, das Lernen am Modell und die verschiedenen Thesen zur Wirkung von Mediengewalt (Katharsisthese, Stimulationsthese, Kultivierungsthese, These der Wirkungslosigkeit, These der Ambivalenz) vorgestellt und kritisch betrachtet.
Das vierte Kapitel stellt das Persönlichkeitsmodell im Zusammenhang mit Medienwirkung und Gewalthandlungen in der Realität vor. Es werden die Merkmale von sehr stark gefährdeten und weniger stark gefährdeten Persönlichkeiten beschrieben.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Gewalt, Aggression, Medienwirkung, Mediengewalt, Wirkungsmodelle, Thesen, Katharsisthese, Stimulationsthese, Kultivierungsthese, These der Wirkungslosigkeit, These der Ambivalenz, Persönlichkeitsmodell, Medienkonsum, Gewaltbereitschaft, Gesellschaft.
Häufig gestellte Fragen
Wie wirkt Mediengewalt auf Zuschauer?
Es gibt verschiedene Thesen: Die Stimulationsthese besagt, dass Gewaltkonsum aggressive Handlungen fördert, während die Katharsisthese behauptet, er baue Aggressionen ab.
Was ist das Stimulus-Response-Modell?
Auch als Kanonentheorie bekannt, geht dieses Modell davon aus, dass Medieninhalte wie ein direkter Reiz wirken, der beim Empfänger eine unmittelbare Reaktion auslöst.
Was besagt die Kultivierungsthese?
Sie besagt, dass langfristiger Fernsehkonsum die Wahrnehmung der Realität verändert. Vielseher halten die Welt oft für gefährlicher und gewalttätiger, als sie tatsächlich ist.
Was bedeutet „Lernen am Modell“ im Kontext von Mediengewalt?
Nach Bandura können Zuschauer (besonders Kinder) aggressive Verhaltensweisen von medialen Vorbildern übernehmen, wenn diese erfolgreich oder belohnt werden.
Gibt es Persönlichkeiten, die anfälliger für Mediengewalt sind?
Ja, das Persönlichkeitsmodell unterscheidet zwischen stark gefährdeten (z. B. durch instabile soziale Umfelder) und weniger stark gefährdeten Personen.
- Quote paper
- M. A. ; Dipl. (postgrad.) Isolde A. Kretzschmar (Author), 2006, Gewalt und Medien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/127068