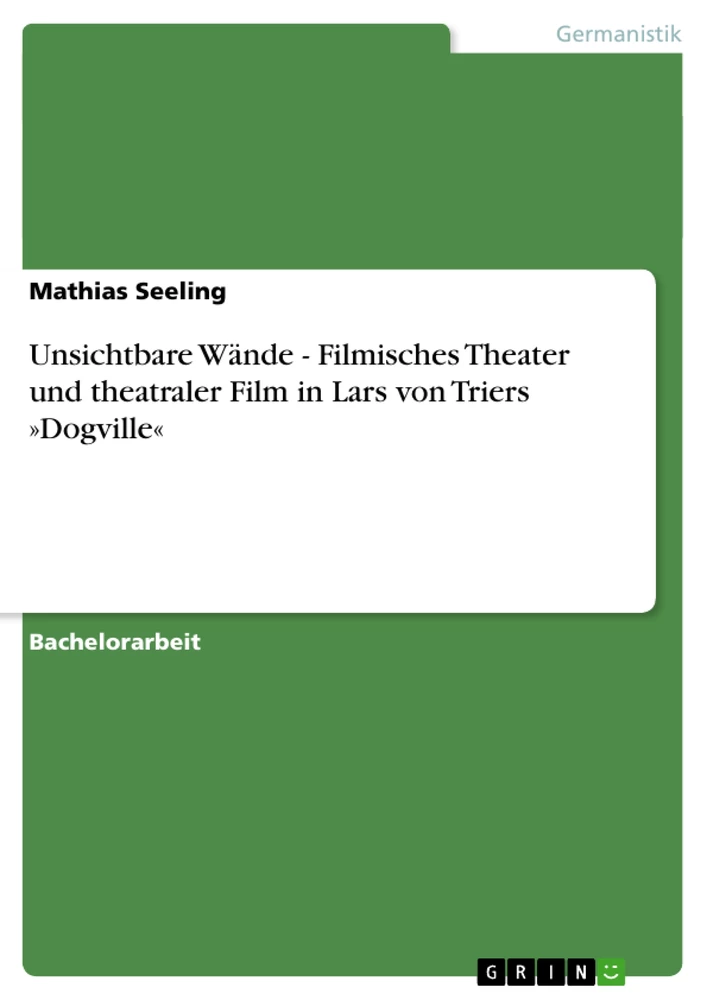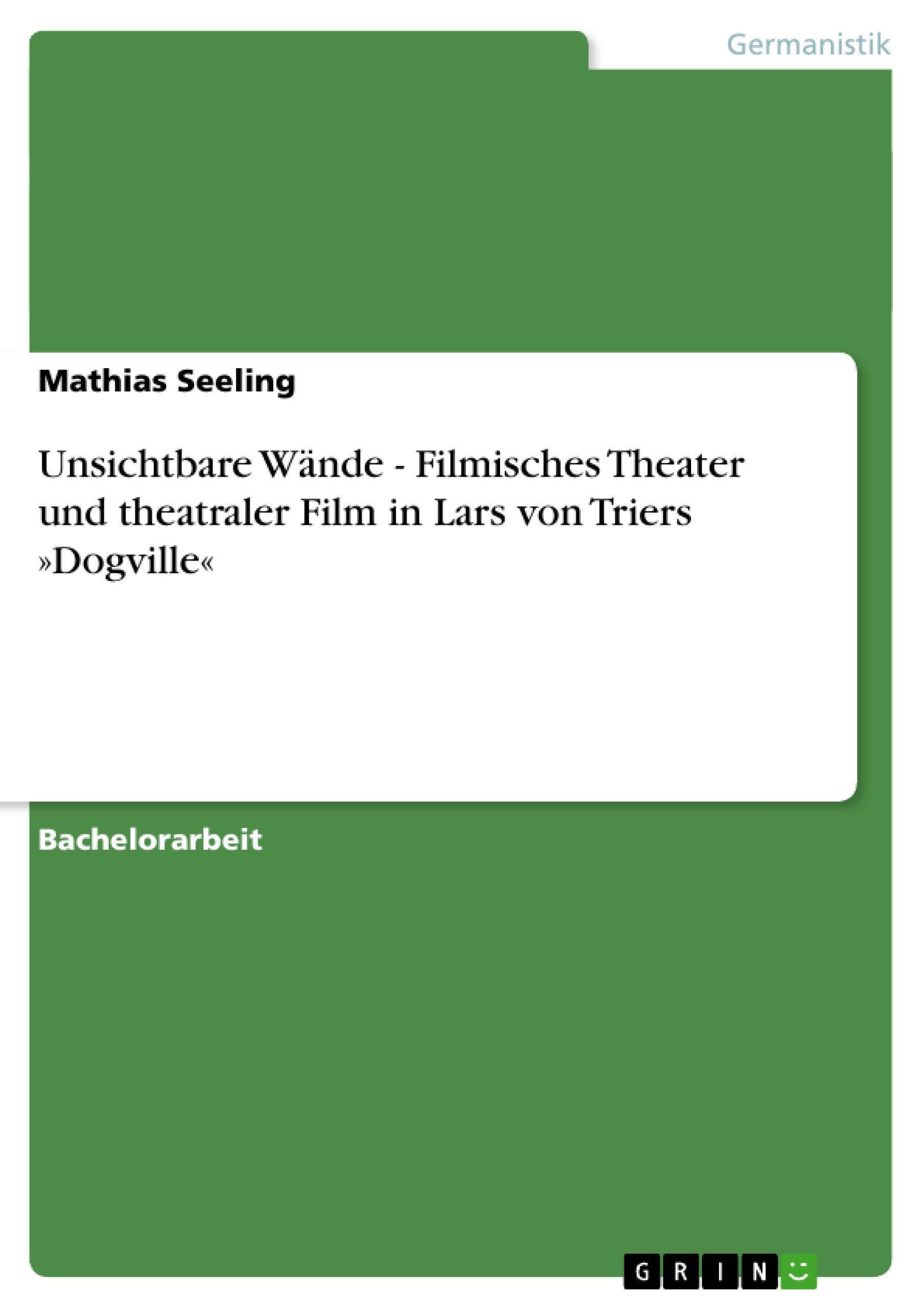Theater und Film – beide Medien sind gleichsam darstellende Künste, die Narration beinhalten und sich dabei auf sich ähnelnde Zeichensysteme beziehen. Dem entsprechend konstituieren sich um diese Schnittpunkte etwaige Grauzonen, die Theater und Film fortwährend konkurrieren lassen, jedoch ebenso konstruierende Kommunikationen zulassen.
Bei der Darstellung von Raum soll explizit die unterschiedliche Umsetzung des filmischen und theatralen Raumes durch eine dynamische und statische Betrachtungsweise untersucht werden. Während dieses Raumdiskurses wird auf die Illusion der Realitätsreproduktion eingegangen und hinterfragt, in wie fern diese vom Rezipienten bedingt wird. Durch das fehlen von optischen Reizen hinsichtlich der Bühnenarchitektur wird der Zuschauer einerseits desillusioniert und sich dem künstlichen Wesen des Films »Dogville« bewusst, andererseits jedoch bildet er sich gerade deswegen eine eigene, innere Illusion. In wie weit nun Illusion und Desillusion kooperieren oder nicht, wird eine weitere Fragestellung sein. Dazu fließen weitere Gedanken zu Lacans Theorie des Imaginären ein, die Einklang mit dem Film finden und Aufschlüsse zur imaginativen Filmrezeption geben sollen.
Ferner sollen Filmsprache und Filmsemiotik mit ihrer unterschiedlichen Wertigkeit theatraler und filmischer Zeichen dargestellt und dabei der Mobilitätsanspruch im jeweiligen Medium untersucht werden. Gegenwart, Körper und Schauspielkunst befassen sich mit der grundlegenden Differenz zwischen Theater und Film und der Anwesenheit bzw. Abwesenheit des Darstellers und erläutert dabei die Folgen für die Körper-Raum-Beziehung, sowie für das darstellende Spiel. Der Ton in »Dogville« spielt scheinbar eine ähnliche Rolle, wie die realitätsannähernden Geräuscheinspielungen auf der Bühne. Deshalb soll sich folgend mit der Valenz der Akustik beschäftigt werden, die in diesem Film eine besondere Qualität erhält. Das Wesen des Imaginären im Film wird hierbei zu analysieren und dessen Funktion hinsichtlich der Filmwirkung und der Rezeption auszuarbeiten sein, wobei die innere Rede nach Ejchenbaum eine Rolle spielen wird.
»Dogville« ist vielleicht ein sehr radikaler Entwurf, weil er auf Visualisierung durch ein architektonisches Szenenbild weitestgehend verzichtet. Jedoch zeichnet gerade diese Eigenschaft den Film aus, um ihn adäquat einem Vergleich zum Theater zu unterziehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1 Auf theatralem Boden
- 1.1 Funktion theatraler Momente im filmischen Rahmen
- 1.2 Reduziertes Set – Brecht'sches Theater?
- 1.3 Desillusionierung und Polyfunktionalität
- 2 ALS-OB! Theatrales Schauspiel im Film
- 2.1 Spiel mit der Kulisse – großer Film auf kleiner Bühne
- 2.2 Metaebenen - wenn das Andere dem Eigentlichen einen Sinn verleiht
- 3 Raum und Zeit ist relativ
- 3.1 Raumüberwindung und Sichtbarkeit
- 3.2 Zur „Zeitlosigkeit“ in »Dogville«
- 4 Was ist Gnade?
- 4.1 Grace als die wirkliche Gnade?
- 4.2 Von der göttlichen Richtbarkeit über Dogville
- 5 Durchbrechen des Zeichensystems
- 5.1 Die Realität des Imaginären
- 5.2 Die Auferstehung Moses'
- 5.3 Das Ende der Welt?
- Fazit
- Literatur- und Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit analysiert Lars von Triers Film »Dogville« im Hinblick auf die intermedialen Beziehungen zwischen Theater und Film. Die Arbeit untersucht, wie theatralische Elemente im filmischen Rahmen eingesetzt werden und welche Auswirkungen dies auf die Rezeption des Films hat. Dabei werden die spezifischen Eigenschaften des filmischen und theatralen Raumes, die Rolle des Schauspielers und die Bedeutung von Ton und Sprache im Film beleuchtet. Die Arbeit befasst sich auch mit der Frage, inwiefern die Desillusionierung des Zuschauers durch die Reduktion des Sets und die Verwendung theatralischer Elemente zu einer neuen Form der Illusion führt.
- Intermediale Beziehungen zwischen Theater und Film
- Theatrale Elemente im filmischen Rahmen
- Raum und Zeit im Film
- Rolle des Schauspielers und die Bedeutung von Ton und Sprache
- Desillusionierung und Illusion in der Filmrezeption
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der intermedialen Beziehungen zwischen Theater und Film ein und stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit vor. Sie beleuchtet die spezifischen Eigenschaften beider Medien und die Herausforderungen, die sich aus der Verschmelzung von theatralischen und filmischen Elementen ergeben.
Das erste Kapitel befasst sich mit der Funktion theatraler Momente im filmischen Rahmen. Es analysiert die Reduktion des Sets in »Dogville« und untersucht, inwiefern diese Reduktion auf ein brecht'sches Theater zurückzuführen ist. Des Weiteren wird die Frage nach der Desillusionierung und Polyfunktionalität des filmischen Raumes im Kontext der theatralischen Elemente diskutiert.
Das zweite Kapitel widmet sich dem theatrales Schauspiel im Film. Es untersucht, wie die Kulisse in »Dogville« als Spielfläche genutzt wird und welche Metaebenen durch die Verwendung theatralischer Elemente entstehen.
Das dritte Kapitel befasst sich mit der Relativität von Raum und Zeit im Film. Es analysiert die Raumüberwindung und Sichtbarkeit in »Dogville« und untersucht die „Zeitlosigkeit“ des Films im Kontext der statischen Gemeinschaft von Dogville.
Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit dem Thema Gnade im Film. Es analysiert die Rolle von Grace als Gnadengeschenk und hinterfragt, warum sie sich letztendlich für das Richten mithilfe ihrer Macht entscheidet.
Das fünfte Kapitel befasst sich mit dem Durchbrechen des Zeichensystems im Film. Es analysiert die Realität des Imaginären in »Dogville« und untersucht die Auferstehung Moses' als Zeichen für die Überwindung der zweidimensionalen Zeichenhaftigkeit.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen filmisches Theater, theatraler Film, Lars von Trier, Dogville, intermediale Beziehungen, Raum, Zeit, Schauspiel, Desillusionierung, Illusion, Imaginäres, Gnade, Zeichen, Rezeption.
- Arbeit zitieren
- Mathias Seeling (Autor:in), 2008, Unsichtbare Wände - Filmisches Theater und theatraler Film in Lars von Triers »Dogville«, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/127103