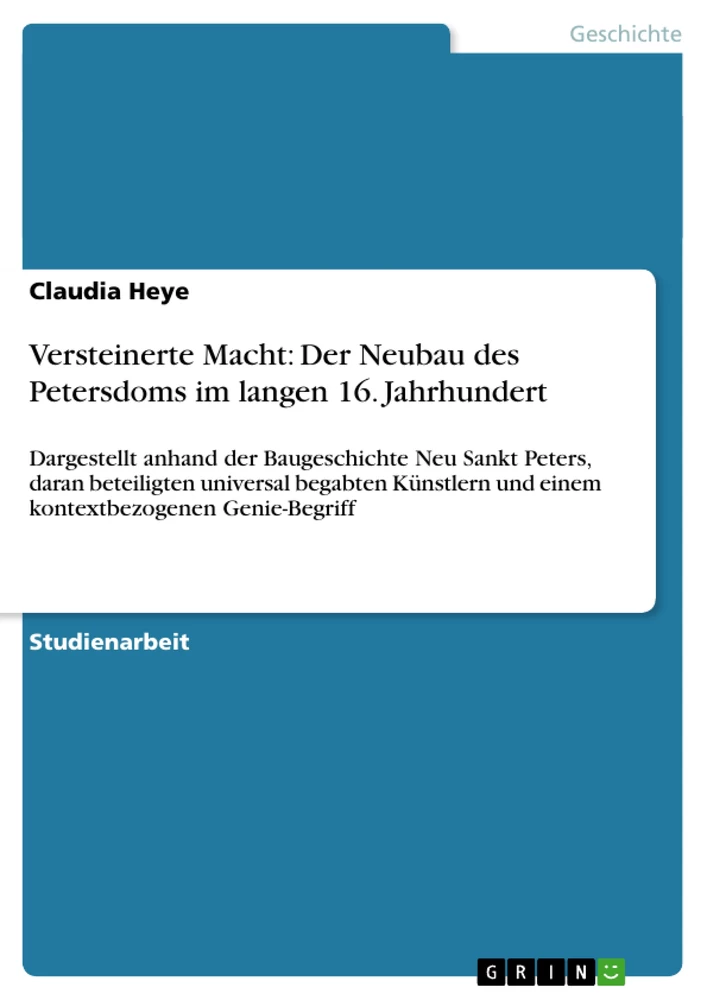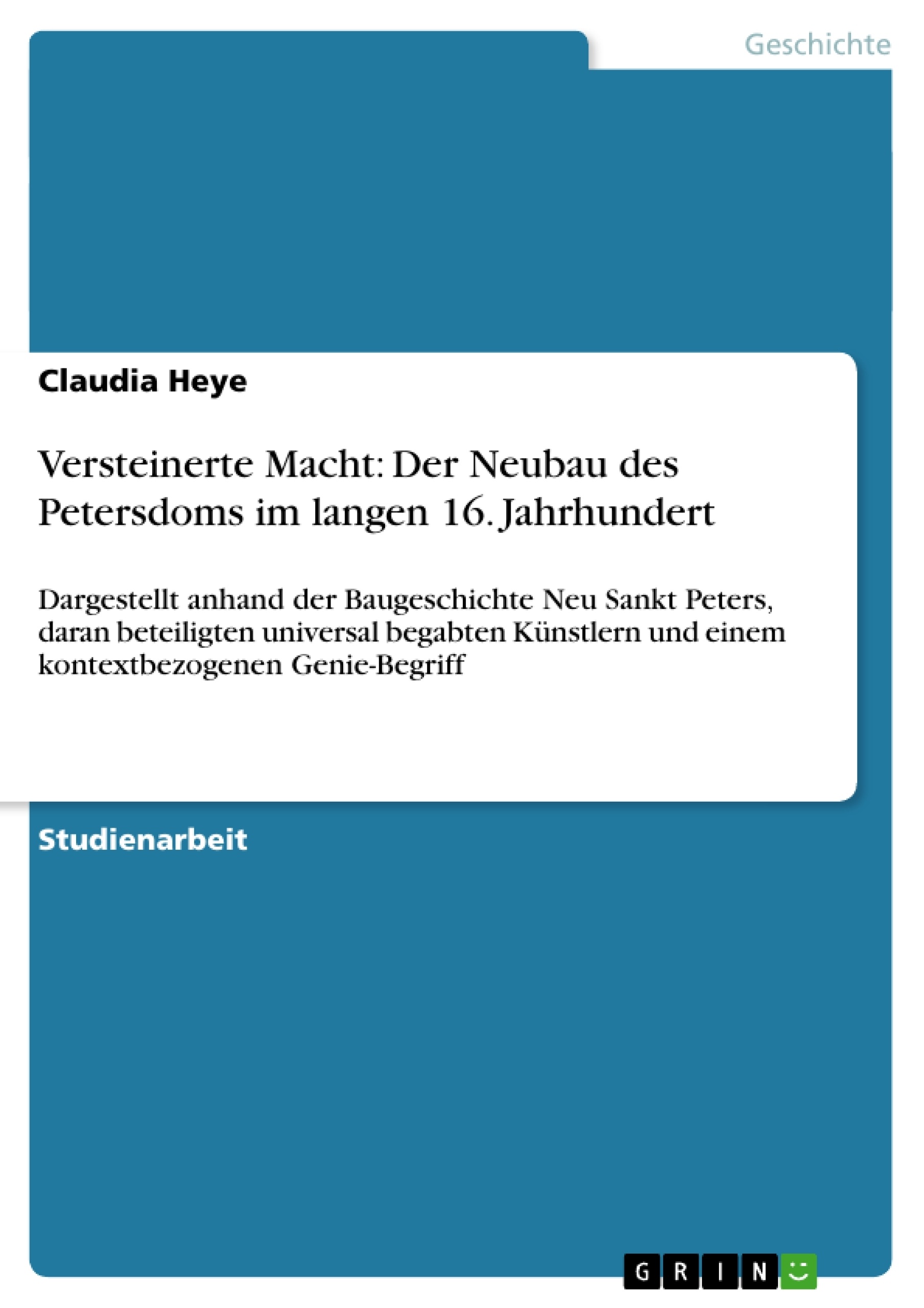Die Hausarbeit betrachtet die Baugeschichte Neu Sankt Peters von 1506 bis zur Gestaltung des Petersplatzes im 17. Jahrhundert. Ein Monument der Macht ist Sankt Peter nicht nur durch die Ausmaße seiner Formen, sondern auch durch die unsichtbaren, chaotischen Entscheidungsprozesse, die zu seiner heutigen Gestalt führten#. Die Architektur Neu Sankt Peters ist im Renaissancestil, die Innenräume sind Barock gestaltet. Der Innenausbau fand zu Berninis Zeit statt und wurde maßgeblich durch ihn geprägt. Heute ist Neu Sankt Peter ein Gesamtkunstwerk, das neben seiner reinen Funktion als Gebäude mit Symbolfunktionen überfrachtet ist. Das Gebäude dient als Gotteshaus der “Erinnerung, d.h. Verinnerlichung, Ins-Innere-Zurückrufen, sich zu Bewusstsein bringen“. Gleichzeitig verwendeten die Architekten eine Art kanonisierten Grundriss, d. h. die Kreuzform wurde bei jedem Entwurf variiert. Unter dem Aspekt der Machtentfaltung der jeweiligen Päpste werden Michel-angelos und Raffaels Tätigkeiten als Architekten und Künstler im Vatikan betrachtet, vornehmlich im Hinblick auf das Pontifikat Julius II.Michelangelo wird als Architekt für Neu Sankt Peter und als Bildhauer für das Grabmal Julius II dargestellt. Der Blick auf Raffael zeigt, dass dessen Rolle als Architekt für Neu Sankt Peter sich auf einen nicht ausgeführten Entwurf beschränkt, den er auf Wunsch Papst Leo X. fertigte. Seine Fresken im Vatikanspalast, die Stanzen, hatten großen Einfluss auf nachfolgende Künstlergenerationen. Michelangelo und Raffael haben durch Ihre Werke fast ort- und zeitgleich Weltruhm erlangt und galten schon zu Lebzeiten als Genies. Ein verallgemeinernder Geniebegriff ist dennoch nicht haltbar, da dieser Begriff zeit- und kontextabhängig ist. Im 15./16. Jahrhundert war die Auftragsvergabe für Kunstwerke oder Bauvorhaben immer an das jeweilige Pontifikat und die Vorlieben des Papstes geknüpft. Kunstwerke waren politisch motiviert. Ein neuer Papst konnte sich nur vom Vorgänger absetzen indem er prächtigere Werke schuf und auf andere Künstler zurückgriff. Anhand einer Definition des Geniebegriffs soll gezeigt werden, dass die Verwendung und Bedeutung dieses Begriffs, Wandlungen unterworfen ist, die im Zeitgeschmack und in den politischen Bedingungen zu suchen sind. Aber es sind diese jeweiligen politischen Bedingungen, die die Entstehung und Förderung eines Genies erst ermöglichen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Neubau St. Peter
- Die Baugeschichte von 1506-1626: von Julius II. (1503-13) bis Urban VIII. (1623-44)
- Die Innenausstattung des Petersdoms: Berninis prägender Einfluss
- Michelangelo und Raffael
- Konkurrenz und Auftraggeber
- Raffaels Stanzen
- Michelangelo und das Drama um das Grabmal Julius II.
- Der Geniebegriff
- Sprachliche Wurzeln und Bedeutungen des Geniebegriffs
- Der Wandel des künstlerischen Schaffensbegriffs in der Renaissance
- Vom Genie-Kult des 19. Jahrhunderts zum heutigen Genie-Begriff
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Baugeschichte des neuen St. Peterdoms von 1506 bis zur Gestaltung des Petersplatzes im 17. Jahrhundert. Der Fokus liegt auf der Architektur im Renaissancestil und der barocken Innenausstattung, insbesondere unter dem Einfluss Berninis. Die Arbeit beleuchtet auch die Rolle von Michelangelo und Raffael als Künstler und Architekten im Vatikan während des Pontifikats von Julius II. und untersucht den Wandel des Geniebegriffs im historischen Kontext.
- Die Baugeschichte des neuen St. Peterdoms und die Herausforderungen der Bauherren und Architekten.
- Die künstlerischen und architektonischen Beiträge Michelangelos und Raffaels.
- Der Einfluss des jeweiligen Papsttums auf die Gestaltung des Doms.
- Die Entwicklung des Geniebegriffs in der Renaissance und seine Bedeutung im Kontext der Kunstproduktion.
- Die politische und wirtschaftliche Bedeutung des Baus im Kontext der damaligen Zeit.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und beschreibt den Fokus auf die Baugeschichte des neuen St. Peterdoms, die architektonischen Stile und die Rolle bedeutender Künstler wie Michelangelo und Raffael. Sie hebt die politische und symbolische Bedeutung des Baus hervor und kündigt die Untersuchung des Geniebegriffs an.
1. Neubau Sankt Peter: Dieses Kapitel beschreibt die Baugeschichte des neuen St. Peterdoms von 1506 bis 1626, beleuchtet die Herausforderungen wie Geldmangel und Statikprobleme und zeigt die Beiträge verschiedener Päpste und Architekten wie Bramante, Raffael und Michelangelo. Es wird die ständige Anpassung der Baupläne an die wechselnden Wünsche der Päpste und die langwierige Bauzeit von 120 Jahren herausgestellt. Die unterschiedlichen Entwürfe und Stilrichtungen – vom Zentralbau bis zum Langhaus – werden erläutert und in den Kontext des politischen und religiösen Klimas der Zeit gestellt.
2. Michelangelo und Raffael: Dieses Kapitel analysiert die Rollen Michelangelos und Raffaels im Bauprojekt und im künstlerischen Leben des Vatikans während des Pontifikats von Julius II. Es werden die Konkurrenz zwischen den beiden Künstlern, ihre jeweiligen Beiträge und der Einfluss ihrer Werke auf nachfolgende Generationen beleuchtet. Der Fokus liegt auf Michelangelos Rolle als Architekt und Bildhauer und auf Raffaels Fresken in den Stanzen, die einen großen Einfluss auf die Kunstgeschichte hatten.
3. Der Geniebegriff: Das Kapitel befasst sich mit dem Wandel des Geniebegriffs von seinen sprachlichen Wurzeln bis zum 19. Jahrhundert. Es analysiert die zeitliche und kontextabhängige Bedeutung dieser Bezeichnung und stellt die Verbindung zwischen der Auftragsvergabe an Künstler und die politischen Ambitionen der Päpste heraus. Die Arbeit zeigt auf, dass der „Genie“-Status stark von den politischen und gesellschaftlichen Gegebenheiten seiner Zeit abhängig war und dass die Förderung von „Genies“ auch ein politisches Instrument war.
Schlüsselwörter
St. Peter, Baugeschichte, Renaissance, Barock, Michelangelo, Raffael, Bramante, Bernini, Papsttum, Geniebegriff, Architektur, Kunstgeschichte, Politik, Religion, Macht.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Neubau St. Peter, Michelangelo, Raffael und der Geniebegriff
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Baugeschichte des neuen St. Peterdoms von 1506 bis zum 17. Jahrhundert, konzentriert sich auf die Architektur der Renaissance und die barocke Innenausstattung, insbesondere unter Berninis Einfluss. Sie beleuchtet die Rollen Michelangelos und Raffaels im Vatikan unter Julius II. und analysiert den Wandel des Geniebegriffs im historischen Kontext.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt die Baugeschichte des St. Peterdoms, einschließlich der Herausforderungen und der Beiträge verschiedener Päpste und Architekten. Sie analysiert die künstlerischen und architektonischen Leistungen Michelangelos und Raffaels, den Einfluss des Papsttums auf die Gestaltung des Doms, die Entwicklung des Geniebegriffs in der Renaissance und seine Bedeutung für die Kunstproduktion sowie die politische und wirtschaftliche Bedeutung des Bauprojekts.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit gliedert sich in eine Einleitung, drei Hauptkapitel (Neubau St. Peter, Michelangelo und Raffael, Der Geniebegriff) und eine Schlussbetrachtung. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt des Themas, wie die Baugeschichte, die künstlerischen Beiträge der genannten Künstler und die historische Entwicklung des Geniebegriffs.
Welche Rolle spielen Michelangelo und Raffael in der Hausarbeit?
Michelangelo und Raffael werden als zentrale Künstlerfiguren im Kontext des Neubaus St. Peters und des künstlerischen Lebens im Vatikan unter Julius II. analysiert. Die Hausarbeit untersucht ihre Beiträge zur Architektur und Kunst, die Konkurrenz zwischen ihnen und den Einfluss ihrer Werke auf die Kunstgeschichte.
Wie wird der "Geniebegriff" in der Hausarbeit behandelt?
Die Hausarbeit untersucht den Wandel des Geniebegriffs von seinen sprachlichen Wurzeln bis ins 19. Jahrhundert. Sie analysiert die Bedeutung dieses Begriffs im historischen Kontext, seine Verbindung zur Auftragsvergabe an Künstler und die politischen Ambitionen der Päpste, und zeigt auf, dass der "Genie"-Status stark von politischen und gesellschaftlichen Gegebenheiten abhängig war.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: St. Peter, Baugeschichte, Renaissance, Barock, Michelangelo, Raffael, Bramante, Bernini, Papsttum, Geniebegriff, Architektur, Kunstgeschichte, Politik, Religion, Macht.
Welche konkreten Aspekte der Baugeschichte des St. Peterdoms werden beleuchtet?
Die Hausarbeit beleuchtet die Herausforderungen während des Baus (Geldmangel, Statikprobleme), die Beiträge verschiedener Päpste und Architekten (Bramante, Raffael, Michelangelo), die ständige Anpassung der Baupläne und die lange Bauzeit (120 Jahre). Die verschiedenen Entwürfe und Stilrichtungen werden im Kontext des politischen und religiösen Klimas der Zeit erläutert.
Wie wird der Einfluss des Papsttums auf den Bau dargestellt?
Die Hausarbeit untersucht den Einfluss der jeweiligen Päpste auf die Gestaltung des Doms, die wechselnden Wünsche und Prioritäten und wie diese die Architektur und den künstlerischen Stil beeinflusst haben. Der Zusammenhang zwischen politischen Ambitionen und der Kunstförderung wird deutlich gemacht.
- Quote paper
- Claudia Heye (Author), 2009, Versteinerte Macht: Der Neubau des Petersdoms im langen 16. Jahrhundert, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/127139