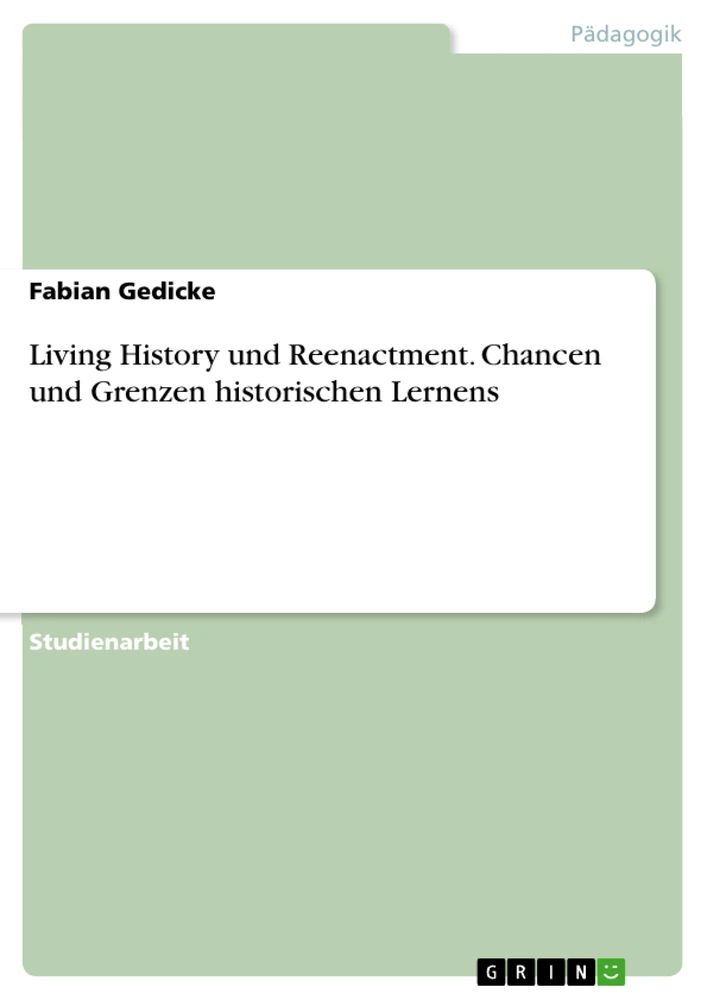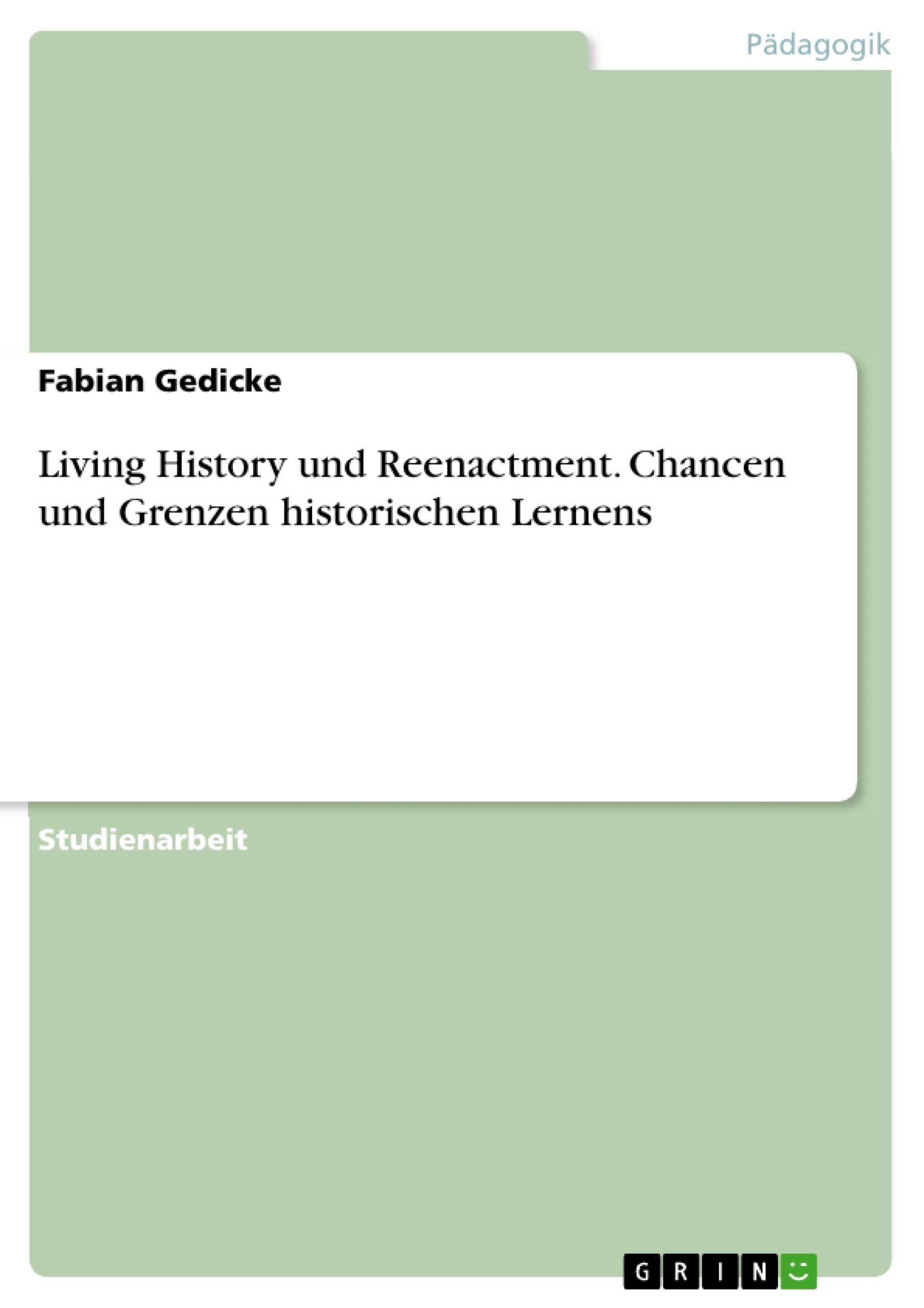Inwieweit sind Living History-Darstellungen und Reenactments für das historische Lernen im Generellen und besonders für den Lebensraum Schule förderlich?
Die vorliegende Arbeit verläuft nach einer klaren Struktur. Vorbereitend für die Auseinandersetzung mit Living History-Angeboten sollen im Hauptteil zunächst Definitionsangebote für die Begriffe Kultur sowie Materielle Kultur gegeben werden.
Darauf aufbauend soll als spezieller Aspekt die authentifizierende Funktion, die Bedeutung für die Materielle Kultur sowie die Wirksamkeit von Dingen theoretisch beleuchtet werden.
Eine Typologie von Living History-Formen ist für die anschließende Pro- und Kontradiskussion, welche in Teilen schon auf pädagogische Aspekte abzielt, sinnvoll und wird durch die Thesen sowie eine erklärende Abbildung von Markus Walz aufgeführt.
Als besonderes Ereignis innerhalb von Living-History-Darstellungen soll ebenfalls auf das Phänomen des Reenactments eingegangen werden. Eine Auflistung von Vorteilen, Nachteilen und Widersprüchen soll auch hier gegeben werden.
Aus den bisherigen Erkenntnissen soll dann im letzten Teil untersucht werden, welche Konsequenzen dies für den Lebensraum Schule und damit das historische Lernen hat. Für diese Analyse soll das niedersächsische Kerncurriculum für das Fach Geschichte an Gymnasien der Sek I. hinzugezogen werden.
Das Fazit stellt die wichtigsten Ergebnisse dieser Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf mögliche weitere Forschungsfragen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hinführung und Fragestellung
- Vorgehensweise & Methodik
- Hauptteil
- Materielle Kultur
- Dinge
- Living History
- Definitionsversuche
- Typologie
- Für und Wider
- Reenactment
- Lebensraum Schule
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Chancen und Grenzen des historischen Lernens im Kontext von Living History-Darstellungen und Reenactments, insbesondere im Hinblick auf ihre pädagogische Bedeutung für den Lebensraum Schule.
- Die Relevanz von materieller Kultur für das Verständnis historischer Sachverhalte
- Die vielschichtigen Möglichkeiten und Herausforderungen von Living History-Darstellungen im historischen Lernen
- Die Bedeutung des Reenactments als spezielle Form der Living History
- Die Implikationen für die Gestaltung von historischem Lernen im schulischen Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des historischen Lernens im Kontext von Living History-Darstellungen ein und stellt die Forschungsfrage nach deren Bedeutung für den schulischen Geschichtsunterricht. Kapitel 2.1 beleuchtet die Rolle der materiellen Kultur für das Verständnis historischer Sachverhalte und betrachtet die authentifizierende Funktion von Gegenständen. Kapitel 2.2 bietet eine typologische Einordnung von Living History-Formen und erörtert die Vor- und Nachteile dieser Form des historischen Lernens. Kapitel 2.3 fokussiert auf das Phänomen des Reenactments und analysiert seine spezifischen Eigenschaften. Kapitel 2.4 untersucht die Relevanz von Living History-Darstellungen und Reenactments für den schulischen Geschichtsunterricht und diskutiert die Implikationen für die Gestaltung des Lernprozesses.
Schlüsselwörter
Living History, Reenactment, historisches Lernen, Materielle Kultur, Schulgeschichte, Didaktik, authentische Erfahrung, Geschichtskultur.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Living History und Reenactment?
Living History fokussiert auf die Darstellung des Alltagslebens, während Reenactment oft die konkrete Wiederaufführung historischer Ereignisse (z. B. Schlachten) bezeichnet.
Welche Chancen bietet Living History für den Geschichtsunterricht?
Es ermöglicht ein haptisches und emotionales Lernen durch materielle Kultur, was das Interesse der Schüler an Geschichte steigern kann.
Was sind die Grenzen von Reenactment in der Schule?
Kritikpunkte sind die Gefahr der emotionalen Überwältigung, mangelnde wissenschaftliche Distanz und eine mögliche Verkürzung komplexer historischer Fakten.
Was versteht man unter „Materieller Kultur“?
Darunter fallen alle physischen Objekte und Dinge, die durch ihre authentifizierende Funktion helfen, historische Lebenswelten begreifbar zu machen.
Wie wird Living History im niedersächsischen Kerncurriculum bewertet?
Die Arbeit untersucht, inwieweit diese Methoden die Anforderungen an das historische Lernen in der Sekundarstufe I an Gymnasien erfüllen.
- Arbeit zitieren
- Fabian Gedicke (Autor:in), 2021, Living History und Reenactment. Chancen und Grenzen historischen Lernens, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1271913