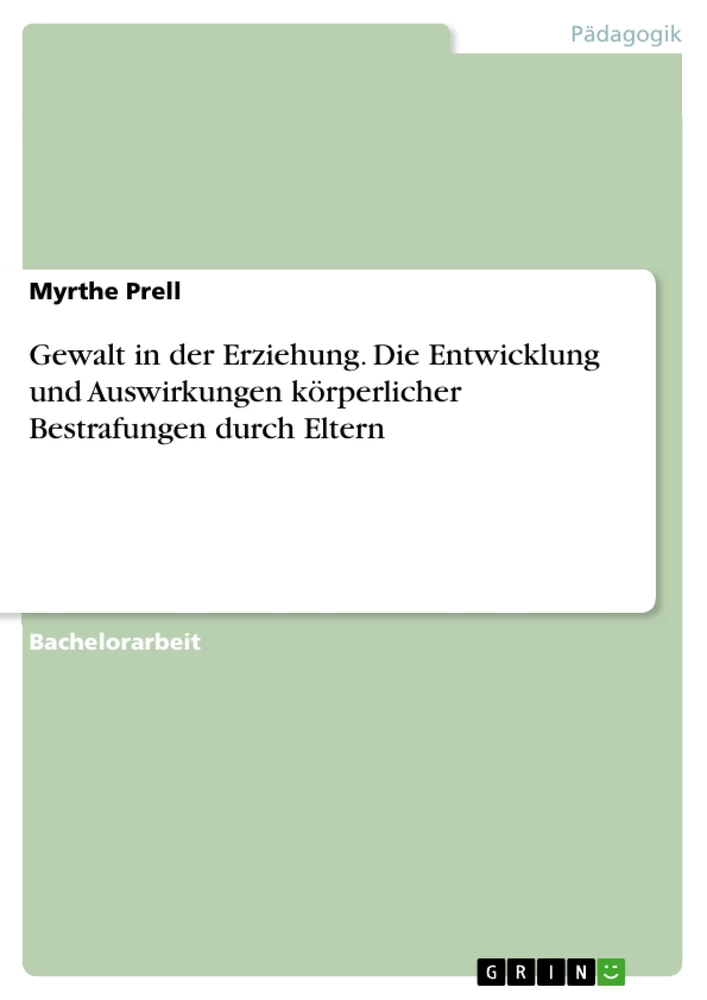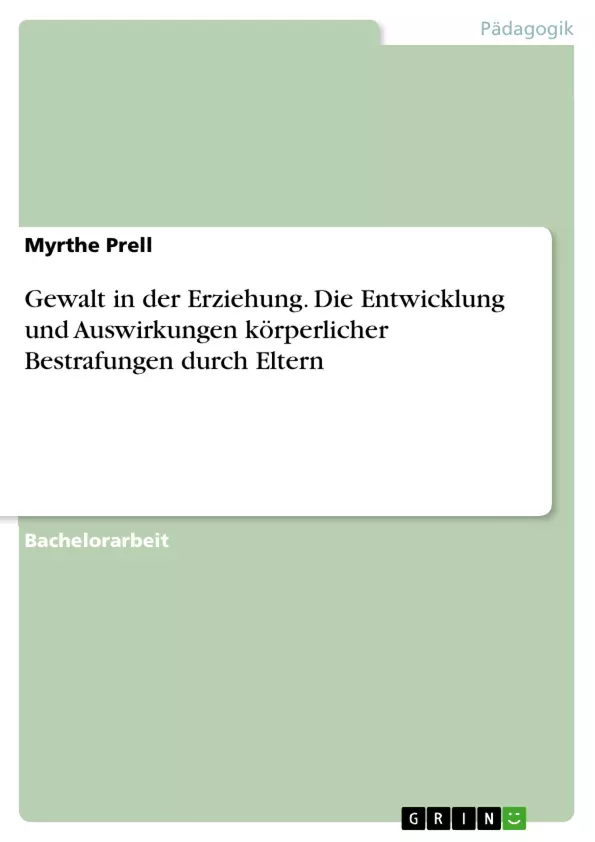Das Ziel dieser Arbeit ist es, körperliche Gewalt in der Erziehung aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten sowie Zusammenhänge und Entwicklungsprozesse aufzuzeigen, wofür im Folgenden auf die geschichtliche Entwicklung, die Entstehungsbedingungen, die Folgen und Möglichkeiten der Prävention und Intervention von Gewalt eingegangen wird.
Im zweiten Kapitel wird zunächst ein Überblick über die Komplexität des Gewaltbegriffes gegeben. Der geschichtliche Hintergrund von Gewalt in der Erziehung wird im dritten Kapitel dieser Arbeit beschrieben, um den gesellschaftlichen Wertewandel von der legitimen Züchtigung eines Kindes bis hin zum Verbot jeglicher Gewalt in der Erziehung nachvollziehen zu können. Hierbei werden verstärkt die letzten hundert Jahre in den Blick genommen. Darauffolgend werden die Entstehungsbedingungen von körperlicher Gewalt in der Erziehung betrachtet. Dabei werden unterschiedliche Erklärungsansätze herangezogen, um die Entwicklung von Gewalt aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Perspektiven zu untersuchen. Im fünften Kapitel werden die Auswirkungen körperlicher Gewalt behandelt. Zuletzt wird untersucht, wie insbesondere der erlernbare Schutzfaktor „Erziehungskompetenz“ dazu beitragen kann, der Entstehung von Gewalt in der Erziehung vorzubeugen. Zudem wird anhand verschiedener Präventions- und Interventionsmaßnahmen darauf eingegangen, wie zukünftig Gewalt in der Erziehung verhindert oder abgewendet werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung.
- Erläuterungen zum Gewaltbegriff.
- Rechtliche und geschichtliche Entwicklung von körperlicher Bestrafung in der Erziehung
- Wandel der Erziehungspraktiken im Laufe des 20. Jahrhunderts…......
- Konsequenzen des Gesetzes zur Ächtung der Gewalt in der Erziehung zu Beginn des 21. Jahrhunderts........
- Erklärungsansätze für die Entstehung aggressiver Verhaltensweisen und gewalttätigen Handelns
- Banduras sozialkognitive Theorie des Lernens am Modell als Erklärungsansatz für das Erlernen aggressiver Verhaltensweisen im familiären Umfeld..\n
- Multikausale Erklärungsansätze für die Entstehung von Gewalt......
- Auswirkungen von Gewalt in der Erziehung
- Körperliche Bestrafung als Disziplinierungsmittel in der wissenschaftlichen Diskussion......
- Kurz- und langfristige Folgen von Gewalterfahrungen in der Kindheit.
- Einfluss von Schutzfaktoren
- Präventions- und Interventionsansätze
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht körperliche Gewalt in der Erziehung aus verschiedenen Perspektiven. Sie beleuchtet die geschichtliche Entwicklung, die Entstehungsbedingungen, die Folgen und Möglichkeiten der Prävention und Intervention von Gewalt.
- Die Arbeit betrachtet die rechtliche und geschichtliche Entwicklung von körperlicher Bestrafung in der Erziehung.
- Sie untersucht Erklärungsansätze für die Entstehung von Gewalt in der Erziehung, insbesondere die sozialkognitive Theorie Albert Banduras und multikausale Erklärungsmodelle.
- Die Arbeit analysiert die Auswirkungen von Gewalt in der Erziehung, einschließlich der kurz- und langfristigen Folgen für Kinder.
- Schließlich werden Präventions- und Interventionsansätze zur Vermeidung von Gewalt in der Erziehung diskutiert.
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der körperlichen Gewalt in der Erziehung ein und erläutert die Zielsetzung der Arbeit.
- Kapitel 2: Erläuterungen zum Gewaltbegriff: Dieses Kapitel definiert die Begriffe Erziehung und Gewalt und untersucht die Komplexität des Gewaltbegriffs. Dabei wird insbesondere auf die Definition der Weltgesundheitsorganisation eingegangen.
- Kapitel 3: Rechtliche und geschichtliche Entwicklung von körperlicher Bestrafung in der Erziehung: Dieses Kapitel beschreibt die geschichtliche Entwicklung der körperlichen Bestrafung als Erziehungsmittel und zeichnet den Wandel des gesellschaftlichen Wertewandels nach. Der Fokus liegt auf den letzten hundert Jahren.
- Kapitel 4: Erklärungsansätze für die Entstehung aggressiver Verhaltensweisen und gewalttätigen Handelns: Dieses Kapitel betrachtet die Entstehung von körperlicher Gewalt in der Erziehung und analysiert verschiedene Erklärungsansätze, darunter die sozialkognitive Theorie Albert Banduras und multikausale Modelle.
- Kapitel 5: Auswirkungen von Gewalt in der Erziehung: Dieses Kapitel analysiert die Auswirkungen von körperlicher Gewalt auf Kinder und untersucht die kurz- und langfristigen Folgen von Gewalterfahrungen in der Kindheit. Außerdem wird der Einfluss von Schutzfaktoren betrachtet.
- Kapitel 6: Präventions- und Interventionsansätze: Dieses Kapitel untersucht Präventions- und Interventionsansätze zur Vermeidung von Gewalt in der Erziehung und geht insbesondere auf den Schutzfaktor "Erziehungskompetenz" ein.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen körperliche Gewalt in der Erziehung, rechtliche und geschichtliche Entwicklung, Erklärungsansätze, Auswirkungen, Prävention und Intervention. Wichtige Schlüsselwörter sind: körperliche Bestrafung, Gewaltbegriff, Erziehungspraktiken, sozialkognitive Theorie, multikausale Erklärungsmodelle, Schutzfaktoren, Erziehungskompetenz.
Häufig gestellte Fragen
Wie hat sich die rechtliche Lage zur körperlichen Bestrafung in Deutschland entwickelt?
Die Arbeit zeichnet den Wandel von der einst legitimen Züchtigung bis hin zum vollständigen Verbot jeglicher Gewalt in der Erziehung zu Beginn des 21. Jahrhunderts nach.
Welche Rolle spielt Banduras Theorie in diesem Kontext?
Albert Banduras sozialkognitive Theorie des Lernens am Modell erklärt, wie aggressive Verhaltensweisen im familiären Umfeld erlernt und weitergegeben werden.
Was sind die langfristigen Folgen von Gewalt in der Kindheit?
Gewalterfahrungen können schwerwiegende körperliche und psychische Auswirkungen haben, die bis ins Erwachsenenalter reichen und die soziale Entwicklung beeinträchtigen.
Was versteht man unter dem Schutzfaktor "Erziehungskompetenz"?
Es handelt sich um erlernbare Fähigkeiten der Eltern, die dazu beitragen, Konflikte gewaltfrei zu lösen und die Entstehung von Gewalt in der Familie zu verhindern.
Welche Präventionsansätze werden diskutiert?
Die Arbeit untersucht verschiedene Maßnahmen der Prävention und Intervention, die darauf abzielen, Gewalt in der Erziehung frühzeitig abzuwenden.
- Quote paper
- Myrthe Prell (Author), 2022, Gewalt in der Erziehung. Die Entwicklung und Auswirkungen körperlicher Bestrafungen durch Eltern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1271955