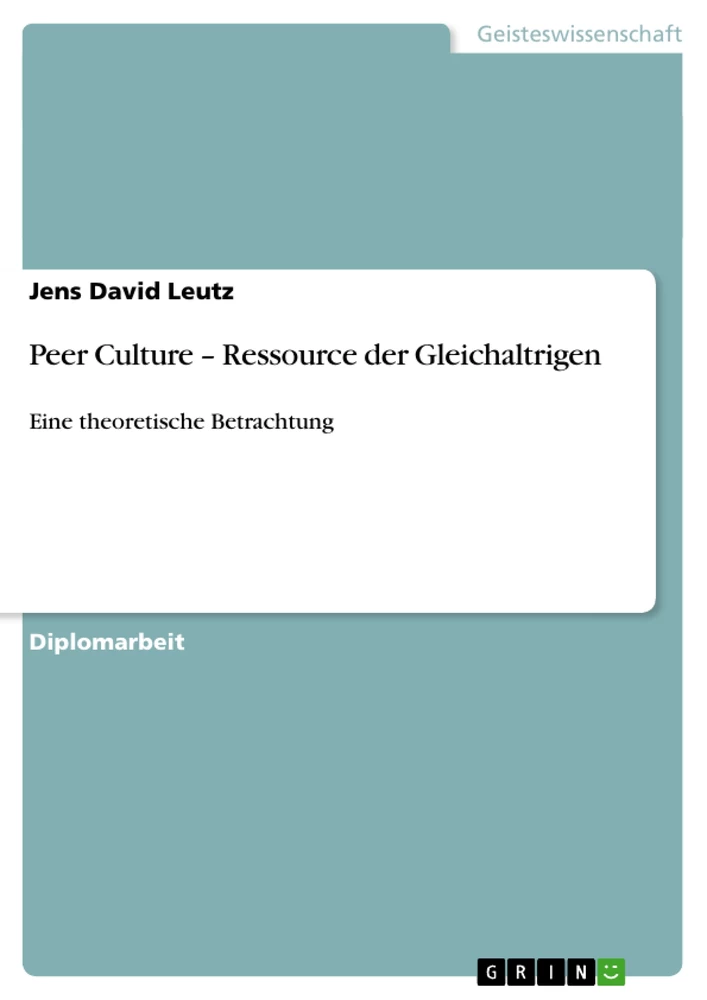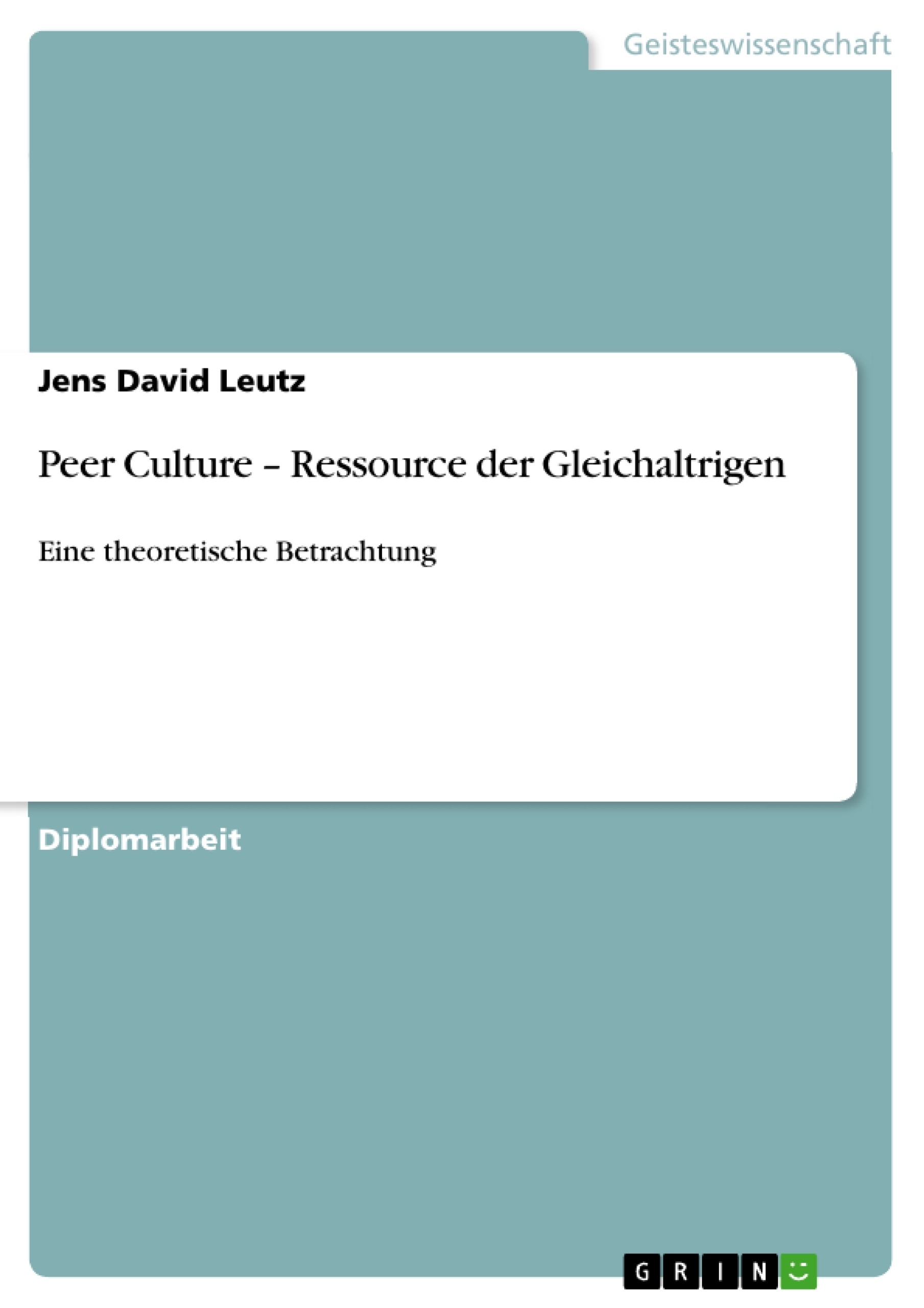... Diese Diplomarbeit soll Aufschluss darüber geben, aus welchen Gründen eine solche Kultur unter Gleichaltrigen entsteht, und welche Mittel sie benötigt, um einem jungen Menschen als fruchtbar und fördernd zur Seite zu stehen.
Im folgenden Absatz wird das Vorgehen dabei aufgegliedert und kurz auf die jeweiligen Ziele der Passagen eingegangen, damit ein Überblick über das Gesamtwerk entsteht. Im zweiten Kapitel sollen die grundlegenden Begrifflichkeiten geklärt werden, wodurch der Leser dieselbe Ausgangslage für die Argumentationen des Autors erhalten soll. Hierzu ist es unumgänglich die im Titel der Diplomarbeit stehenden Begriffe „Peer“, „Culture“ und „Ressource“ näher zu bestimmen. Der dritte Abschnitt widmet sich der Geschichte der Gleichaltrigengruppe, deren Bedeutung und Funktion schon seit der Antike bekannt ist. Bereits Platon verweist auf die Bedeutung der Gruppe, die neben der Familie als weitere Erziehungsinstanz einen sehr hohen Grad an Einfluss besitzt. Weiter wird auf primitive und moderne Gesellschaftsformen eingegangen, da diese Peer Gruppen in einem nicht unmerklichen Maße beeinflussen. Der darauf folgende Teil soll aus multidisziplinärer Sicht die Funktionen der Gleichaltrigengruppe erhellen. Zu Wort kommen dabei die Wissenschaften der pädagogischen Anthropologie, die Sozialpsychologie, die Entwicklungspsychologie und abschließend die Soziologie.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Begriffsklärung
- 2.1 „Peer“ und „Peer Group“
- 2.2 „Culture“
- 2.3 „Ressource“
- 3 Geschichtlicher Abriss
- 3.1 Primitive Gesellschaften
- 3.2 Moderne Gesellschaften
- 3.3 Peer Group Forschung heute
- 4 Wissenschaftliche Disziplinen
- 4.1 Pädagogische Anthropologie
- 4.1.1 Übertragung
- 4.2 Sozialpsychologie
- 4.2.1 Konformität
- 4.3 Entwicklungspsychologie
- 4.3.1 Entwicklungsaufgaben
- 4.4 Soziologie
- 4.5 Zusammenfassung
- 4.1 Pädagogische Anthropologie
- 5 Peer Culture
- 5.1 Zur Terminologie von „Peer ...“
- 5.2 Peer Counseling
- 5.3 Peer Education
- 5.4 Peer Projekte
- 5.5 Peer Support
- 5.6 Zusammenfassung
- 5.7 Positive Peer Culture (PPC)
- 5.7.1 Begriffliche Klärung
- 5.7.2 Grundlagen
- 5.7.2.1 Eine Prosoziale Normenkultur
- 5.7.2.2 Die Grenzziehung und Konfrontation
- 5.7.2.3 Die Verbindlichkeit des Unverbindlichen
- 5.7.2.4 Die Verantwortung
- 5.7.2.4.1 Die Umkehr der Verantwortung
- 5.7.2.4.2 Die Übernahme von Verantwortung durch „Checking“ und „Confronting“
- 5.7.2.5 Positive Peer Pressure
- 5.7.2.6 Die Corporate Identity
- 5.7.3 Zentrale Elemente der Positive Peer Culture
- 5.7.3.1 Die Macht der Peers
- 5.7.3.2 Die Stärke des Geläuterten
- 5.7.3.3 Das Klima der Veränderung
- 5.7.3.4 Das soziale Training
- 5.7.4 Die Ziele
- 5.7.4.1 Das positive Selbstwertgefühl
- 5.7.4.2 Die Vermittlung grundlegender Werte
- 5.7.4.3 Die Förderung prosozialen Verhaltens
- 5.7.4.4 Die Veränderung des moralischen Bewusstseins
- 5.7.4.5 Die Mündigkeit anstatt der Anpassung
- 6 Partizipation und Empowerment
- 6.1 Partizipation
- 6.1.1 Definition
- 6.1.2 Rechtliche Grundlagen
- 6.1.3 „the ladder of participation“
- 6.2 Empowerment
- 6.2.1 Definition
- 6.2.2 Die Bündelung der Lernprozesse
- 6.2.3 Die vier Ebenen des Empowerment
- 6.3 Zusammenfassung
- 6.1 Partizipation
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Peer Culture als Ressource für Gleichaltrige. Sie beleuchtet die Entstehung und die notwendigen Bedingungen für eine positive und förderliche Peer Culture, insbesondere im Kontext der Sozialarbeit mit jungen Menschen.
- Begriffliche Klärung von „Peer“, „Culture“ und „Ressource“
- Historische Entwicklung und Bedeutung von Peer Groups
- Multidisziplinäre Betrachtung der Funktionen von Peer Groups (Pädagogische Anthropologie, Sozialpsychologie, Entwicklungspsychologie, Soziologie)
- Positive Peer Culture (PPC) und deren zentrale Elemente
- Partizipation und Empowerment im Kontext der Peer Culture
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Peer Culture als Ressource für Gleichaltrige ein und beschreibt den Aufbau und die Ziele der Arbeit. Sie verdeutlicht die Notwendigkeit einer gezielten Förderung dieser Kultur und skizziert den weiteren Verlauf der Arbeit, wobei die einzelnen Kapitel und deren thematische Schwerpunkte kurz umrissen werden. Der Bezug auf Albert Schweitzer unterstreicht die Notwendigkeit von Fürsorge und Engagement, um positive Entwicklungen zu fördern.
2 Begriffsklärung: Dieses Kapitel klärt die zentralen Begriffe „Peer“, „Peer Group“, „Culture“ und „Ressource“. Es legt die semantische Grundlage für die nachfolgende Argumentation und stellt sicher, dass der Leser ein gemeinsames Verständnis der verwendeten Fachbegriffe hat. Diese präzise Definition ist unerlässlich für eine fundierte Analyse der Peer Culture.
3 Geschichtlicher Abriss: Der geschichtliche Abriss verfolgt die Bedeutung von Peer Groups von primitiven bis hin zu modernen Gesellschaften. Er zeigt, wie die Rolle und der Einfluss von Peer Groups über verschiedene Epochen hinweg betrachtet wurden und wie sich die Forschung zu diesem Thema entwickelt hat. Platons Hinweis auf die Bedeutung von Peer Groups neben der Familie wird als historisches Beispiel angeführt. Der Abschnitt hebt die kontinuierliche Relevanz von Gleichaltrigengruppen hervor und stellt den Kontext für die aktuelle Forschung dar.
4 Wissenschaftliche Disziplinen: Dieser Abschnitt beleuchtet die Peer Group aus multidisziplinärer Perspektive. Pädagogische Anthropologie, Sozialpsychologie, Entwicklungspsychologie und Soziologie liefern jeweils spezifische Einblicke in die Funktion und Bedeutung von Peer Groups. Die Analyse der menschlichen Bedürfnisse (Anthropologie), der Konformität (Sozialpsychologie), der Entwicklungsaufgaben (Entwicklungspsychologie) und der gesellschaftlichen Rollen (Soziologie) bietet ein umfassendes Verständnis der Dynamiken innerhalb von Peer Groups.
5 Peer Culture: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Peer Culture und insbesondere auf die „Positive Peer Culture (PPC)“. Es erläutert verschiedene Formen der Peer-Arbeit (Peer Counseling, Peer Education etc.) und definiert die Grundlagen von PPC. Die zentralen Elemente von PPC werden detailliert beschrieben, einschließlich der Bedeutung von prosozialem Verhalten, der Förderung von Selbstwertgefühl und der Entwicklung moralischer Urteilsfähigkeit. Der Abschnitt betont die positive Beeinflussung durch Gleichaltrige (Positive Peer Pressure) und die Übernahme von Verantwortung durch die Mitglieder der Gruppe.
6 Partizipation und Empowerment: Dieses Kapitel behandelt die Konzepte der Partizipation und des Empowerment im Kontext der Peer Culture. Es definiert beide Begriffe, beleuchtet rechtliche Grundlagen der Partizipation und beschreibt verschiedene Ebenen des Empowerments. Der Zusammenhang zwischen Partizipation, Empowerment und der positiven Entwicklung junger Menschen innerhalb von Peer Groups wird deutlich herausgestellt.
Schlüsselwörter
Peer Culture, Positive Peer Culture (PPC), Peer Group, Gleichaltrige, Partizipation, Empowerment, Sozialpsychologie, Entwicklungspsychologie, Pädagogische Anthropologie, Soziologie, Prosoziales Verhalten, Selbstwertgefühl, Moralentwicklung, Jugend, Sozialarbeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Peer Culture als Ressource für Gleichaltrige"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Diplomarbeit untersucht die Peer Culture als Ressource für Gleichaltrige. Sie beleuchtet die Entstehung und notwendigen Bedingungen für eine positive und förderliche Peer Culture, insbesondere im Kontext der Sozialarbeit mit jungen Menschen. Die Arbeit beinhaltet eine Begriffsklärung, einen historischen Abriss, eine multidisziplinäre Betrachtung aus pädagogisch-anthropologischer, sozialpsychologischer, entwicklungspsychologischer und soziologischer Perspektive, eine detaillierte Auseinandersetzung mit der Positiven Peer Culture (PPC) und deren zentralen Elementen, sowie eine Betrachtung von Partizipation und Empowerment im Kontext der Peer Culture.
Welche Begriffe werden geklärt?
Die Arbeit klärt die zentralen Begriffe „Peer“, „Peer Group“, „Culture“ und „Ressource“, um eine gemeinsame semantische Grundlage für die Analyse der Peer Culture zu schaffen.
Welchen historischen Abriss bietet die Arbeit?
Der historische Abriss verfolgt die Bedeutung von Peer Groups von primitiven bis hin zu modernen Gesellschaften und zeigt die Entwicklung der Forschung zu diesem Thema auf. Der Einfluss von Peer Groups über verschiedene Epochen wird beleuchtet.
Welche wissenschaftlichen Disziplinen werden einbezogen?
Die Arbeit betrachtet Peer Groups aus multidisziplinärer Perspektive, indem sie pädagogisch-anthropologische, sozialpsychologische, entwicklungspsychologische und soziologische Erkenntnisse integriert. Dies ermöglicht ein umfassendes Verständnis der Dynamiken innerhalb von Peer Groups.
Was ist Positive Peer Culture (PPC)?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Positive Peer Culture (PPC) und erläutert verschiedene Formen der Peer-Arbeit (Peer Counseling, Peer Education etc.). Die zentralen Elemente von PPC werden detailliert beschrieben, einschließlich der Bedeutung von prosozialem Verhalten, der Förderung von Selbstwertgefühl und der Entwicklung moralischer Urteilsfähigkeit. Die positive Beeinflussung durch Gleichaltrige (Positive Peer Pressure) und die Übernahme von Verantwortung werden hervorgehoben.
Wie werden Partizipation und Empowerment behandelt?
Die Arbeit behandelt die Konzepte der Partizipation und des Empowerment im Kontext der Peer Culture. Sie definiert beide Begriffe, beleuchtet rechtliche Grundlagen der Partizipation und beschreibt verschiedene Ebenen des Empowerments. Der Zusammenhang zwischen Partizipation, Empowerment und der positiven Entwicklung junger Menschen innerhalb von Peer Groups wird deutlich herausgestellt.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Peer Culture, Positive Peer Culture (PPC), Peer Group, Gleichaltrige, Partizipation, Empowerment, Sozialpsychologie, Entwicklungspsychologie, Pädagogische Anthropologie, Soziologie, Prosoziales Verhalten, Selbstwertgefühl, Moralentwicklung, Jugend, Sozialarbeit.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel unterteilt, die von einer Einleitung über die Begriffsklärung und einen historischen Abriss zu den wissenschaftlichen Disziplinen, der Peer Culture (inklusive PPC) und schließlich zu Partizipation und Empowerment führen. Jedes Kapitel bietet eine Zusammenfassung.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Peer Culture als Ressource und beleuchtet die Entstehung und notwendigen Bedingungen für eine positive und förderliche Peer Culture, insbesondere im Kontext der Sozialarbeit mit jungen Menschen.
- Quote paper
- Dipl.-Ing. (FH) Jens David Leutz (Author), 2007, Peer Culture – Ressource der Gleichaltrigen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/127238