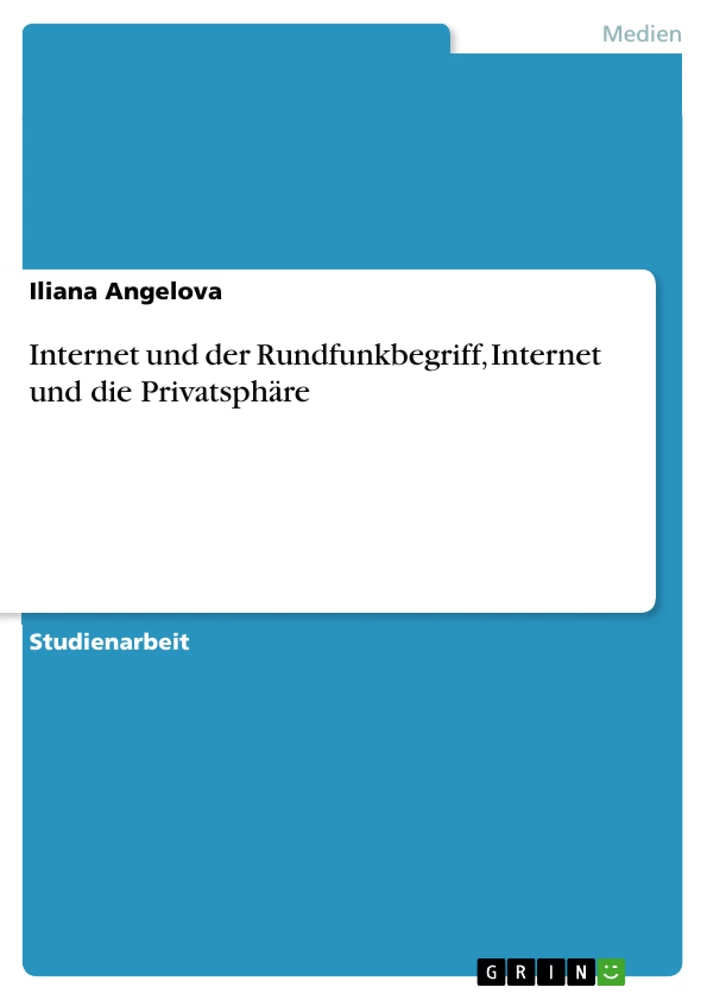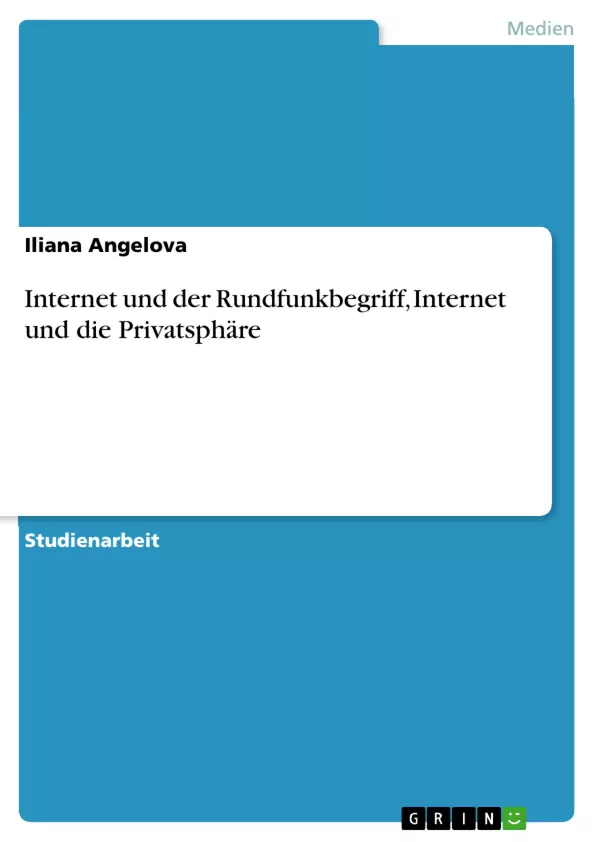Der Rundfunk hat eine integrierende Funktion für das Staatsganze. Er erfüllt eine öffentliche
Aufgabe und ist Medium und Faktor der öffentlichen Meinungsbildung Deshalb
ist seine Freiheit für eine funktionierende Demokratie äußerst wichtig.
Die Rundfunkfreiheit ist in der Bundesrepublik durch das Grundgesetz gewährleistet.
Art.5 GG schützt den gesamten Prozeß der individuellen und öffentlichen Meinungsbildung.
Dieses Grundrecht bezieht sich aber auf verschiedene Aspekte dieses Vorgangs.
Seine Kraft entfaltet sich dort, wo es sich tatsächlich um Rundfunk handelt. Bei den
elektronischen Medien war bisher klar zwischen Individual- und Massenkomunnikation
zu unterscheiden. Die rasante Entwicklung der Medientechnologien und die Digitalisierung
der Medien stellen aber neue Fragen. Wie weit und ob überhaupt die neuen Medien
dem Rundfunkbegriff zuzuordnen sind? Welche Folgen hätte so eine Zuordnung? Ist der
Schutzbereich der Rundfunkfreiheit, wie vom Bundesverfassungsgericht erläutert ist,
auf die neuen Medien (Internet, Pay-TV usw.) auszudehnen oder sind Grenzen zwischen
Rundfunk und ihnen zu ziehen?
Der Rundfunkbegriff nach dem Staatsvertrag:
„Rundfunk ist die für die Allgemeinheit bestimmte Veranstaltung und Verbreitung von
Darbietungen aller Art in Wort, in Ton und in Bild unter Benutzung elektromagnetischer
Schwingungen ohne Verbindungsleitung oder längs oder mittels eines Leiters.
Der Begriff schließt Darbietungen ein, die verschlüsselt verbreitet werden oder gegen
besonderes Entgelt empfangbar sind.“
Bei den neuen Medien geht es nicht nur um eine begriffliche Präzisierung. Die Zuordnung
eines digitalen Mediums zum Rundfunkbegriff hätte erhebliche Folgen. Wenn ein
Dienst nicht als Rundfunk zu verstehen ist, braucht er nicht alle organisatorischen und inhaltlichen Anforderungen des Rundfunkstaatsvertrages (z.B. Sicherung der Meinungsvielfalt)
und des Landesmediengesetzes erfüllen. In dem Fall würden die allgemeinen
Regelungen für eine wirtschaftliche Tätigkeit ausreichen (Hesse, 3). Die Definition
des Rundfunkbegriffes hat auch eine Auswirkung auf die Kompetenzverteilung
zwischen Bund und Länder. Sofern die neuen Medien als rein wirtschaftliche Betätigung
betrachtet werden und dieser Weise den Weg zu einer Deregulierung freimachen
wird, verlieren die Länder ihre Kompetenzen. Für Regelungen, soweit diese überhaupt
für erforderlich gehalten werden, ist dann der Bund und unter Umständen die EU zuständig. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Frage 1: Ist das Internet dem Rundfunkbegriff zuzurechnen?
- DIE INTEGRIERENDE FUNKTION DES RUNDFUNKS
- WARUM DER RUNDFUNK EINE POSITIVE ORDNUNG BRAUCHT?
- DAS DUALE RUNDFUNKSYSTEM UND DAS FRIEDLICHE GEMEINWESEN
- SIND DIE NEUEN MEDIEN DEM RUNDFUNKBEGRIFF ZUZURECHNEN?
- REPORTER OHNE GRENZEN: NO LIMITS FOR THE INTERNET?
- Frage 2: Ist die Privatsphäre im Imternet rechtlich geschützt?
- DIE PRIVATSPHÄRE UND DIE INTERESSEN DER MEDIEN
- WESENSELEMENT DER DEMOKRATIE ODER PROFITUNTERNEHMEN?
- HÄTTE BECKER ANSPRUCH AUF UNTERLASSUNG?
- BERICHTIGUNGSANSPRÜCHE – DER ANSPRUCHSTELLER MUSS SELBER DIE UNRICHTIGKEIT NACHWEISEN.
- DÜSSELDORFER URTEIL: KEINE GEGENDARSTELLUNG IM WEB
- GIBT ES SCHADENERSATZ, WENN ES UM DIE KUNST GEHT?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Seminararbeit befasst sich mit den rechtlichen Fragen rund um das Internet und dessen Einordnung in den Rundfunkbegriff sowie dem Schutz der Privatsphäre im digitalen Raum. Dabei werden die wesentlichen rechtlichen Grundlagen und die Bedeutung des Rundfunks für eine demokratische Gesellschaft beleuchtet. Die Arbeit analysiert die Herausforderungen, die die Digitalisierung für die klassische Rundfunkordnung mit sich bringt, und diskutiert die Notwendigkeit, die rechtlichen Rahmenbedingungen im digitalen Zeitalter anzupassen.
- Die integrierende Funktion des Rundfunks und seine Bedeutung für die öffentliche Meinungsbildung
- Die Notwendigkeit einer positiven Rundfunkordnung für die Sicherung der Meinungsvielfalt
- Die Herausforderungen der Digitalisierung für die Rundfunkordnung und die Frage der Einordnung des Internets in den Rundfunkbegriff
- Der Schutz der Privatsphäre im Internet und die Interessen der Medien
- Rechtliche Ansprüche bei Verletzung der Privatsphäre im Internet
Zusammenfassung der Kapitel
Frage 1: Ist das Internet dem Rundfunkbegriff zuzurechnen?
Das Kapitel beleuchtet die wichtige Rolle des Rundfunks als Medium der öffentlichen Meinungsbildung und betont die Notwendigkeit einer positiven Ordnung, die die Meinungsvielfalt in der Gesellschaft sicherstellt. Es wird außerdem erläutert, dass die rasante Entwicklung der Medientechnologie und die Digitalisierung des Medienbereichs neue Fragen aufwerfen, insbesondere in Bezug auf die Einordnung der neuen Medien in den Rundfunkbegriff.
Frage 2: Ist die Privatsphäre im Internet rechtlich geschützt?
Dieses Kapitel untersucht die rechtlichen Aspekte des Schutzes der Privatsphäre im Internet. Es wird diskutiert, ob das Internet als eine Bedrohung für die Privatsphäre anzusehen ist, und es werden verschiedene rechtliche Ansprüche im Zusammenhang mit Verletzungen der Privatsphäre im digitalen Raum analysiert.
Schlüsselwörter
Rundfunkbegriff, Internet, Digitalisierung, Meinungsvielfalt, Rundfunkfreiheit, Privatsphäre, Datenschutz, Rechtsschutz, Medienrecht, Kommunikationswissenschaften.
Häufig gestellte Fragen
Fällt das Internet unter den klassischen Rundfunkbegriff?
Dies ist eine zentrale Frage der Arbeit. Die Zuordnung hängt davon ab, ob Internetdienste die Kriterien für Rundfunk (Darbietungen für die Allgemeinheit, elektromagnetische Schwingungen) erfüllen.
Welche Folgen hat die Einordnung eines Dienstes als Rundfunk?
Eine Einordnung als Rundfunk bedeutet, dass strenge organisatorische und inhaltliche Anforderungen des Rundfunkstaatsvertrages, wie die Sicherung der Meinungsvielfalt, erfüllt werden müssen.
Wie ist die Privatsphäre im Internet rechtlich geschützt?
Die Arbeit untersucht den Schutzbereich der Privatsphäre gegenüber Medieninteressen und analysiert Ansprüche wie Unterlassung, Berichtigung und Schadensersatz.
Gibt es einen Anspruch auf Gegendarstellung im Web?
Die Arbeit thematisiert hierzu spezifische Urteile, wie das Düsseldorfer Urteil, das die Grenzen von Gegendarstellungsansprüchen im Internet beleuchtet.
Warum ist die Definition des Rundfunkbegriffs für die Bundesländer wichtig?
Die Definition beeinflusst die Kompetenzverteilung: Während die Länder für den Rundfunk zuständig sind, liegt die Kompetenz für rein wirtschaftliche Tätigkeiten eher beim Bund oder der EU.
Was schützt Artikel 5 des Grundgesetzes?
Art. 5 GG gewährleistet die Rundfunkfreiheit und schützt den gesamten Prozess der individuellen und öffentlichen Meinungsbildung.
- Quote paper
- Iliana Angelova (Author), 2002, Internet und der Rundfunkbegriff, Internet und die Privatsphäre, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/12725