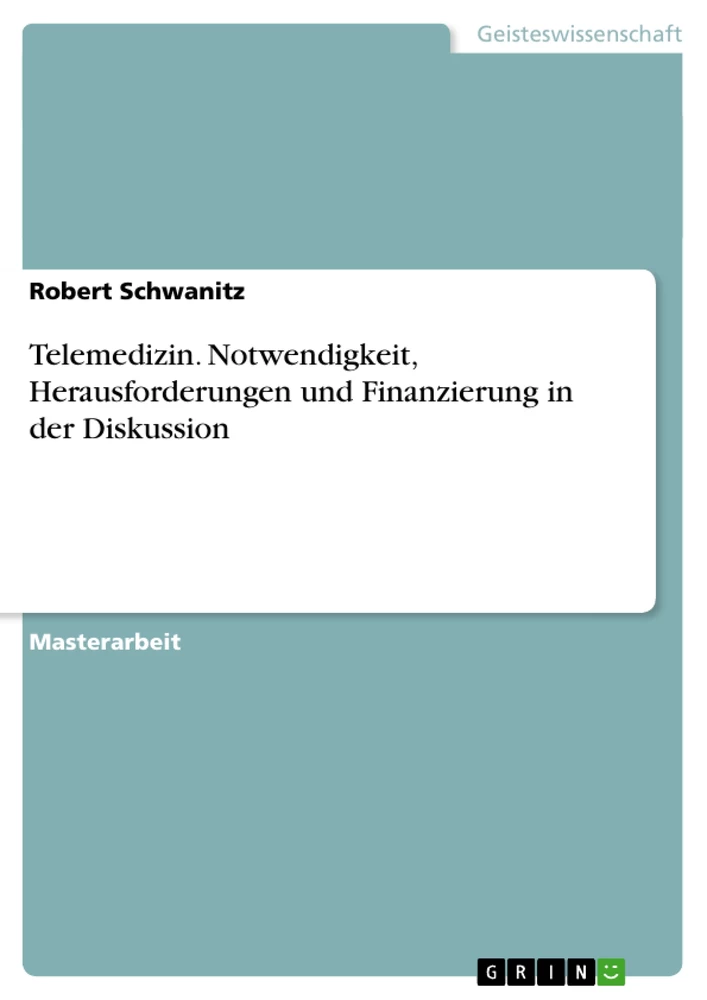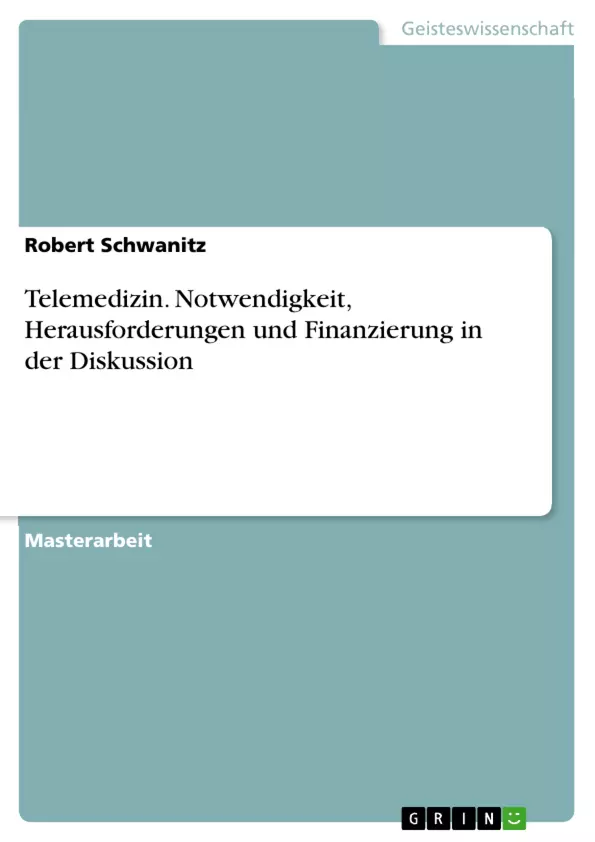Diese Arbeit stellt die Telemedizin in den Mittelpunkt der Betrachtung. Sie ist im heutigen Gesundheitswesen bereits allgegenwärtig und sorgt für den Datenaustausch zwischen den verschiedenen Akteuren. Der moderne Betrieb eines Krankenhauses oder einer Praxis ist ohne diese Systeme des Datenaustausches nicht mehr denkbar. Die Telemedizin macht sich diese Technisierung zu Nutze. Telemedizin bezeichnet alle medizinischen Behandlungen bei denen die Akteure nicht in unmittelbaren Kontakt stehen und zur Überwindung der Distanz elektronische Hilfsmittel benutzt werden. Dies kann sowohl ein Telefon sein, als auch modernste IuKT, die zum Großteil auf der Datenübertragung durch das Internet basieren. Ziel dieser Arbeit ist es den Stand der Telemedizin in Deutschland anhand der Krankheitsbilder der Zukunft darzustellen und zu bewerten. Welche Lösungen kann die Telemedizin für die wichtigsten Krankheitsbilder anbieten und wie verbreitet sind diese Verfahren? Anhand der beiden Säulen Vernetzung und Anwendung wird diese Frage diskutiert und bewertet. Dabei werden verschiedene Praxisbeispiele analysiert und Stolpersteine und Hürden für die Umsetzung telemedizinischer Dienstleistungen beleuchtet.
Die Fragestellung und These, die dabei im Mittelpunkt stehen sollen lauten:
Warum gelingt es in Deutschland bis jetzt nicht, telemedizinische Verfahren flächendeckend umzusetzen?
Bei der Bearbeitung dieser Fragestellung werden einführend die Herausforderungen vor denen das Gesundheitswesen steht anhand des demographischen Wandels und der Finanzierungsproblematik dargestellt. Auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse werden die Krankheitsbilder identifiziert, die zukünftig eine große Rolle im Bereich der gesundheitlichen Versorgung spielen werden. Bevor auf die telemedizinischen Anwendungen zu diesen Krankheitsbildern eingegangen wird, soll der Stand der Vernetzung im Gesundheitswesen anhand der Beispiele eGk und ePa diskutiert und bewertet werden. Liegen in diesem Bereich schon Hürden für die Umsetzung von Anwendungen vor? Der Bereich der praktischen Anwendungen wird daraufhin anhand diverser Praxisbeispiele zu den wichtigsten Krankheitsbildern analysiert. Die Frage, wie sich die Telemedizin in den Kreislauf der regulären Gesundheitsversorgung einfügt, und welche Organisationsform zum Einsatz kommt ist ebenfalls Gegenstand der Analyse.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Definitionen um die Telemedizin
- 1.1 Die Geschichte der Telemedizin
- 1.2 Eingrenzung und Verwendung der Begriffe
- 1.2.1 Vernetzung
- 1.2.2 Anwendung
- 1.3 Zwischenfazit: Begriffsbildung und Definition
- 2. Warum Telemedizin? Problemlage und Überblick
- 2.1 Die Zukunft des Gesundheitswesens unter Berücksichtigung des demographischen Wandels
- 2.1.1 Die Folgen der „neuen“ Altersstruktur
- 2.2 Krankheitsbild und Krankheitskosten in Deutschland - ein Grund für Telemedizin?
- 2.2.1 Im Fokus: Erkrankungen des Kreislaufsystems
- 2.2.2 Im Fokus: Chronische Erkrankungen
- 2.2.3 Krankheitskosten und Reformen im Überblick
- 2.3 Zwischenfazit
- 2.1 Die Zukunft des Gesundheitswesens unter Berücksichtigung des demographischen Wandels
- 3. Praktische Anwendungen
- 3.1 Vernetzung: Die elektronische Gesundheitskarte
- 3.1.1 Kritik an der elektronischen Gesundheitskarte
- 3.1.2 Die elektronische Gesundheitskarte und die Relevanz der freiwilligen Zusatzanwendungen
- 3.2 Vernetzung: Die elektronische Patientenakte
- 3.2.1 Die elektronische Patientenakte als eHealth Entwicklungsprojekt: Die Beispiele Krankenhaus und Krankenkasse
- 3.3 Zwischenfazit
- 3.4 Anwendung
- 3.4.1 Eingrenzung der Praxisbeispiele: Telemonitoring als erster Schritt und doctor 2 patient vs. doctor 2 doctor
- 3.5 Anwendung: Diabetes und Telemedizin
- 3.5.1 Diabetes: Eine Volkskrankheit
- 3.5.2 Telemedizinische Betreuungsansätze
- 3.6 Exkurs: Integrierte Versorgung und Disease Management Programme
- 3.7 Anwendung: Herz-Kreislauferkrankungen und Telemedizin
- 3.7.1 Das Institut für angewandte Telemedizin (IFAT) am Herz- und Diabeteszentrum NRW
- 3.7.2 Angebote des IFAT: ESCAT I-III
- 3.7.3 Angebote des IFAT: NOPT/AUTARK
- 3.7.4 Ergebnisse der Befragung bei AUTARK
- 3.7.5 Akzeptanz des IFAT und der ambulanten Rehabilitation
- 3.7.6 Kooperation und Belastbarkeit bei AUTARK
- 3.7.7 Zusammenfassung der Befragung bei AUTARK
- 3.7.8 Angebote des IFAT: Herz-AS
- 3.8 Anwendung: Ambient Assisted Living oder der Haushalt als dritter Gesundheitsstandort
- 3.9 Der Gesamtmarkt für telemedizinische Anwendungen
- 3.10 Zwischenfazit
- 4. Schlussfolgerungen, Stolpersteine und Hürden auf dem Weg zu telemedizinischen Anwendungen
- 4.1 Recht
- 4.2 Ökonomie und Finanzierung
- 4.2.1 Krankenhäuser
- 4.2.2 Niedergelassene Ärzte
- 4.2.3 Krankenkassen
- 4.2.4 Telemedizin Unternehmen
- 4.3 Akzeptanz
- 4.4 Organisation
- 5. Fazit und Ausblick
- Literaturverzeichnis
- Anhang
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Anlage
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit befasst sich mit dem Thema Telemedizin und untersucht die Notwendigkeit, Herausforderungen und Finanzierungsmöglichkeiten dieser neuen Versorgungsform im deutschen Gesundheitswesen. Die Arbeit analysiert die aktuelle Situation des Gesundheitswesens im Kontext des demographischen Wandels und der steigenden Krankheitskosten. Sie beleuchtet die Bedeutung der Telemedizin als Instrument zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung und zur Kostensenkung.
- Die Entwicklung und Bedeutung der Telemedizin im Gesundheitswesen
- Die Herausforderungen und Chancen der Telemedizin im Kontext des demographischen Wandels und der steigenden Krankheitskosten
- Die rechtlichen, ökonomischen und organisatorischen Rahmenbedingungen für die Implementierung von Telemedizin
- Die Akzeptanz von Telemedizin durch Patienten und medizinisches Personal
- Die Finanzierung von Telemedizin und die Rolle der Krankenkassen, Krankenhäuser und niedergelassenen Ärzte
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz der Telemedizin im Kontext des sich wandelnden deutschen Gesundheitswesens dar. Sie beleuchtet die Herausforderungen, die sich aus dem demographischen Wandel und den steigenden Krankheitskosten ergeben, und zeigt die Notwendigkeit von innovativen Versorgungsformen wie der Telemedizin auf.
Kapitel 1 definiert den Begriff der Telemedizin und beleuchtet seine historische Entwicklung. Es werden verschiedene Anwendungsbereiche und Vernetzungsformen der Telemedizin vorgestellt und die Bedeutung der Begriffsbildung für die weitere Analyse herausgestellt.
Kapitel 2 untersucht die Problemlage des deutschen Gesundheitswesens und die Notwendigkeit der Telemedizin. Es analysiert die Folgen des demographischen Wandels und die steigenden Krankheitskosten, insbesondere im Bereich der chronischen Erkrankungen und Erkrankungen des Kreislaufsystems.
Kapitel 3 befasst sich mit den praktischen Anwendungen der Telemedizin. Es werden verschiedene Vernetzungsformen wie die elektronische Gesundheitskarte und die elektronische Patientenakte vorgestellt und deren Bedeutung für die Telemedizin beleuchtet.
Kapitel 4 analysiert die Schlussfolgerungen, Stolpersteine und Hürden auf dem Weg zur Implementierung von Telemedizin. Es werden die rechtlichen, ökonomischen und organisatorischen Herausforderungen sowie die Akzeptanz von Telemedizin durch Patienten und medizinisches Personal diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Telemedizin, Gesundheitswesen, demographischer Wandel, Krankheitskosten, Finanzierung, Vernetzung, elektronische Gesundheitskarte, elektronische Patientenakte, Akzeptanz, Recht, Ökonomie, Organisation, Herausforderungen, Chancen, Anwendungen, Praxisbeispiele, Diabetes, Herz-Kreislauferkrankungen, Ambient Assisted Living.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird Telemedizin in dieser Arbeit definiert?
Telemedizin umfasst alle medizinischen Behandlungen, bei denen Akteure über räumliche Distanz hinweg elektronische Hilfsmittel (vom Telefon bis zum Internet) zur Kommunikation nutzen.
Warum ist Telemedizin angesichts des demographischen Wandels wichtig?
Eine alternde Gesellschaft führt zu mehr chronischen Erkrankungen. Telemedizin kann helfen, die Versorgung effizienter zu gestalten und Kosten im Gesundheitswesen zu senken.
Was sind die größten Hürden für die flächendeckende Umsetzung in Deutschland?
Die Arbeit identifiziert rechtliche Unsicherheiten, Finanzierungsprobleme zwischen Krankenkassen und Ärzten sowie mangelnde Akzeptanz und organisatorische Stolpersteine.
Welche Rolle spielen die elektronische Gesundheitskarte (eGK) und Patientenakte (ePA)?
Sie bilden die Basis für die Vernetzung im Gesundheitswesen, stehen jedoch aufgrund von Datenschutzbedenken und technischer Umsetzung oft in der Kritik.
Für welche Krankheitsbilder bietet Telemedizin bereits Lösungen?
Besonders im Bereich Diabetes und Herz-Kreislauferkrankungen (z.B. durch Telemonitoring) gibt es bereits erfolgreiche Praxisbeispiele wie das IFAT-Institut.
- 3.1 Vernetzung: Die elektronische Gesundheitskarte
- Quote paper
- Robert Schwanitz (Author), 2009, Telemedizin. Notwendigkeit, Herausforderungen und Finanzierung in der Diskussion, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/127351