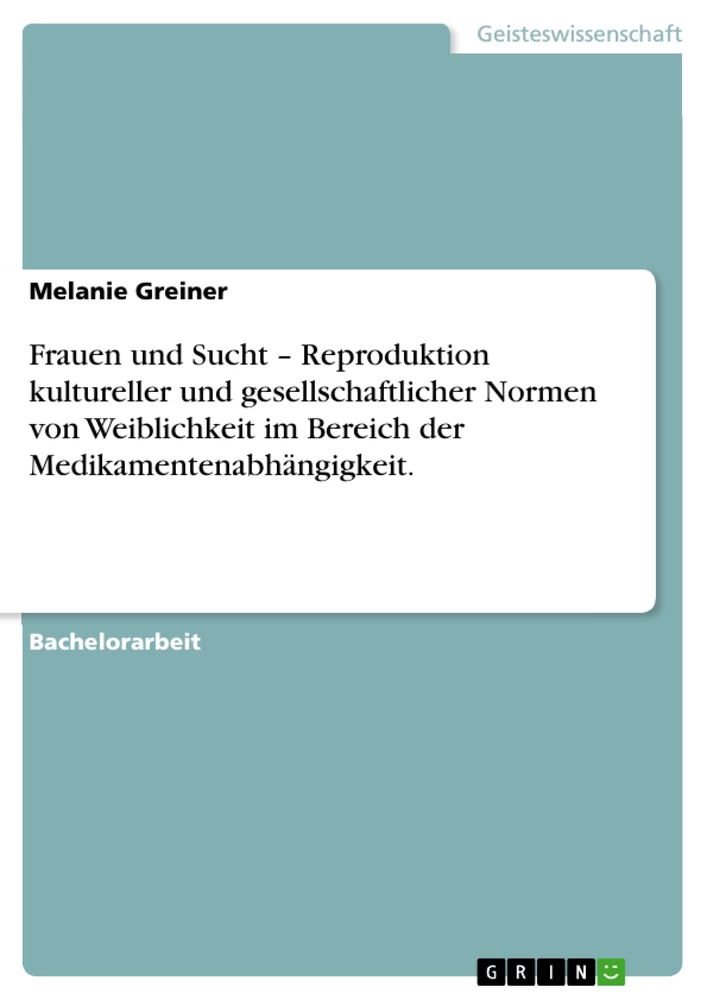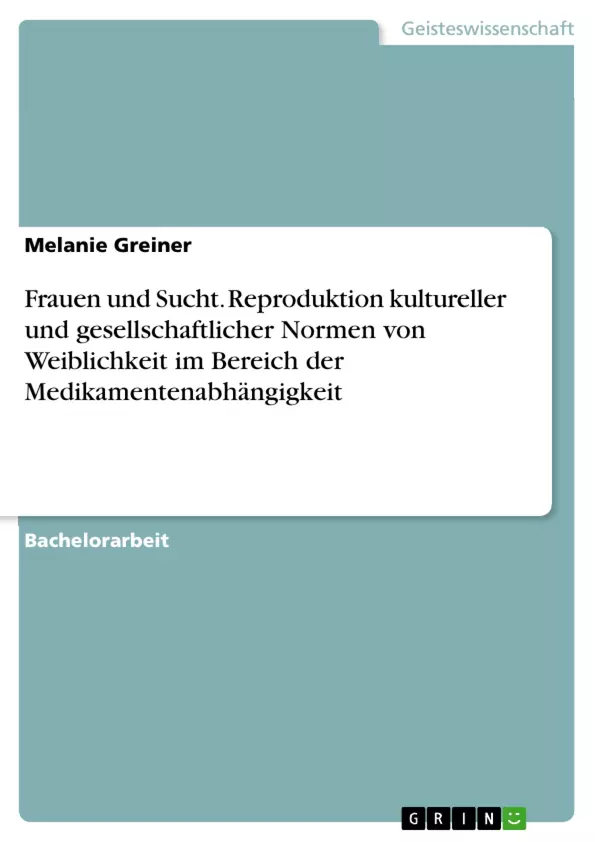In der vorliegenden Bachelorarbeit möchte ich mir den Bereich der Medikamentenabhängigkeit genauer anschauen und herausarbeiten, welche kulturellen und gesellschaftlichen Vorstellungen und Normen von Weiblichkeit und „Frau – Sein“ dort reproduziert werden. Hierfür müssen einige Fragen gestellt werden.
Wie kommt es, dass genau diese Abhängigkeit von Frauen dominiert wird und Männer nicht so oft davon betroffen sind? Welche Geschlechterstereotype und Rollenbilder werden durch den Konsum verschreibungspflichtiger Medikamente produziert und aufrechterhalten? Welche Einfluss- und Risikofaktoren gibt es möglicherweise bei Frauen, die die Entstehung einer Medikamentenabhängigkeit begünstigen und bei Männern nicht vorherrschen? Welche Muster und Vorstellungen von Weiblichkeit, die in unserer Gesellschaft als normal gelten, kann man darin sehen und wie zeigt sich das Konzept des „Doing Gender“? Welchen Einfluss hat möglicherwiese die weibliche und medizinische Sozialisation von Mädchen und Frauen auf die Entstehung einer Medikamentenabhängigkeit?
Anhand dieser vielen Teilfragen möchte ich die bereits beschriebene Fragestellung, welche kulturellen und gesellschaftlichen Normen von Weiblichkeit in Bezug auf die Medikamentenabhängigkeit von Frauen zu finden sind und in diesem Bereich eine Rolle spielen, beantworten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung - Alkoholkranke Männer, Medikamentenabhängige Frauen.
- 2. Geschlecht
- 2.1. ,,Sex“ und „,Gender“.
- 2.2. ,,Doing Gender“
- 3. Sucht und Abhängigkeit.
- 3.1. Definition der Begriffe „Sucht“ und „Abhängigkeit“
- 3.2. Unterscheidung von substanzgebundenen und substanzungebundenen Süchten....
- 3.3. Diagnosekriterien einer Abhängigkeitserkrankung nach ICD -\n-\n10 und DSM-5 ........
- 3.4. Entstehung von Sucht
- 4. Sucht und Geschlecht....
- 5. Geschlecht und Medikamentenabhängigkeit......
- 5.1. Medikamentenabhängigkeit in Deutschland
- 5.2. Häufig konsumierte Substanzen und die Wirkung von Benzodiazepinen
- 6. Weibliche Risikofaktoren und gesellschaftliche Geschlechternormen in Bezug auf die\nEntstehung und Aufrechterhaltung einer Medikamentenabhängigkeit bei Frauen..............
- 6.1. Geschlechtsspezifisches Gesundheitsverständnis und Gesundheitsverhalten
- 6.2. Medikalisierung weiblicher Lebens- und Umbruchphasen
- 6.3. Zusammenhang von Geschlechterrolle und Schmerzerleben
- 6.4. ,,Doing Gender\", weibliche Sozialisation und weiblicher Geschlechterhabitus
- 7. Fazit - Die Kategorie Geschlecht neu denken
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit dem Bereich der Medikamentenabhängigkeit und analysiert, welche kulturellen und gesellschaftlichen Vorstellungen von Weiblichkeit und „Frau – Sein“ in diesem Kontext reproduziert werden. Die Arbeit setzt sich zum Ziel, die Gründe für die überproportionale Betroffenheit von Frauen durch Medikamentenabhängigkeit zu beleuchten, die Entstehung und Aufrechterhaltung von Geschlechterstereotypen in Verbindung mit Medikamentenkonsum zu untersuchen und die relevanten Einfluss- und Risikofaktoren zu identifizieren.
- Die Geschlechterrollen und Normen in Bezug auf Medikamentenabhängigkeit
- Der Einfluss von „Doing Gender“ auf das Suchtverhalten von Frauen
- Die Rolle der weiblichen Sozialisation und des Gesundheitsverständnisses bei der Entstehung von Medikamentenabhängigkeit
- Die Medikalisierung weiblicher Lebens- und Umbruchphasen im Zusammenhang mit Sucht
- Die Relevanz der Kategorie Geschlecht im Kontext von Medikamentenabhängigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik der Geschlechterrollen und Normen im Bereich der Sucht dar und lenkt den Fokus auf Medikamentenabhängigkeit bei Frauen. Sie führt ein in die Fragestellung der Arbeit und die Relevanz der Kategorien „Sex“ und „Gender“. Kapitel 2 erläutert die Bedeutung dieser Kategorien und die Theorie des „Doing Gender“, um die Entstehung und Reproduktion von Geschlechterrollen im Alltag zu verstehen. Kapitel 3 beleuchtet den Begriff der Sucht, die Diagnosekriterien und die Entstehung von Abhängigkeitserkrankungen. Dabei wird auch die Unterscheidung zwischen stoffgebundenen und nicht - stoffgebundenen Süchten betrachtet. Kapitel 4 befasst sich mit den geschlechtsspezifischen Aspekten von Abhängigkeitserkrankungen. Kapitel 5 widmet sich der Medikamentenabhängigkeit in Deutschland, den häufigsten konsumierten Substanzen und der Wirkung von Benzodiazepinen. Kapitel 6 untersucht die weiblichen Risikofaktoren und gesellschaftlichen Geschlechternormen, die die Entstehung und Aufrechterhaltung einer Medikamentenabhängigkeit bei Frauen begünstigen. Dabei werden Aspekte wie geschlechtsspezifisches Gesundheitsverständnis und -verhalten, die Medikalisierung weiblicher Lebens- und Umbruchphasen, der Zusammenhang zwischen Geschlechterrolle und Schmerzerleben sowie „Doing Gender“, weibliche Sozialisation und weiblicher Geschlechterhabitus betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter dieser Arbeit umfassen Medikamentenabhängigkeit, Geschlecht, Gender, Doing Gender, Weiblichkeit, Geschlechterrollen, Medikalisierung, Sozialisation, Sucht, Abhängigkeit, Risikofaktoren, Gesundheitsverständnis, Gesundheitsverhalten, Geschlechterstereotype und Normen. Die Arbeit analysiert die Reproduktion dieser Konzepte im Bereich der Medikamentenabhängigkeit bei Frauen.
Häufig gestellte Fragen
Warum sind Frauen häufiger von Medikamentenabhängigkeit betroffen als Männer?
Die Arbeit untersucht, wie kulturelle Normen, weibliche Sozialisation und die Medikalisierung von Lebensphasen dazu führen, dass Frauen eher zu verschreibungspflichtigen Medikamenten greifen.
Was bedeutet das Konzept „Doing Gender“ im Zusammenhang mit Sucht?
„Doing Gender“ beschreibt die alltägliche Reproduktion von Geschlechterrollen. Im Suchtkontext zeigt es sich darin, wie Frauen durch Medikamentenkonsum gesellschaftliche Erwartungen an Weiblichkeit aufrechterhalten.
Welche Rolle spielt die Medikalisierung weiblicher Lebensphasen?
Natürliche Umbruchphasen im Leben einer Frau werden oft als medizinisches Problem behandelt, was den Einsatz von Psychopharmaka wie Benzodiazepinen begünstigt.
Welche Substanzen stehen im Fokus der Untersuchung?
Ein Schwerpunkt liegt auf häufig konsumierten verschreibungspflichtigen Substanzen, insbesondere auf der Wirkung und Abhängigkeit von Benzodiazepinen.
Was ist der Unterschied zwischen „Sex“ und „Gender“ in dieser Arbeit?
„Sex“ bezieht sich auf das biologische Geschlecht, während „Gender“ die soziale und kulturelle Konstruktion von Geschlechtsidentität und Rollenerwartungen beschreibt.
- Arbeit zitieren
- Melanie Greiner (Autor:in), 2022, Frauen und Sucht. Reproduktion kultureller und gesellschaftlicher Normen von Weiblichkeit im Bereich der Medikamentenabhängigkeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1273555