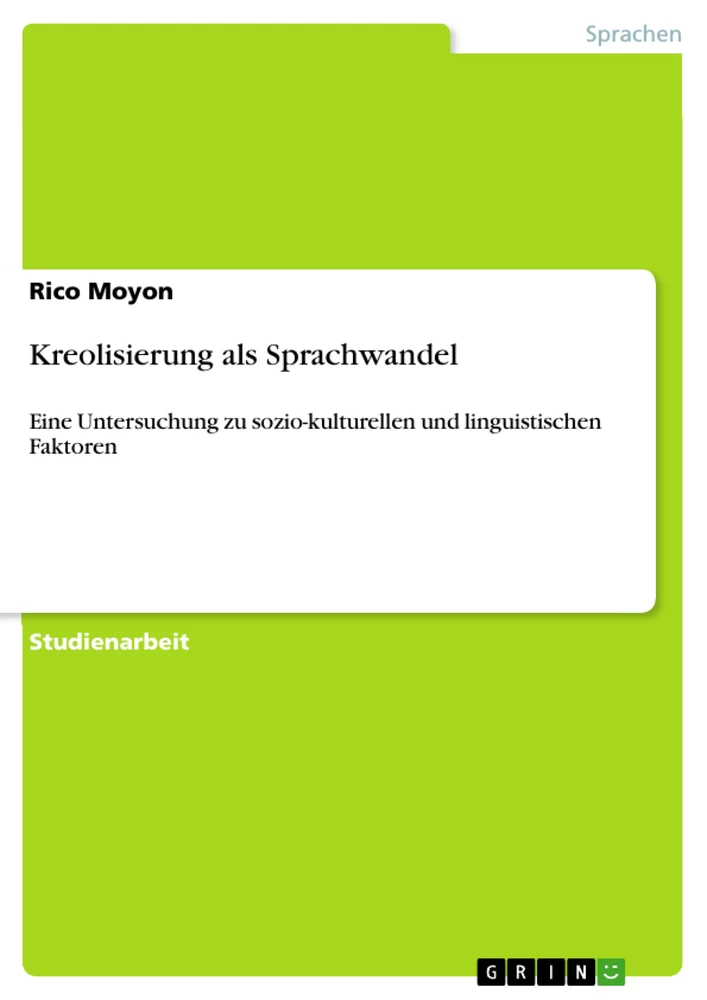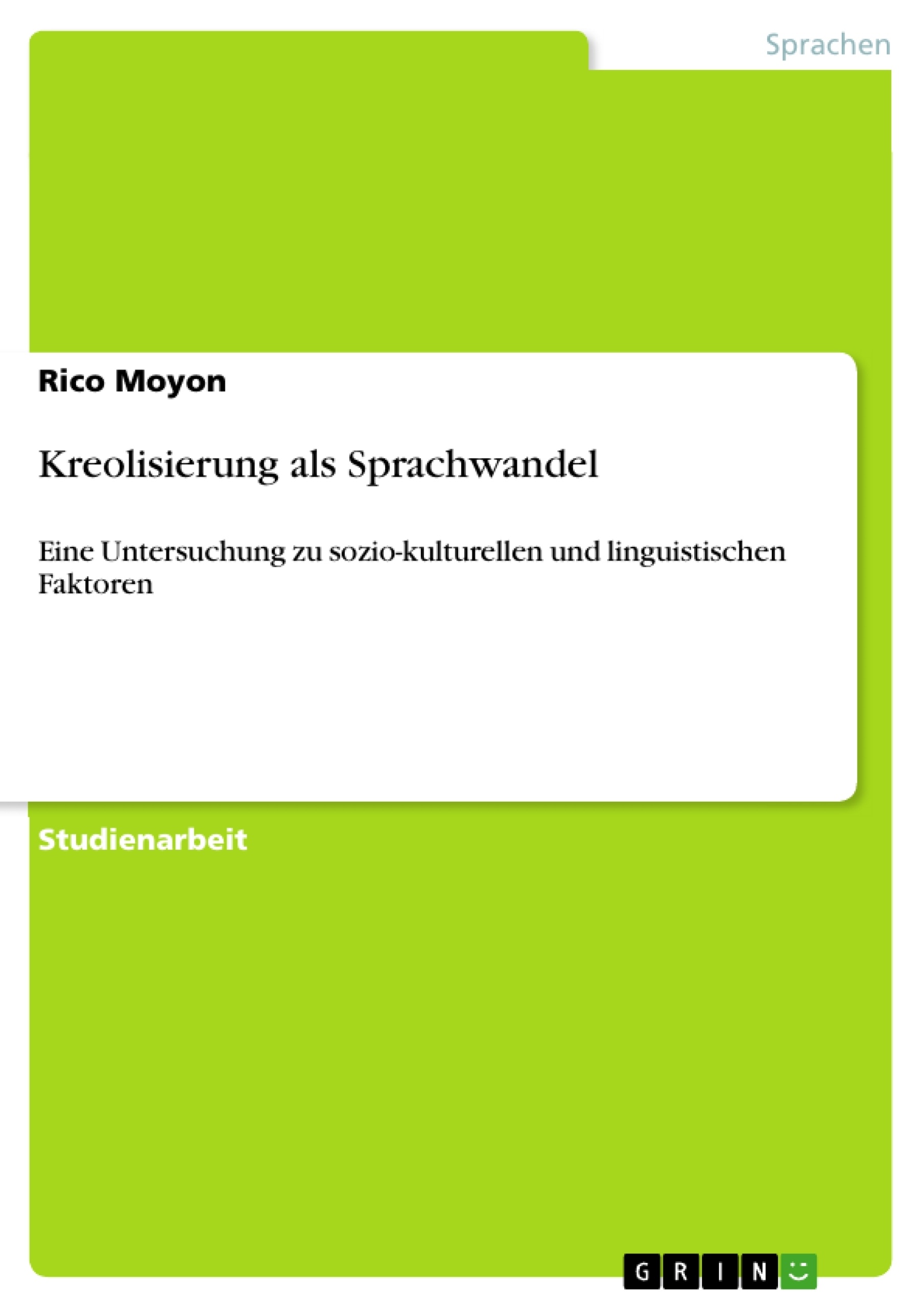Den Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit wird eine soziolinguistische Theorie über die Genese der Frankoreolsprachen darstellen, die der französische Sprachwissenschaftler Robert
Chaudenson im Jahre 1992 in seinem Buch 'Des îles, des hommes, des langues' vorstellte.
Um den Rahmen für die kritische und in erster Linie linguistischen Analyse dieses Ansatzes zu schaffen, soll zunächst der Prozess der Kreolisierung mit den grundlegenden Aspekten des Sprachwandels zusammengeführt werden, die sich als Einheit wie ein roter Faden durch die Entwicklung kreolischer Sprachsysteme zu ziehen scheinen.
Im Mittelpunkt der im letzten Teil geführten Analyse der «linguistic creolization» wird insbesondere
das kognitive Prinzip der «language appropriation» stehen, die Chaudenson als die ausschlaggebende Kraft bei der Frankokreolgenese ausgemacht haben will. Hierbei wird dieser
kognitive Prozess geprüft, indem mit ihm typologische Strukturen anderer Kreolsprachen erklären werden sollen, wobei ein kreoltypischer Aspekt im Vordergrund stehen wird: die
Wortfolgemuster.
Inhaltsverzeichnis
- 0 Einleitung
- 1 Kreolisierung und Sprachwandel
- 1.1 Sprachwandel nach Coseriu und Martinet
- 1.2 Der Weg zum Ziel: Symbiose
- 2 Die Theorie von Robert Chaudenson
- 2.1 Das 2-Phasen-Modell
- 2.1.1 Die «homestead society»
- 2.1.2 Die «plantation society»
- 2.2 «linguistic creolization»
- 2.2.1 Kolonisatorensprache und «missing links»
- 2.2.2 Tempus, Aspekt und Inversion
- 2.3 Das français avancé
- 3 Die Theorie auf dem Prüfstand
- 3.1 Soziolinguistische Komponenten
- 3.2 Linguistische Aspekte
- 3.2.1 Die Frage nach der Relexifizierung
- 3.2.2 And the winner is ... SVO
- 4 Konklusion und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die soziolinguistische Theorie von Robert Chaudenson zur Genese der Frankoreolsprachen. Sie verbindet die Analyse von Chaudensons Ansatz mit grundlegenden Aspekten des Sprachwandels, um den Prozess der Kreolisierung besser zu verstehen. Ein besonderer Fokus liegt auf dem kognitiven Prinzip der „language appropriation“ und der Analyse typologischer Strukturen, insbesondere der Wortfolgemuster in Kreolsprachen.
- Kreolisierung als Sprachwandelprozess
- Chaudensons Zwei-Phasen-Modell der Frankokreolgenese
- Sprachkontakt und soziolinguistische Faktoren bei der Kreolisierung
- Linguistische Aspekte der Kreolisierung (Wortfolge, Relexifizierung)
- Das kognitive Prinzip der „language appropriation“
Zusammenfassung der Kapitel
0 Einleitung: Diese Einleitung beschreibt den Schwerpunkt der Arbeit: die soziolinguistische Theorie von Robert Chaudenson über die Entstehung von Frankoreolsprachen. Sie skizziert den Ansatz, der Sprachwandelprozesse mit der Kreolisierung verbindet, und kündigt die Analyse des kognitiven Prinzips der „language appropriation“ und der typologischen Wortfolgemuster an.
1 Kreolisierung und Sprachwandel: Dieses Kapitel beginnt mit der Feststellung, dass es trotz zahlreicher Studien keinen Konsens über die Entstehung von Kreolsprachen gibt. Es führt die Theorien von Coseriu und Martinet zum Sprachwandel ein, die den Wandel als eine Anpassung des sprachlichen Instruments an die kommunikativen Bedürfnisse der Sprecher beschreiben. Der Sprachwandel wird als ein permanenter, systeminhärenter Prozess dargestellt, der sich auf allen sprachlichen Ebenen vollzieht. Die Resultate dieses Prozesses werden erst auf synchroner Ebene sichtbar.
1.2 Der Weg zum Ziel: Symbiose: Dieses Kapitel argumentiert, dass die Analyse von Sprachwandelprozessen eine eingehende Untersuchung der Entwicklungsgeschichte des jeweiligen Kommunikationssystems erfordert, unter Berücksichtigung sowohl interner (systeminhärente Dynamik) als auch externer (Sprachkontaktsituationen) Faktoren. Es betont die Notwendigkeit einer Symbiose aus synchronen Sprachzuständen, externen Entwicklungsschritten und soziolinguistischen Faktoren, um den Mechanismus des Sprachwandels bei der Kreolgenese zu verstehen. Der Ansatz von Assmann zur Entstehung kollektiver Identität durch kulturelle Formationen wird in Bezug auf die Rolle der Sprache bei der Herausbildung von Kreolsprachen diskutiert. Chaudensons Theorie wird als Integration der genannten Ansätze, inklusive des Sprachlernprozesses, vorgestellt.
Schlüsselwörter
Kreolisierung, Sprachwandel, Frankoreolsprachen, Robert Chaudenson, Soziolinguistik, Sprachkontakt, Linguistik, Wortfolge, Relexifizierung, language appropriation, Coseriu, Martinet.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse der soziolinguistischen Theorie von Robert Chaudenson zur Genese der Frankoreolsprachen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die soziolinguistische Theorie von Robert Chaudenson zur Entstehung von Frankoreolsprachen. Sie verbindet Chaudensons Ansatz mit grundlegenden Aspekten des Sprachwandels, um den Prozess der Kreolisierung besser zu verstehen. Ein besonderer Fokus liegt auf dem kognitiven Prinzip der „language appropriation“ und der Analyse typologischer Strukturen, insbesondere der Wortfolgemuster in Kreolsprachen.
Welche Theorien zum Sprachwandel werden behandelt?
Die Arbeit bezieht sich auf die Theorien von Coseriu und Martinet zum Sprachwandel, die den Wandel als Anpassung des sprachlichen Instruments an kommunikative Bedürfnisse beschreiben. Chaudensons Zwei-Phasen-Modell der Frankokreolgenese wird im Detail untersucht.
Was ist Chaudensons Zwei-Phasen-Modell?
Chaudensons Modell unterscheidet zwischen einer "homestead society" und einer "plantation society"-Phase. Es beschreibt die Entwicklung von Kreolsprachen unter dem Einfluss von Kolonialisierung und Sprachkontakt. Das Modell integriert Aspekte des Sprachlernprozesses, soziolinguistische Faktoren und die Entwicklung typologischer Strukturen.
Welche linguistischen Aspekte werden analysiert?
Die Arbeit analysiert linguistische Aspekte der Kreolisierung, insbesondere die Wortfolge (z.B. SVO-Struktur) und die Relexifizierung. Die Frage nach der Relexifizierung wird kritisch untersucht.
Welche Rolle spielt das kognitive Prinzip der "language appropriation"?
Das kognitive Prinzip der „language appropriation“ spielt eine zentrale Rolle im Verständnis des Sprachwandels bei der Kreolisierung. Es beschreibt den Prozess, wie Sprecher eine neue Sprache aneignen und an ihre Bedürfnisse anpassen.
Welche soziolinguistischen Faktoren werden berücksichtigt?
Die Arbeit berücksichtigt verschiedene soziolinguistische Komponenten, die die Kreolisierung beeinflussen, wie z.B. die soziale Struktur der beteiligten Gruppen und den Sprachkontakt zwischen Kolonialsprache und Substratsprachen.
Wie werden die Kapitel strukturiert?
Die Arbeit ist in vier Kapitel gegliedert: Einleitung, Kreolisierung und Sprachwandel (mit Unterkapiteln zu Coseriu/Martinet und dem Konzept der Symbiose), Chaudensons Theorie (mit Unterkapiteln zum Zwei-Phasen-Modell und "linguistic creolization"), und eine kritische Auseinandersetzung mit Chaudensons Theorie (inkl. soziolinguistischer und linguistischer Aspekte), sowie abschließende Konklusion und Ausblick.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Kreolisierung, Sprachwandel, Frankoreolsprachen, Robert Chaudenson, Soziolinguistik, Sprachkontakt, Linguistik, Wortfolge, Relexifizierung, language appropriation, Coseriu, Martinet.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit kommt zu Schlussfolgerungen über die Stärken und Schwächen von Chaudensons Theorie und bietet einen Ausblick auf zukünftige Forschung in diesem Bereich. Sie betont die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Perspektive, die sowohl linguistische als auch soziolinguistische Aspekte berücksichtigt.
- Arbeit zitieren
- Rico Moyon (Autor:in), 2009, Kreolisierung als Sprachwandel, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/127378