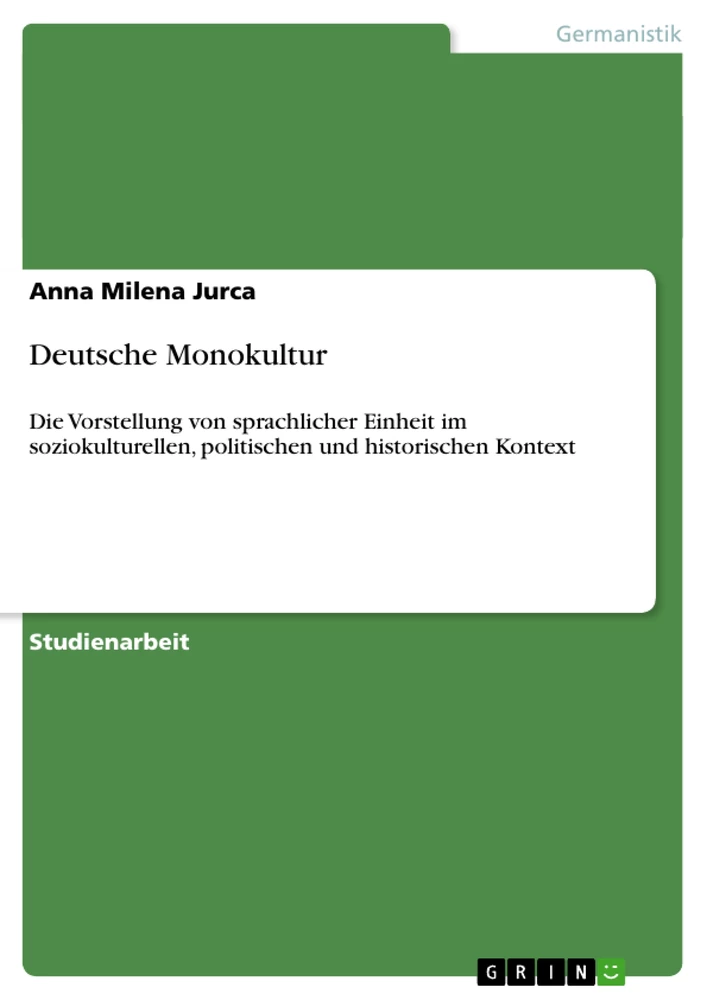Die deutsche Kulturpflanze wird seit mehreren Jahrhunderten unter dem Stern ihrer Sprache sorgsamer Pflege unterzogen, wobei ihre „Auswüchse“ zielstrebig klein- und breitgetreten werden, um dem Ganzen ein gesundes Wachsen und Gedeihen zu ermöglichen. Auf der Suche nach den Voraussetzungen für die entstehende Nachfrage nach bestimmten sprachlichen Normen stellt diese Arbeit dar und analysiert, welche Bedingungen zur Etablierung von Standards beigetragen haben. Die These lautet, dass Sprache eines der Felder ist, auf dem kulturelle Konflikten ausgetragen werden und dass sprachliches Handeln bestimmte Interessenverhältnisse widerspiegelt. Eine der Hauptstrategien hierbei ist die Konstruktion idealerweise organisierter, geschlossener und homogener Einheiten, deren Einfluss nach außen (soft power) besonders auf unorganisierte Strukturen wirkt und nach innen Identifikationsmöglichkeiten anbietet.
Kapitel 1 zeichnet die Schritte in der Entwicklung eines „Standarddeutsch“ nach, die von unterschiedlichen Bevölkerungsteilen zur Durchsetzung politischer, wirtschaftlicher und soziokultureller Absichten vorangetrieben wurde. In einem historischen Überblick über die wesentlichen Stufen der Standardisierung der deutschen Sprache wird der Schwerpunkt auf die Mittel der Standardisierungsbemühungen, die sprachkulturellen Auswirkungen und die
dahinterstehenden politischen und ökonomischen Mächte gelegt.
In Kapitel 2 wird in die Vorstellung von sprachlicher Einheit der Kontext der Nati-
onswerdung Deutschland und das Bild einer „Kulturnation“ miteinbezogen, in denen jeweils mit ähnlichen Strategien kultureller Hegemonie und Bildung von Einheiten Macht zu fokussieren und Legitimation zu begründen versucht wurde.
Die Konstruktion eines kulturellen Standards verläuft prinzipiell kaum ohne Gegenbewegungen oppositioneller Interessen, Ablehnung von Standards und unbewusste oder schlicht unintendierte Verstöße gegen die geschaffene Norm, weswegen in Kapitel 3 auf die „Normvergehen“ und Verstöße gegen den Standard eingegangen wird, besonders unter Hinblick auf die Sanktionsmechanismen und Kritik an dem „schlechten“ Sprachgebrauch (Sprachverfallsthese).
Im letzten Kapitel wird ein Über- und Ausblick auf alternative Vorschläge und Konzepte gegeben, die die versimplifizierenden Idee von „Standarddeutsch“ sowohl unter geographischen, politischen, historischen und linguistischen Gesichtspunkten einer kritischen Prüfung unterziehen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Kleine Geschichte der Standardisierung des Deutschen
- III. Vorstellungen von Einheit in Sprache, Kultur und Nation
- IV. Normverstöße und ihre Sanktionen
- V. Deutsch als plurizentrische Sprache und die Globalisierung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung und Durchsetzung eines standardisierten Deutsch im soziokulturellen, politischen und historischen Kontext. Sie analysiert die Bedingungen, die zur Etablierung sprachlicher Normen beigetragen haben und argumentiert, dass Sprache ein Feld kultureller Konflikte ist, das Interessenverhältnisse widerspiegelt.
- Historische Entwicklung des Standarddeutsch
- Vorstellungen von sprachlicher Einheit und nationale Identität
- Normverstöße und Sanktionen
- Deutsch als plurizentrische Sprache im Kontext der Globalisierung
- Sprachliche Standardisierung und kulturelle Hegemonie
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der deutschen Monokultur ein und beschreibt die Entwicklung der deutschen Sprache als ein kontinuierliches Bestreben nach Standardisierung und Homogenisierung. Sie stellt die These auf, dass Sprache ein Kampfplatz kultureller Konflikte ist und dass sprachliches Handeln bestimmte Interessenverhältnisse widerspiegelt. Die Arbeit analysiert die Bedingungen für die Etablierung von Sprachstandards und fokussiert auf die Konstruktion idealerweise organisierter, geschlossener und homogener Einheiten, deren Einfluss nach außen (soft power) und Identifikationsmöglichkeiten nach innen wirkt. Die Kapitel geben einen Überblick über die historische Entwicklung des Standarddeutsch, die Rolle der nationalen Identität, die Behandlung von Normverstößen und einen Ausblick auf Deutsch als plurizentrische Sprache im Kontext der Globalisierung.
II. Kleine Geschichte der Standardisierung des Deutschen: Dieses Kapitel verfolgt die Entwicklung eines „Standarddeutsch“, beginnend mit dem Bedarf an zuverlässigen Handelsnachrichten im 14. Jahrhundert. Frühneuniederdeutsch, geprägt vom Sprachgebrauch der Hansestädte, diente als erste Standardversion. Die zunehmende Standardisierung wurde durch die Bedürfnisse der Handelskorrespondenz und die Entstehung der Zeitung vorangetrieben. Die Arbeit beschreibt den bedeutenden Einfluss der Lutherbibel ab 1522 auf die Aufwertung des Deutschen gegenüber Latein und die daraus resultierende religionspolitische und kulturelle Bedeutung der deutschen Sprache. Die Einführung der Schulpflicht, beginnend in Preußen im 18. Jahrhundert, trug ebenfalls zur Standardisierung bei, da sie die Alphabetisierung der Bevölkerung und damit eine Vereinheitlichung der sprachlichen Bildungsgrundlagen erforderte.
III. Vorstellungen von Einheit in Sprache, Kultur und Nation: Kapitel drei beleuchtet die enge Verknüpfung von sprachlicher Einheit mit der Nationsbildung in Deutschland und dem Ideal der „Kulturnation“. Es analysiert, wie die Vorstellung einer politischen Gemeinschaft durch eine imaginierte Leser- und Sprachgemeinschaft vermittelt und Macht fokussiert sowie Legitimation begründet wurde. Der Fokus liegt auf den Strategien kultureller Hegemonie und der Konstruktion einer Einheit, die sowohl innen Identifikation als auch außen Einfluss (soft power) ermöglicht. Das Kapitel wird die spezifischen Mechanismen und Strategien untersuchen, die zur Konstruktion und Durchsetzung dieser Vorstellung von Einheit eingesetzt wurden, und deren Auswirkungen auf das deutsche Selbstverständnis beleuchten.
IV. Normverstöße und ihre Sanktionen: Dieses Kapitel befasst sich mit den Reaktionen auf Normverstöße und die Sanktionierung von „schlechtem“ Sprachgebrauch (Sprachverfallsthese). Es untersucht die Gegenbewegungen zu den Bemühungen um Standardisierung, die Ablehnung von Standards und die verschiedenen Formen von Normverstößen – bewusst oder unbewusst. Es analysiert die Mechanismen der Sanktionierung und die Kritik an abweichendem Sprachgebrauch, unter Berücksichtigung der sozialen und kulturellen Auswirkungen dieser Sanktionen. Das Kapitel wird verschiedene Ansätze zur Kritik an Sprachnormen untersuchen und die Gründe für die Widerstandsfähigkeit und Persistenz der "Sprachverfallsthese" beleuchten.
V. Deutsch als plurizentrische Sprache und die Globalisierung: In diesem Kapitel werden alternative Vorschläge und Konzepte vorgestellt, die die vereinfachende Vorstellung von „Standarddeutsch“ kritisch hinterfragen. Die Arbeit untersucht die von Humboldt formulierte Kongruenz von Nation und Sprache und die daraus resultierende Annahme von Sprachkritik als Ausdruck von Kulturkritik. Dabei wird die Brauchbarkeit dieser Konzepte im Zeitalter der Globalisierung geprüft und die Herausforderungen und Veränderungen für das Verständnis von Standarddeutsch im globalisierten Kontext diskutiert. Die Kapitel wird verschiedene Konzepte einer plurizentrischen Sprache vorstellen und ihre Relevanz für das deutsche Sprachbild im 21. Jahrhundert analysieren.
Schlüsselwörter
Standarddeutsch, Sprachstandardisierung, deutsche Monokultur, nationale Identität, kulturelle Hegemonie, Normverstöße, Sprachverfallsthese, Globalisierung, Plurizentrizität, Hanse, Lutherbibel, Schulpflicht.
FAQ: Entwicklung und Durchsetzung eines standardisierten Deutsch
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung und Durchsetzung eines standardisierten Deutsch im soziokulturellen, politischen und historischen Kontext. Sie analysiert die Bedingungen, die zur Etablierung sprachlicher Normen beigetragen haben und argumentiert, dass Sprache ein Feld kultureller Konflikte ist, das Interessenverhältnisse widerspiegelt.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung des Standarddeutsch, Vorstellungen von sprachlicher Einheit und nationaler Identität, Normverstöße und Sanktionen, Deutsch als plurizentrische Sprache im Kontext der Globalisierung und die Beziehung zwischen sprachlicher Standardisierung und kultureller Hegemonie.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Kleine Geschichte der Standardisierung des Deutschen, Vorstellungen von Einheit in Sprache, Kultur und Nation, Normverstöße und ihre Sanktionen, und Deutsch als plurizentrische Sprache und die Globalisierung. Zusätzlich enthält sie ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung führt in das Thema der deutschen Monokultur ein und beschreibt die Entwicklung der deutschen Sprache als ein kontinuierliches Bestreben nach Standardisierung und Homogenisierung. Sie stellt die These auf, dass Sprache ein Kampfplatz kultureller Konflikte ist und dass sprachliches Handeln bestimmte Interessenverhältnisse widerspiegelt. Die Einleitung gibt einen Überblick über die folgenden Kapitel.
Was wird in Kapitel II ("Kleine Geschichte der Standardisierung des Deutschen") behandelt?
Dieses Kapitel verfolgt die Entwicklung eines „Standarddeutsch“, beginnend mit dem Bedarf an zuverlässigen Handelsnachrichten im 14. Jahrhundert. Es beschreibt den Einfluss von Frühneuniederdeutsch, der Lutherbibel und der Einführung der Schulpflicht auf die Standardisierung.
Was wird in Kapitel III ("Vorstellungen von Einheit in Sprache, Kultur und Nation") behandelt?
Kapitel drei beleuchtet die enge Verknüpfung von sprachlicher Einheit mit der Nationsbildung in Deutschland und dem Ideal der „Kulturnation“. Es analysiert, wie die Vorstellung einer politischen Gemeinschaft durch eine imaginierte Leser- und Sprachgemeinschaft vermittelt und Macht fokussiert sowie Legitimation begründet wurde. Der Fokus liegt auf den Strategien kultureller Hegemonie.
Was wird in Kapitel IV ("Normverstöße und ihre Sanktionen") behandelt?
Dieses Kapitel befasst sich mit den Reaktionen auf Normverstöße und die Sanktionierung von „schlechtem“ Sprachgebrauch (Sprachverfallsthese). Es untersucht die Gegenbewegungen zu den Bemühungen um Standardisierung und die verschiedenen Formen von Normverstößen.
Was wird in Kapitel V ("Deutsch als plurizentrische Sprache und die Globalisierung") behandelt?
In diesem Kapitel werden alternative Vorschläge und Konzepte vorgestellt, die die vereinfachende Vorstellung von „Standarddeutsch“ kritisch hinterfragen. Die Arbeit untersucht die von Humboldt formulierte Kongruenz von Nation und Sprache und die Herausforderungen und Veränderungen für das Verständnis von Standarddeutsch im globalisierten Kontext. Es werden verschiedene Konzepte einer plurizentrischen Sprache vorgestellt.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Standarddeutsch, Sprachstandardisierung, deutsche Monokultur, nationale Identität, kulturelle Hegemonie, Normverstöße, Sprachverfallsthese, Globalisierung, Plurizentrizität, Hanse, Lutherbibel, Schulpflicht.
- Quote paper
- Anna Milena Jurca (Author), 2007, Deutsche Monokultur, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/127390