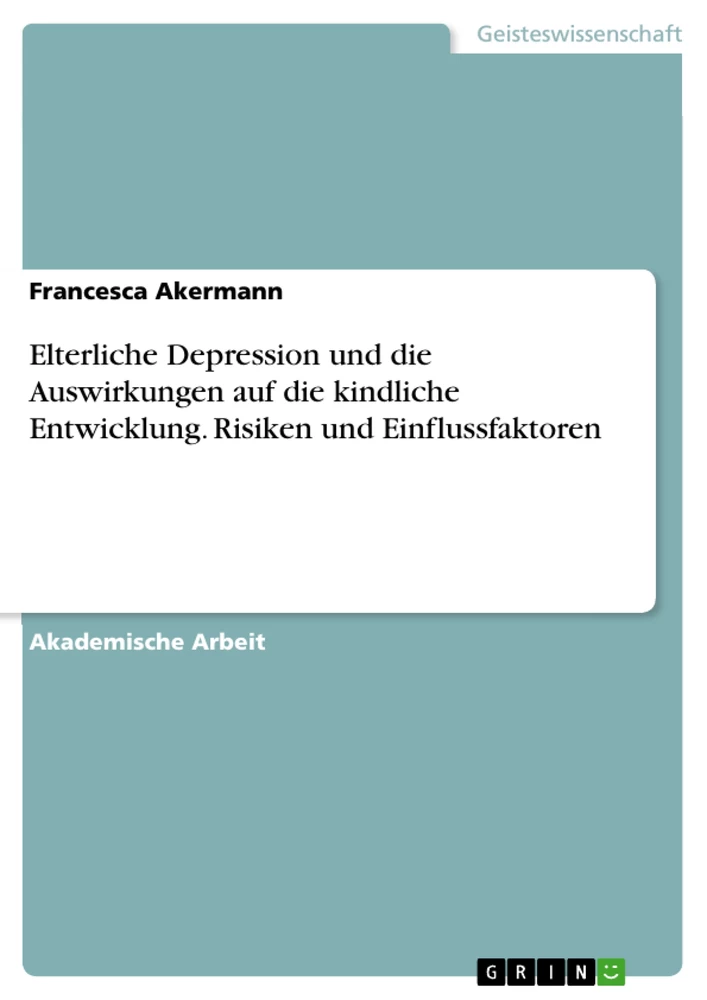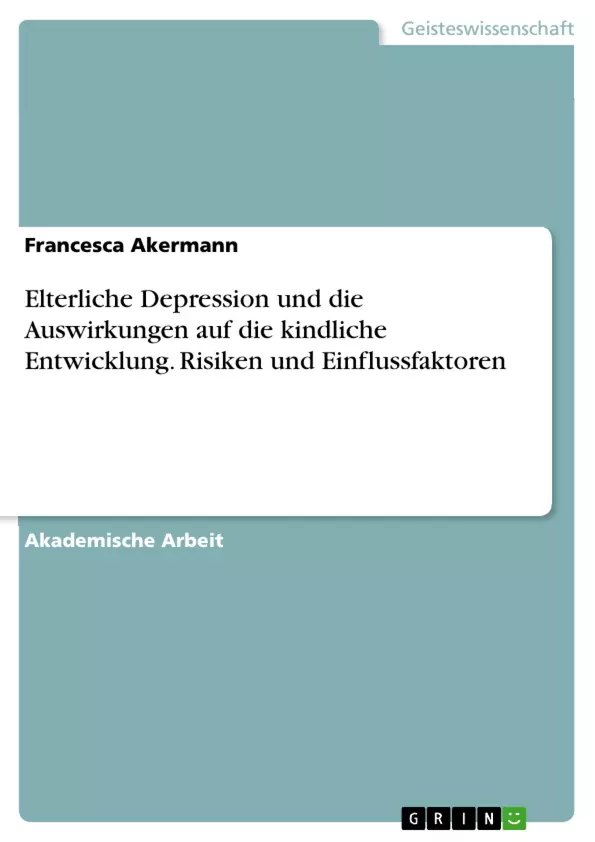Diese Arbeit beleuchtet, wie sich eine psychische Störung der Eltern – vor allem aber die der Mutter – auf die Kindesentwicklung auswirken kann. Zuerst erläutere ich hierfür zentrale Begriffe und beschreibe meine Literaturrecherche. Danach beziehe ich mich auf die Belastungen und Risiken, denen Kinder ausgesetzt sein können. Ich stelle zudem auch dar, welche spezifischen Gefahren eine Depression mit sich bringt und wie diese Krankheit Einfluss auf das Erkrankungsrisiko des Nachwuchses nehmen kann. Abschließend diskutiere ich die Inhalte und gebe ein persönliches Fazit.
Psychische Störungen betreffen in Deutschland ca. 30 Prozent der Gesellschaft. Durch mehrfache Überprüfung in Studien konnte belegt werden, dass von den Betroffenen wiederum 30 Prozent minderjährigen Nachwuchs haben. Die psychisch erkrankten Eltern sind vor allem von affektiven Störungen und damit auch Depressionen betroffen. Dieses Krankheitsbild betrifft circa 36 Prozent der erkrankten Eltern.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Zentrale Begriffe
- Methoden der Literaturrecherche
- Belastungen für die Kinder
- Belastungsfaktoren im Familienbund
- Gefühlswelten des Kindes
- Risiken für die Kinder
- Genetische Risiken
- Elterliche Erkrankung als Risiko
- Risiken des Alters und Geschlechts
- Individuelle Risikofaktoren der Kinder
- Spezifisches Risiko durch die Depression
- Depressive Mütter
- Postnatale Depression
- Erkrankungsrisiko der Kinder
- Diskussion der Ergebnisse
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Belastungen und Risiken, denen Kinder durch die psychische Erkrankung eines Elternteils ausgesetzt sein können. Sie untersucht, wie eine elterliche Depression, insbesondere der Mutter, die kindliche Entwicklung beeinflussen kann.
- Definition und Auswirkungen von psychischen Störungen, insbesondere Depression, auf Eltern und Kinder
- Belastungsfaktoren für Kinder im Familienkontext, insbesondere durch eine elterliche Depression
- Risikofaktoren für die kindliche Entwicklung, die durch eine elterliche Depression entstehen können
- Spezifische Risiken, die mit einer Depression der Mutter und einer postnatalen Depression verbunden sind
- Einfluß einer elterlichen Depression auf das Erkrankungsrisiko des Kindes
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz der Thematik dar und beleuchtet die Verbreitung psychischer Erkrankungen, insbesondere Depression, in Deutschland. Die Arbeit verdeutlicht das persönliche Interesse des Autors an der Thematik und die Motivation, die Auswirkungen einer elterlichen Depression auf die Kindesentwicklung zu erforschen.
Kapitel 2 definiert zentrale Begriffe wie psychische Störungen und Depression. Es wird darauf eingegangen, dass Depressionen verschiedene Schweregrade haben und sich auf den Alltag der Betroffenen stark auswirken können.
Kapitel 3 erläutert die Methodik der Literaturrecherche, die Datenbanken, die Suchbegriffe und die Auswahlkriterien für die verwendeten Publikationen.
Kapitel 4 behandelt die Belastungen, denen Kinder durch psychisch gestörte Eltern ausgesetzt sein können. Es werden die Auswirkungen auf die familiäre Struktur, die Rollenverteilung und das Erleben des Kindes beleuchtet. Zudem wird das Phänomen der Parentifizierung erklärt.
Kapitel 5 analysiert die Risiken für Kinder, die durch eine elterliche Erkrankung entstehen können. Dazu gehören genetische Risiken, das Risiko der eigenen Erkrankung und auch das Risiko, welches sich aus Alter und Geschlecht des Kindes ergibt.
Kapitel 6 befasst sich mit dem spezifischen Risiko einer elterlichen Depression. Es werden die Auswirkungen einer depressiven Mutter, die Gefahren einer postnatalen Depression und das daraus resultierende Erkrankungsrisiko des Kindes betrachtet.
Schlüsselwörter
Psychische Störungen, Depression, elterliche Erkrankung, Kindesentwicklung, Belastungen, Risiken, Parentifizierung, genetische Risiken, postnatale Depression, Erkrankungsrisiko, Resilienz, Coping.
Häufig gestellte Fragen
Wie wirkt sich eine elterliche Depression auf Kinder aus?
Eine elterliche Depression kann die emotionale Verfügbarkeit der Eltern einschränken, was die kindliche Entwicklung stören und das Risiko für eigene psychische Erkrankungen des Kindes erhöhen kann.
Was versteht man unter Parentifizierung?
Parentifizierung beschreibt eine Rollenumkehr, bei der das Kind die Verantwortung für die emotionalen oder praktischen Bedürfnisse des erkrankten Elternteils übernimmt und so überfordert wird.
Welche spezifischen Risiken birgt die postnatale Depression?
Sie gefährdet die frühe Bindung zwischen Mutter und Säugling, was langfristige negative Folgen für die soziale und emotionale Entwicklung des Kindes haben kann.
Spielen genetische Faktoren eine Rolle?
Ja, neben Umweltfaktoren und Belastungen im Familienbund gibt es auch genetische Risiken, die die Anfälligkeit für Depressionen an die nächste Generation weitergeben können.
Wie wichtig sind Resilienz und Coping für betroffene Kinder?
Resilienzfaktoren und gesunde Bewältigungsstrategien (Coping) helfen Kindern, trotz der Belastungen durch die elterliche Erkrankung eine gesunde Entwicklung zu nehmen.
- Arbeit zitieren
- Francesca Akermann (Autor:in), 2018, Elterliche Depression und die Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung. Risiken und Einflussfaktoren, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1275281