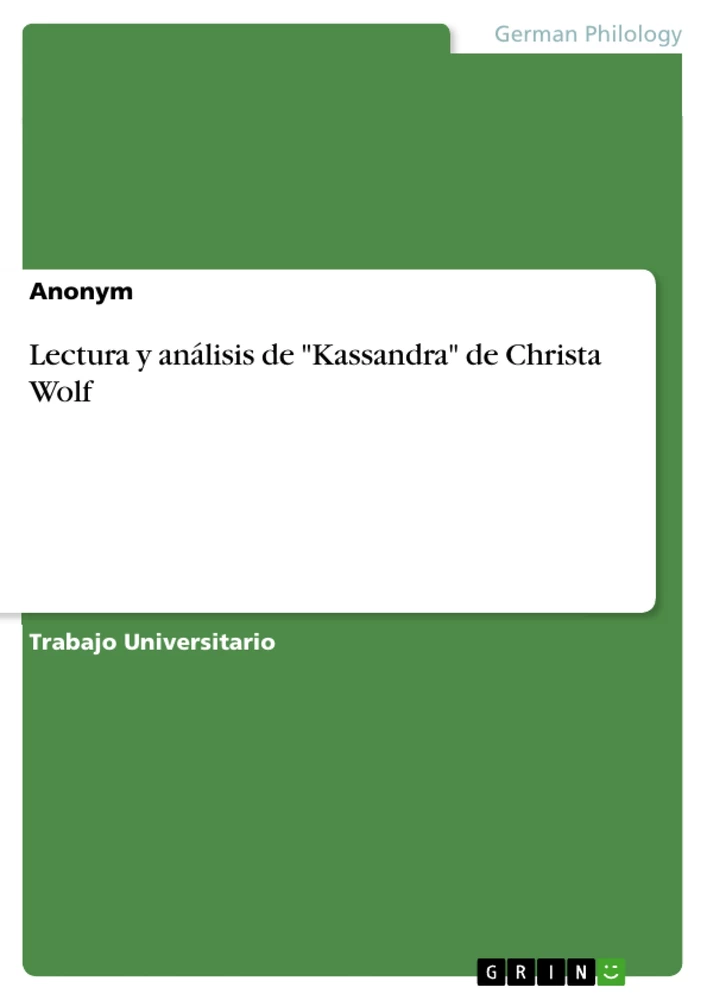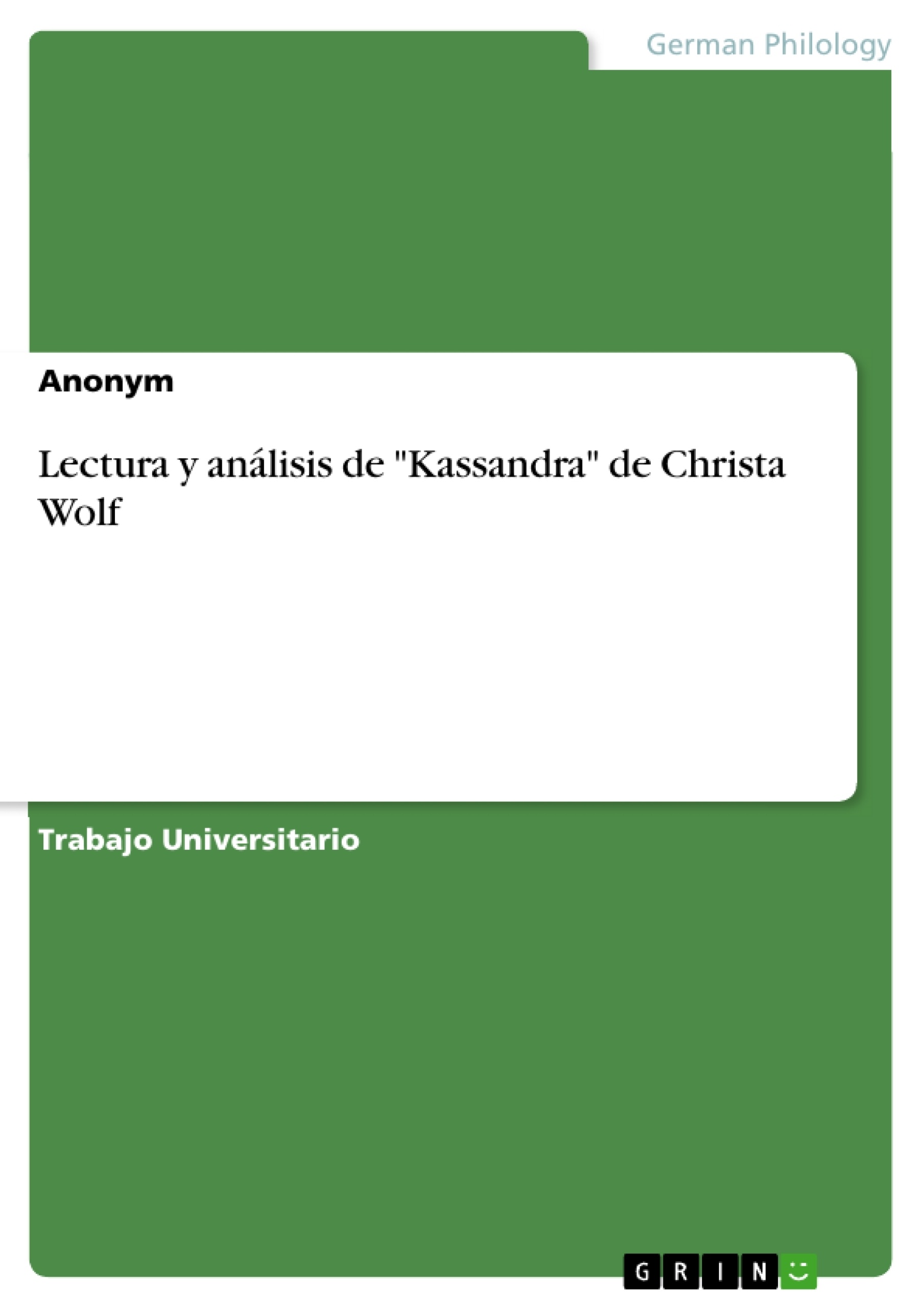Se elabora aquí un comentario de una obra, un análisis abierto, sin preguntas preestablecidas, en el que se ha intentado plasmar la teoría asimilada con la lectura de los libros de la Bibliografía básica (sección IV) y de la Bibliografía complementaria (sección V). La obra en cuestión es Kassandra (1983) de Christa Wolf (1929-2011), una de las figuras más relevantes de la literatura alemana de la segunda mitad del siglo XX.
El presente trabajo se enmarca en la asignatura “La tradición clásica en la literatura occidental” del Máster Universitario en el mundo clásico y su proyección en la cultura occidental, cuyo objeto de estudio es la recepción que ha hecho la literatura occidental del mundo clásico.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung.
- II. Analyse der Werk "Kassandra" von Christa Wolf
- a. Struktur des Werkes und narrative Techniken
- b. Zwei Hauptmerkmale des Werkes
- c. Der Charakter Kassandra
- d. Die weiblichen Figuren
- III. Abschließende Reflexion und Schlussfolgerungen.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text analysiert Christa Wolfs Roman „Kassandra" im Kontext der Rezeption der klassischen Literatur im Westen. Die Arbeit zielt darauf ab, die Struktur, die narrativen Techniken und die wichtigsten Themen des Romans zu untersuchen, wobei ein besonderes Augenmerk auf die Darstellung des Charakters Kassandra und der weiblichen Figuren im Werk gelegt wird.
- Die Rezeption klassischer Literatur im Westen
- Struktur und narrative Techniken in "Kassandra"
- Die Rolle der Frauen in der klassischen Literatur
- Die Stimme des Unterdrückten in der Geschichte
- Die Relevanz von "Kassandra" im 20. Jahrhundert
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Kontext des Werkes "Kassandra" von Christa Wolf vor, indem sie die Rezeption klassischer Literatur im Westen und den Fokus der Arbeit auf die Analyse dieses Romans erklärt. Sie führt auch die Bedeutung von "Kassandra" im Kontext des 20. Jahrhunderts und die Rolle der Frauen in der klassischen Literatur ein.
Die Analyse der Werk "Kassandra" wird sich auf die Struktur und die narrativen Techniken des Romans konzentrieren. Sie wird die wichtigsten Themen des Werkes untersuchen, insbesondere die Darstellung von Kassandra als Charakter und die weiblichen Figuren im Roman. Der Text wird sich auch mit der historischen und kulturellen Relevanz von "Kassandra" und den Bezügen zum klassischen Mythos beschäftigen.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter für diese Arbeit sind: Christa Wolf, Kassandra, klassische Literatur, Rezeption, Struktur, narrative Techniken, Frauen in der Literatur, Unterdrückung, Geschichte, 20. Jahrhundert, Mythos.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der zentrale Gegenstand dieser literarischen Analyse?
Gegenstand ist der Roman "Kassandra" (1983) von Christa Wolf, einer der bedeutendsten Autorinnen der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts.
In welchem akademischen Kontext steht diese Arbeit?
Die Arbeit befasst sich mit der Rezeption der klassischen Antike in der westlichen Literatur und deren Projektion in die moderne Kultur.
Welche narrativen Techniken werden in "Kassandra" untersucht?
Die Analyse betrachtet die Struktur des Werkes sowie die spezifischen Erzähltechniken, die Christa Wolf verwendet, um den antiken Mythos neu zu deuten.
Wie werden die weiblichen Figuren im Roman dargestellt?
Ein Schwerpunkt liegt auf der Stimme der Unterdrückten und der Rolle der Frauen in der klassischen Literatur, personifiziert durch den Charakter Kassandra.
Warum ist "Kassandra" für das 20. Jahrhundert so relevant?
Die Arbeit untersucht, wie Wolf den Mythos nutzt, um zeitgenössische Themen wie Macht, Krieg und die Unterdrückung von Frauen zu reflektieren.
Was ist das Ziel der "abschließenden Reflexion" in der Arbeit?
Sie zieht Schlussfolgerungen über die Bedeutung von Wolfs Werk für das Verständnis der klassischen Tradition heute.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2022, Lectura y análisis de "Kassandra" de Christa Wolf, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1275730