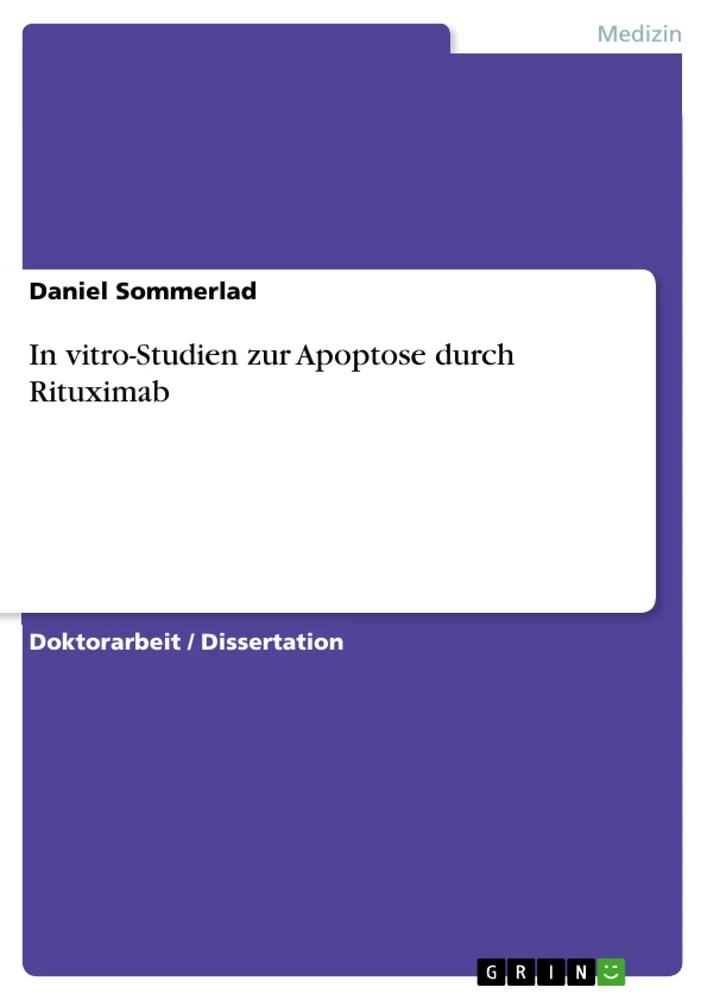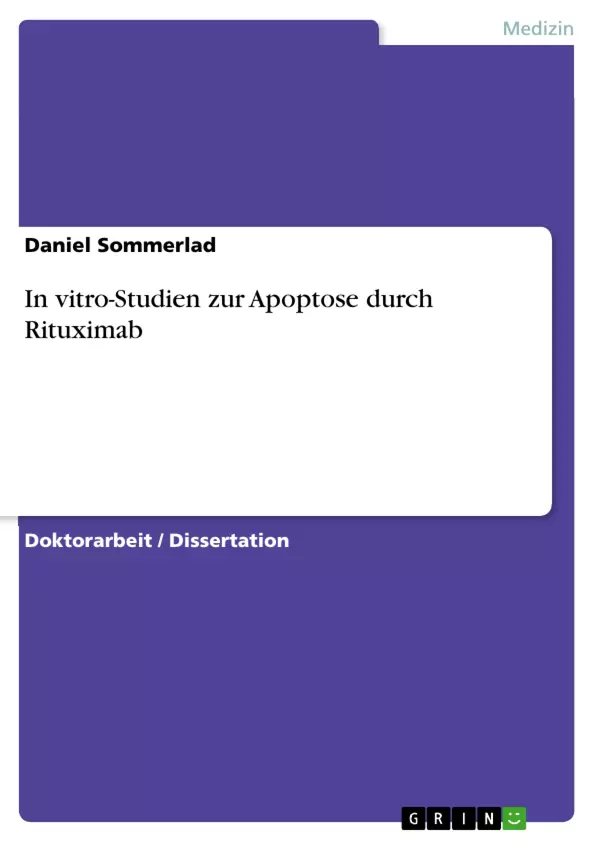Obwohl es bereits seit dem Altertum gewisse Kenntnisse über die
tumorreduzierende Wirkung von Pflanzen und Mineralien gab, konnte erstmals
der Breslauer Neurologe Heinrich Lissauer im Jahr 1865 in einer
wissenschaftlichen Arbeit über positive Effekte einer Chemotherapie bei
chronischer myeloischer Leukämie (CML) berichten.1 Zwei Patienten mit CML
zeigten Zeichen einer Teilremission, nachdem sie mit Kaliumarsenit (Fowler'sche
Lösung) behandelt worden waren, ein Effekt, der 1931 durch C. E. Forkner
wiederentdeckt wurde.2 1892 berichtete William B. Coley über antineoplastische
Effekte von Bakteriengiften (ein Bakterientoxin–Cocktail namens "Coley's Toxin")
auf verschiedene Tumoren, entdeckt als eine Nebenwirkung von postoperativen
Wundinfekten bei Sarkompatienten.
Mit der Entwicklung von Salvarsan (1909) gilt Paul Ehrlich als Begründer der
modernen Chemotherapie, obgleich diese Substanz weniger antineoplastische als
vielmehr antibakterielle Wirkung hatte.3,4 Einen mehr biologischen Weg wählte
sein Freund und zugleich Konkurrent Emil von Behring, der bereits zwanzig
Jahre zuvor mit der Serumtherapie den Grundstein der heutigen Immuntherapie
gelegt hatte.5
Die Entwicklung von Senfgas (Lost) durch Alfred Gilman im 1. Weltkrieg richtete
das Augenmerk auf eine Substanz, die neben der Wirkung als Reiz– und
Kampfgas auch starke myelosuppressive Effekte aufwies (u.a. reduzierte
Lymphozytenzahl). Um die Giftigkeit zu reduzieren, wurden Schwefel– und später
Stickstofflostverbindungen hergestellt, die allerdings immer noch sehr toxisch
waren. Die ersten klinischen Arbeiten über die Anwendung von Stickstofflost bei
Lymphomen und soliden Tumoren wurden erst nach dem 2. Weltkrieg
veröffentlicht.6 [...]
1. Lissauer H. Zwei Fälle von Leucaemie. Berl Klin Wochenschr. 1865;2:403-405
2. Forkner C, Scott, TF. Arsenic as a therapeutic agent in chronic myeloid leukemia.
JAMA. 1931;97:3
3. Die Behandlung der Syphilis mit dem Ehrlichschen Präparat 606. 82. Versammlung
Deutscher Naturforscher und Aerzte. Königsberg; 1910:1889-1924
4. Ehrlich P, Hata, S. Die experimentelle Chemotherapie der Spirillosen. Berlin: Julius
Springer; 1910
5. Behring E. Über das Zustandekommen der Diphtherie-Immunität und der Tetanus-
Immunität bei Thieren. DMW. 1890;16:1113-1114
6. Goodman L, Wintrobe, MM, Dameshek, W, Goodman, MJ, Gilman, A, and McLennan,
MT. Nitrogen Mustard Therapy. Journal of the American Medical Association. 1946:126-
132
Inhaltsverzeichnis
- Erstes Kapitel.
- In vitro-Studien mit Rituximab. Einführung.
- Einführung und Fragestellung.
- Geschichte der Chemotherapie.
- Fragestellung.
- Herstellung monoklonaler Antikörper.
- Herstellung chimärer Antikörper (Rituximab).
- Eigenschaften des CD20-Antigens.
- Apoptose.
- Material und Methoden.
- Reagenzien.
- Zytostatika.
- Antikörper.
- Caspase-Inhibitoren.
- Zelllinien.
- Arbeitsmaterialien.
- Software.
- Rezepte der Gebrauchlösungen.
- Zellkultur.
- Zellseparation mit Ficoll-Hypaque.
- Zellzählung.
- Das Durchflusszytometer (FACS).
- Apoptosemessung mit 7-AAD, JC-1 und Annexin.
- Auswertung der Apoptosemessungen.
- Messung der CD20-Bindungskapazität.
- Western Blotting.
- Ergebnisse.
- Dosisfindung von Rituximab und Untersuchung der Apoptose.
- Untersuchung der komplementabhängigen Zytotoxizität (CDC).
- Kombinationen von Rituximab mit Zytostatika.
- Untersuchung der Caspasen mittels Western Blots (DOHH2).
- Diskussion.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Dissertation untersucht die Wirkung von Rituximab, einem monoklonalen Antikörper, auf die Apoptose von Lymphomzellen. Ziel ist es, die Wirksamkeit und den Mechanismus der Apoptoseinduktion durch Rituximab in vitro zu analysieren. Dabei werden verschiedene Aspekte der Apoptose, wie die Caspase-Aktivierung und die komplementabhängige Zytotoxizität (CDC), in den Fokus genommen.
- Apoptoseinduktion durch Rituximab
- Wirkmechanismus von Rituximab
- Caspasen-Aktivierung
- Komplementabhängige Zytotoxizität (CDC)
- Kombination von Rituximab mit Zytostatika
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit der Einführung und der Fragestellung der Dissertation. Es gibt einen Überblick über die Geschichte der Chemotherapie und beschreibt die Herstellung monoklonaler Antikörper, insbesondere von Rituximab. Das Kapitel beleuchtet die Eigenschaften des CD20-Antigens, das Zielmolekül von Rituximab, und erklärt den Prozess der Apoptose. Das zweite Kapitel beschreibt die Materialien und Methoden, die in der Dissertation verwendet wurden. Es werden Reagenzien, Zytostatika, Antikörper, Caspase-Inhibitoren, Zelllinien und Arbeitsmaterialien detailliert beschrieben. Darüber hinaus werden die Methoden zur Zellkultur, Zellseparation, Zellzählung, Durchflusszytometrie, Apoptosemessung und Western Blotting vorgestellt. Im dritten Kapitel werden die Ergebnisse der in-vitro-Studien präsentiert. Die Untersuchungen umfassen die Dosisfindung von Rituximab und die Untersuchung der Apoptoseinduktion, die komplementabhängige Zytotoxizität (CDC) sowie die Kombination von Rituximab mit Zytostatika. Die Ergebnisse der Caspasen-Untersuchungen mittels Western Blots werden ebenfalls dargestellt.
Schlüsselwörter
Rituximab, Apoptose, Lymphomzellen, CD20-Antigen, Caspasen, komplementabhängige Zytotoxizität (CDC), in vitro-Studien, Chemotherapie, monoklonale Antikörper.
Häufig gestellte Fragen
Wie wirkt Rituximab bei der Behandlung von Lymphomen?
Rituximab ist ein monoklonaler Antikörper, der spezifisch an das CD20-Antigen auf Lymphomzellen bindet und dort den programmierten Zelltod (Apoptose) einleitet.
Was versteht man unter Apoptose?
Apoptose ist ein natürlicher Prozess des programmierten Zelltods, der vom Körper genutzt wird, um geschädigte oder nicht mehr benötigte Zellen sicher zu entfernen.
Was ist das CD20-Antigen?
CD20 ist ein Oberflächenprotein, das fast ausschließlich auf B-Lymphozyten vorkommt, was es zu einem idealen Ziel für Therapien gegen B-Zell-Lymphome macht.
Was ist komplementabhängige Zytotoxizität (CDC)?
Die CDC ist ein Wirkmechanismus, bei dem der Antikörper das körpereigene Komplementsystem aktiviert, um die Zielzelle direkt zu zerstören.
Können Rituximab und Chemotherapie kombiniert werden?
Ja, in-vitro-Studien zeigen, dass die Kombination von Rituximab mit Zytostatika die Wirksamkeit der Behandlung oft steigern kann.
- Arbeit zitieren
- Daniel Sommerlad (Autor:in), 2003, In vitro-Studien zur Apoptose durch Rituximab, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/12758