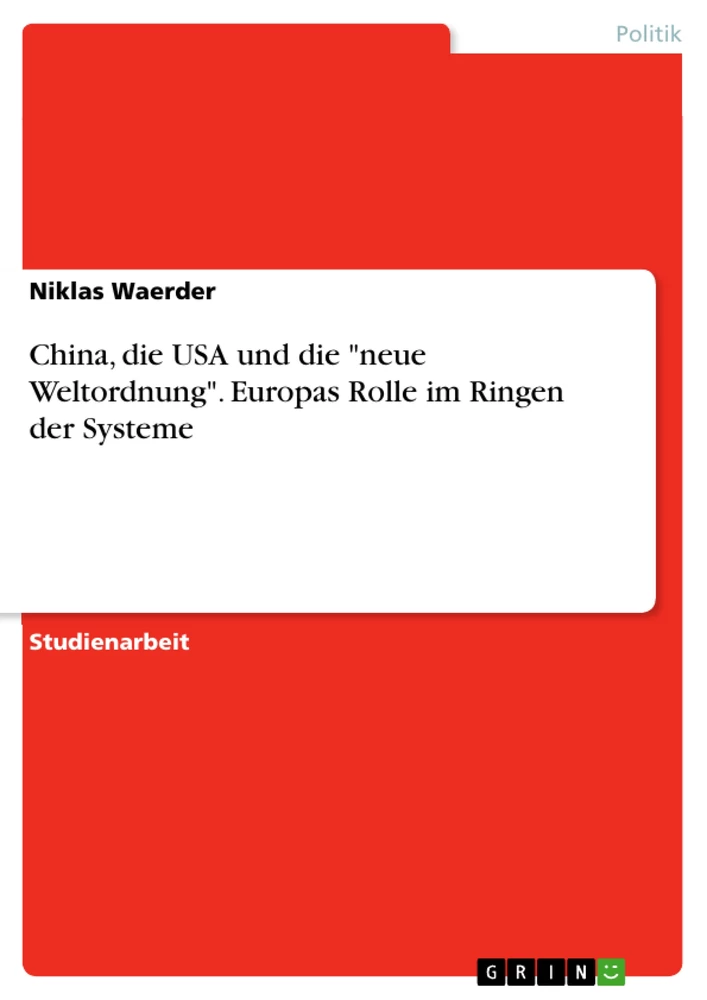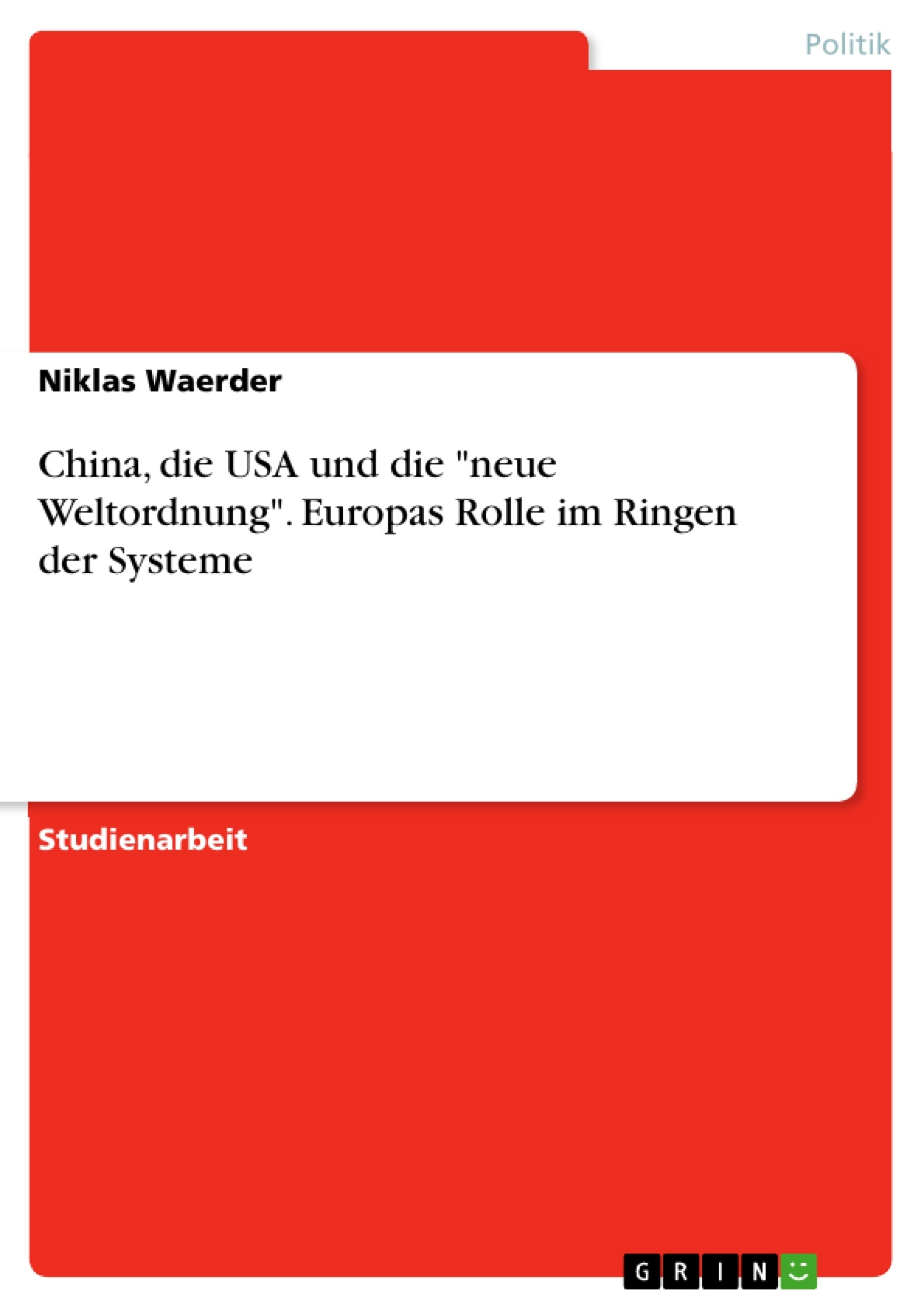China entwickelte sich in wenigen Jahrzehnten von einem armen Land zur zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt. Heute ist Chinas politischer und wirtschaftlicher Einfluss überall spürbar. Die "neue Seidenstraße", Chinas Militärbasis in
Dschibuti oder der 17+-Gipfel veranschaulichen die Großmachtambitionen der Volksrepublik. In der „neuen Weltordnung“ spielt das autoritär regierte Land längst eine führende Rolle und setzt ein alternatives, erfolgreiches System zur westlichen Demokratie. Die USA haben sich in diesem "Ringen der Systeme" bereits unter Obama und Trump klar gegen Chinas wachsenden Einfluss gestellt und versuchten, ihre Vormachtstellung und ihr demokratisches System gegenüber der Volksrepublik zu verteidigen. Auch in der Europäischen Union (EU) nimmt der Diskurs über eine Positionierung gegenüber China und in der "neuen Weltordnung" zu. Im aktuellen Außenministertreffen der EU vom 13.07.2021 war der zukünftige Umgang mit der Volksrepublik das bestimmende Thema.
Vor diesem Hintergrund stellt sich die drängende Frage: Wie sollte sich die EU im Hinblick auf Chinas wachsenden Einfluss und die neue Weltordnung positionieren? Zur Beantwortung dieser Frage wird zunächst die „neue Weltordnung“ und das daraus resultierende „Ringen der Systeme“ analysiert. Dabei wird die Staatsform, Bedeutung und Regierungsweise Chinas als Gegenmodell zur westlichen Demokratie erklärt. Im zweiten Teil dieser Arbeit werden Handlungsempfehlungen bzw. Leitlinien zum zukünftigen Verhältnis mit den USA sowie einer europäischen China-Politik erarbeitet.
Abschließend folgt ein Ausblick über die Chance, die die neue Weltordnung für die europäische Außenpolitik darstellt. Ziel dieser Arbeit kann aus zeitökonomischen Gründen nicht sein, eine genaue China-Politik zu erarbeiten, sondern grundlegende Ideen zur Positionierung vor dem aktuellen Hintergrund auszuarbeiten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die „neue\" Weltordnung
- Russland und Amerika
- China: Aufstrebende Weltmacht
- Fazit: Die „neue“ Weltordnung
- Das Ringen der Systeme
- Europäische Positionierung in der neuen Weltordnung
- Aktuelles Verhältnis zwischen der EU und China
- Leitidee einer europäischen Positionierung gegenüber den USA
- Leitideen einer europäischen China-Politik
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die „neue Weltordnung“ und das daraus resultierende „Ringen der Systeme“ mit dem Fokus auf Chinas Aufstieg zur Weltmacht. Sie befasst sich mit den Herausforderungen, die dieser Aufstieg für die Europäische Union (EU) darstellt und erarbeitet Handlungsempfehlungen für eine europäische China-Politik.
- Die „neue Weltordnung“ als Folge des Abschlusses der unipolaren Weltordnung unter US-amerikanischer Hegemonie
- Chinas Aufstieg zur Weltmacht und das alternative System der Volksrepublik
- Das „Ringen der Systeme“ zwischen China und den USA
- Europäische Positionierung im Kontext der „neuen Weltordnung“
- Leitlinien für eine europäische China-Politik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Bedeutung von Chinas Aufstieg als Weltmacht und stellt die zentrale Frage der Arbeit: Wie sollte sich die EU gegenüber Chinas Einfluss und der „neuen Weltordnung“ positionieren? Der erste Teil analysiert die „neue Weltordnung“, insbesondere den Niedergang Russlands als Weltmacht und die Herausforderungen, denen die USA in ihrer Rolle als einstige Hegemonialmacht gegenüberstehen. Der Fokus liegt dabei auf dem Aufstieg Chinas und dessen politischem und wirtschaftlichen Einfluss.
Der zweite Teil konzentriert sich auf die Herausforderungen, die der Aufstieg Chinas für die EU darstellt. Es werden das aktuelle Verhältnis zwischen der EU und China sowie die Notwendigkeit einer klaren Positionierung gegenüber den USA und China beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen „neue Weltordnung“, „Ringen der Systeme“, „China als Weltmacht“, „europäische Positionierung“, „China-Politik“, „EU-China-Beziehungen“, „US-China-Konflikt“ und „alternative Systeme“.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet das „Ringen der Systeme“ zwischen China und den USA?
Es beschreibt den globalen Wettbewerb zwischen dem westlich-demokratischen Modell der USA und dem autoritär-staatskapitalistischen Modell Chinas um politischen und wirtschaftlichen Einfluss.
Welche Rolle spielt die EU in der neuen Weltordnung?
Die EU steht vor der Herausforderung, eine eigenständige Position zu finden, die einerseits die Wertepartnerschaft mit den USA wahrt und andererseits die wirtschaftliche Realität der Beziehungen zu China berücksichtigt.
Was sind Chinas Großmachtambitionen?
China verfolgt Projekte wie die „Neue Seidenstraße“, baut Militärbasen (z. B. in Dschibuti) aus und nutzt Wirtschaftsgipfel, um seine Rolle als führende Weltmacht zu festigen.
Wie sollte eine europäische China-Politik aussehen?
Die Arbeit schlägt Leitlinien vor, die auf Einigkeit innerhalb der EU, dem Schutz kritischer Infrastruktur und einer Balance zwischen Kooperation und systemischer Rivalität basieren.
Warum ist China ein Gegenmodell zur westlichen Demokratie?
China zeigt, dass wirtschaftlicher Erfolg auch ohne westliche demokratische Strukturen möglich ist, was für viele Schwellenländer als attraktive Alternative zum westlichen Modell wahrgenommen wird.
- Quote paper
- Niklas Waerder (Author), 2021, China, die USA und die "neue Weltordnung". Europas Rolle im Ringen der Systeme, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1276168