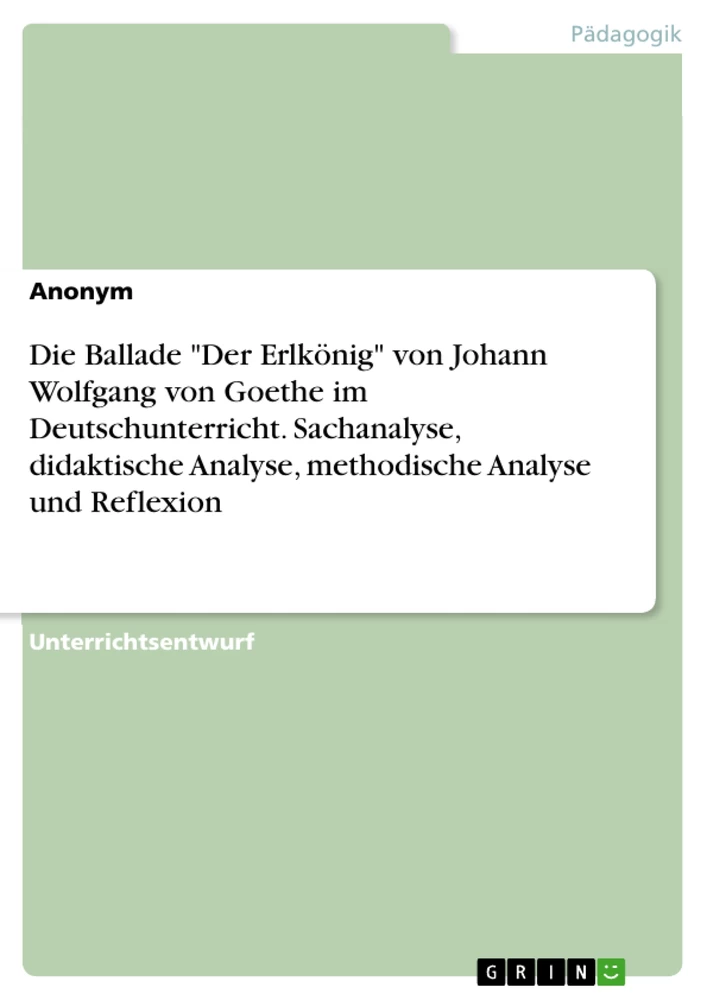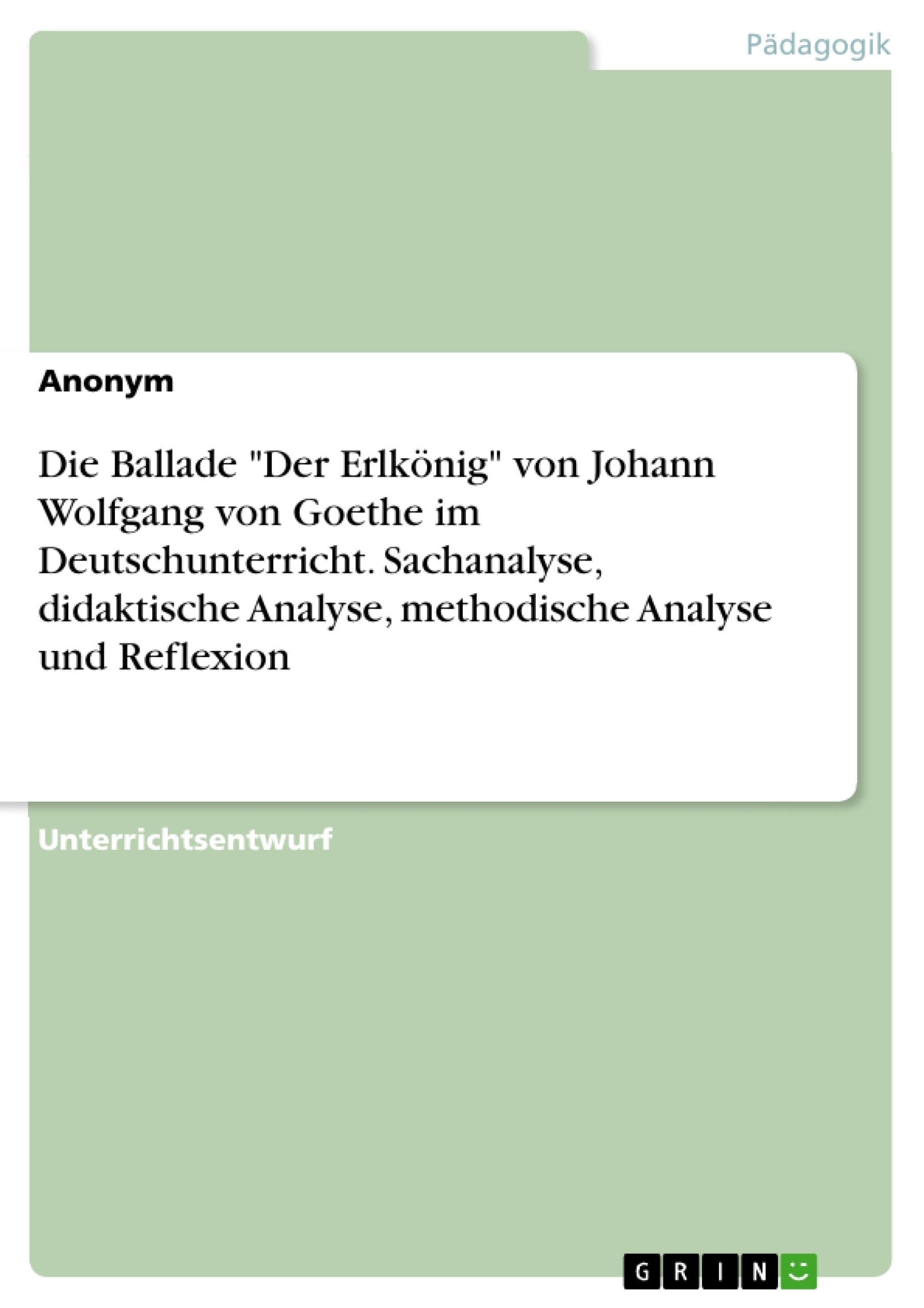In dieser Unterrichtsstunde wird die Ballade "Der Erlkönig" aus dem Jahr 1782, welche von Johann Wolfgang von Goethe verfasst wurde, behandelt. Sie besteht aus acht Strophen mit je vier Versen und wird der Epoche des Sturm und Drangs zugeordnet. Diese Ballade stellt einen festen Bestandteil des Literaturunterrichts in der Sekundarstufe I dar.
Die berühmte und weit verbreitete Ballade „Der Erlkönig“ verkörpert eine besonders herausfordernde Form der Lyrik, da die Schwierigkeit der Textform sowie das Interpretieren des Geschehens eine große Herausforderung für die SuS darstellen. Außerdem weist sie die stereotypischen Charakteristika einer Ballade wie das Auftreten mehrerer Strophen sowie das Erzählen hochdramatischer Begebenheiten auf. Auch die Thematik der Ballade erhellt sich für die SuS nicht oder nur schwierig durch einmaliges Lesen, weshalb der Anspruch an die Erarbeitung dieser steigt.
Inhaltsverzeichnis
- Lernziel der Stunde
- Unterrichtsstunde in Klasse 7
- Sachanalyse
- Didaktische Analyse
- Methodische Analyse
- Reflexion
- Literaturverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Unterrichtsstunde hat zum Ziel, die Ballade „Der Erlkönig“ von Johann Wolfgang von Goethe eigenständig zu erschließen. Die SuS sollen dabei die Sprecherrollen selbstständig zuordnen und erste Deutungen des Textes entwickeln.
- Interpretation der Ballade „Der Erlkönig“
- Analyse des Handlungsverlaufs
- Erkennung der verschiedenen Sprecherrollen
- Entwicklung eigener Deutungen des Textes
- Einsatz handlungsorientierter und produktionsorientierter Aufgaben
Zusammenfassung der Kapitel
Lernziel der Stunde
Das Lernziel der Unterrichtsstunde ist die eigenständige Erschließung des Inhaltes der Ballade „Der Erlkönig“ von Johann Wolfang von Goethe. Des Weiteren sollen die SuS selbstständig die Aufteilung der Sprecherrollen festlegen sowie erste Vermutungen der Deutung des Textes entwickeln.
Hinweis: Die Unterrichtsstunde ist auf 90 Minuten angelegt.
Unterrichtsstunde in Klasse 7
Thema der UE: Umgang mit literarischen Texten (1. Std.)
US: Sinnhafte Erschließung der Ballade „Der Erlkönig“
| Zeit | Phase | Lehrerverhalten | (erwartetes) Schülerverhalten | Sozialform | Medien |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00-8:10 | Einstieg | 1. L. begrüßt die Klasse.
2. L. projiziert Bild vom Erlkönig an die Wand & fragt die SUS, was sie darauf erkennen können. |
1. SUS begrüßen L.
2. SUS benennen alles, was auf dem Bild erkennbar ist & bekommen erste Überlegungen hinsichtlich des Hintergrundes. |
UG | Beamer |
| 8:10-8:25 | Problematisierung | 1. L. verteilt die Ballade „Der Erlkönig“ von J. Goethe.
2. L. fragt die SUS, wer vorlesen möchte & sucht sich daraufhin jemanden aus. |
1. SUS erhalten die Ballade.
2. SUS melden sich freiwillig, um die Ballade vorzulesen. |
UG | AB |
| 8:25-9:00 | Erarbeitung | 3. L. fragt die SUS, ob jemand in einem Satz die Thematik der Ballade zusammenfassen kann.
4. L. erklärt den SUS, dass es etwas Zeit benötigt, eine Ballade zu erschließen, öffnet die Tafel & verweist auf das Tafelbild mit dem zugehörigen Arbeitsauftrag. L. liest den Arbeitsauftrag vor: „Versuche für jeden Vers der Ballade,,Der Erlkönig“ den jeweiligen Sprecher zu finden & markiere den Vers in der zugehörigen Farbe\" (15 Minuten Bearbeitungszeit). |
1. SUS erkennen, dass es schwer fällt, den Inhalt der Ballade nach lediglich einmal Lesen zu erschließen und inhaltlich zusammenzufassen.
2. SUS verstehen, dass sie Arbeit investieren müssen, um die Ballade verstehen zu können & lesen sich den Arbeitsauftrag an der Tafel durch. |
Tafel | EA |
| 9:00-9:25 | Sicherung | 1. L. fordert die SUS dazu auf, ihre Ergebnisse mit dem jeweiligen Sitznachbarn zu überprüfen & daraufhin zu versuchen, die Handlung & Deutung der Ballade gemeinsam zu erschließen.
2. L. beendet die Partnerarbeit & verteilt die Rollen Erzähler, Erlkönig, Vater & Kind, um die Ballade mit dem jeweiligen Sprecher vorzutragen. 3. L. hört den SUS beim Vortragen aufmerksam zu und verbessert ggf. die Sprecherrolle. 4. L. fragt die SUS, ob sie erste Vermutungen hinsichtlich des Handlungsstranges & Deutung haben & somit wird die Handlung in einem offenen Unterrichtsgespräch gemeinsam erschlossen. |
1. SUS bearbeiten konzentriert den Arbeitsauftrag, indem sie für jeden Vers den jeweiligen Sprecher herausfinden & werden somit mit dem Inhalt der Ballade weiter vertraut gemacht.
2. SUS überprüfen in Partnerarbeit ihre Ergebnisse & verbessern sich gegenseitig. Sie besprechen daraufhin den vermuteten Handlungsstrang der Ballade. 3. Die SUS melden sich freiwillig für das Vortragen der jeweiligen Rollen. 4. Die SUS tragen die Ballade flüssig und betont mit den passenden Sprecherrollen vor. |
AB
PA UG AB UG |
|
| 9:25-9:30 | Didaktische Reserve/Hausaufgabe | 1. L. gibt den Arbeitsauftrag: „Versuche den Inhalt der Ballade,,Der Erlkönig“ von J. W. v. Goethe in einer Inhaltsangabe zusammenzufassen“ (wenn noch Zeit ist, kann in der Unterrichtsstunde angefangen werden; ansonsten dient der Arbeitsauftrag als Hausaufgabe). | 1. Die SUS wenden ihre bisher erworbenen Kenntnisse über die Ballade an und versuchen somit, den Inhalt in ihren eigenen Worten zusammenzufassen. | UG |
Sachanalyse
In dieser Unterrichtsstunde wird die Ballade „Der Erlkönig“ aus dem Jahr 1782, welche von Johann Wolfang von Goethe verfasst wurde, behandelt. Sie besteht aus acht Strophen mit je vier Versen und wird der Epoche des Sturm und Drangs zugeordnet.
Diese Ballade stellt einen festen Bestandteil des Literaturunterrichts in der Sekundarstufe I dar. „Balladen, die streng genommen als kurze Erzählungen in Versform näher zu bestimmen sind und somit auch in den Bereich der Epik fallen, werden heute breitgefächert behandelt und gehören zu den beliebten Gattungen des Deutschunterrichts (...).\"1
Die berühmte und weit verbreitete Ballade „Der Erlkönig“ verkörpert eine besonders herausfordernde Form der Lyrik, da die Schwierigkeit der Textform sowie das Interpretieren des Geschehens eine große Herausforderung für die SuS darstellen. Außerdem weist sie die stereotypischen Charakteristika einer Ballade wie das Auftreten mehrerer Strophen sowie das Erzählen hochdramatischer Begebenheiten auf. Auch die Thematik der Ballade erhellt sich für die SuS nicht oder nur schwierig durch einmaliges Lesen, weshalb der Anspruch an die Erarbeitung dieser steigt.
In einer stürmischen Nacht reitet ein Vater mit seinem kleinen Sohn durch einen dunklen Wald. Der Sohn erwähnt wiederholend, dass er die Gestalt des Erlkönigs sehe, woraufhin der Vater dies mit der Sichtung eines ‘Nebelstreifs' begründet. Der Erlkönig versucht, das Kind zu verführen, indem er ihm zukünftige Versprechungen macht, wie der Eintritt in sein Reich, um von seinen Töchtern verwöhnt zu werden. Obwohl der Vater versucht, für die Halluzinationen seines Sohnes naturbelassene Erklärungen zu finden, steigert sich die Furcht des Kindes. Als der Erlkönig gegen Ende der Ballade immer bedrohlicher wird, indem er äußert, sei das Kind nicht willig, benötige er Gewalt, wächst die Panik des Kindes sowie die des Vaters. Mit seinem leidenden Sohn im Arm reitet er noch schneller zum heimatlichen Hof, doch dort angekommen, ist der Sohn in seinen Armen bereits tot.2
Die düstere Grundstimmung der Ballade sowie das dramatische Ende machen die Faszination dieses Werkes aus. Durch die nicht vorhandene Markierung der Sprecherrollen (Erlkönig, Sohn, Vater, Erzähler) wird die Erschließung des Handlungsstranges erschwert und muss vorerst von den SuS herausgearbeitet werden.
Auch gibt es diverse Interpretationsansätze, welche die Erscheinung des Erlkönigs begründen können. Beispielhaft kann zum einen das Auftreten des Erlkönigs als eine halluzinogene Erscheinung des Kindes wahrgenommen werden, welche durch hohes Fieber ausgelöst wird: „Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht? Den Erlenkönig mit Kron' und Schweif? Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif.“ Zum anderen kann die Ballade jedoch auch als eine vom Erlkönig ausgehende sexuelle Vergewaltigung des Kindes interpretiert werden: „Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt; Und bist du nicht willig; so brauch' ich Gewalt.“4 Doch ungeachtet, welche der diversen Deutungen dem ursprünglichen Gedanken des Autors am nächsten kommen, handelt die Ballade fundamental von der Angst des Kindes angesichts der Aufdringlichkeit des Erlkönigs.
Somit bietet die ausgewählte Ballade durch die nicht vorhandene übergeordnete Deutungshypothese den SuS mithilfe von handlungsorientierten- sowie produktionsorientierten Aufgaben die Möglichkeit, den Inhalt dieser Ballade eigenständig zu erschließen und ihre eigenen Erklärungen bezüglich des Inhaltes zu erwerben und diese argumentativ zu begründen.
1 Christian Dawidowski: Literaturdidaktik Deutsch. Eine Einführung. Paderborn 2015, S.253.
2 vgl. Elke Hufnagel: Gedichte untersuchen. Kleine Lernportionen für jeden Tag. Stuttgart 2021, S.62.
3 Johann Wolfang von Goethe: Der Erlkönig. 1782.
4 ders.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Unterrichtsstunde sind die Interpretation und Analyse der Ballade „Der Erlkönig“ von Johann Wolfgang von Goethe, die Erkennung der Sprecherrollen, die Entwicklung eigener Deutungen und der Einsatz handlungsorientierter und produktionsorientierter Aufgaben im Unterricht.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2021, Die Ballade "Der Erlkönig" von Johann Wolfgang von Goethe im Deutschunterricht. Sachanalyse, didaktische Analyse, methodische Analyse und Reflexion, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1276238