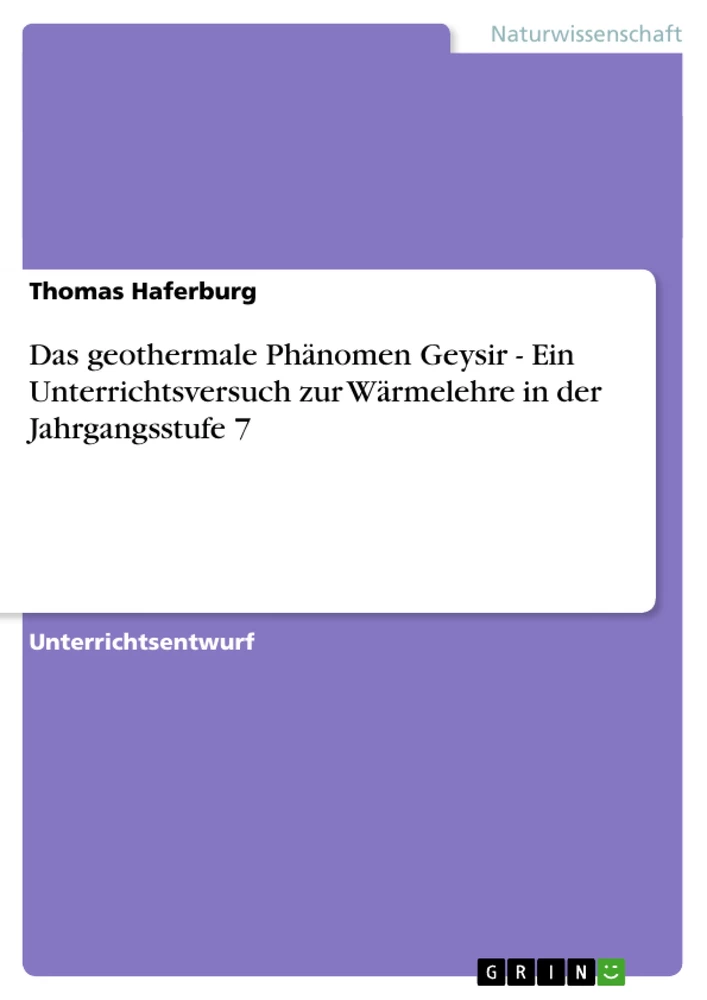Im Themengebiet der Physik in der Sekundarstufe I wird in der 7. Jahrgangsstufe die
Wärmelehre behandelt. Die folgende Konzeption zeigt, wie mit Hilfe eines Phänomens als
Anwendungsproblem die Entwicklung eines Experiments, dessen Auswertung sowie die
Notwendigkeit einer physikalischen Erklärung motiviert werden können.
Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten mit Hilfe ihrer Vorkenntnisse Gesetzmäßigkeiten
zur Wärmelehre. Sie entdecken die Wärmeleitung und die Abhängigkeit des Siedepunktes
vom Druck (hydrostatischer Druck) und lernen, mit den neuen Begriffen umzugehen und
diese anzuwenden.
Die Schülerinnen und Schüler lernen dabei eine außerschulische Situation mit Hilfe von
Physik (und auch Mathematik) zu beschreiben und zu bewältigen. Im Mittelpunkt des Unterrichts
steht immer wieder das experimentelle Modell des Geysirs. Die Lernenden erkennen
dabei die Bedeutung der Physik bei der Entdeckung, Erforschung und Erklärung
von Naturereignissen. Seit Beginn des Sommerhalbjahres 2001/2002 unterrichte ich die Klasse R7b zweistündig
in eigener Verantwortung im Fach Physik. Insgesamt 29 Schülerinnen und Schüler befinden
sich in der R7b, davon 18 Schülerinnen und 11 Schüler.
Diese 29 Schülerinnen und Schüler brachten unterschiedliche Vorkenntnisse zum Themenbereich
der Wärmelehre mit. Im Winterhalbjahr werden nach den Lehrplänen für das
Gymnasium und für die Realschule die Themenbereiche Einführung in die Physik, Optik
und Akustik unterrichtet. In der Förderstufe (5./6.-Jg.) werden in Hessen keine Naturwissenschaften
unterrichtet. Vorkenntnisse basierten hier also höchstens auf dem Sachkundeunterricht
in der Grundschule.
Alle Schülerinnen und Schüler sind gut in den Klassenverband integriert. Einzige Ausnahme
ist der Schüler Christian. Co.. Durch sehr viele Fehlstunden hat er bisher kaum am
Unterricht teilgenommen. Wesentliche, bereits erarbeitete Kenntnisse zur Temperatur und
zum Teilchenmodell fehlen ihm. Wenn Christian anwesend ist, sitzt er allein in einer
Tischreihe und beteiligt sich nicht aus eigenem Antrieb am Unterricht. Er ist still, fällt nicht
negativ auf und scheint den privaten Kontakt zu seinen Mitschülerinnen und Mitschülern
zu meiden, zumindest nicht zu suchen. So arbeitet er in Gruppen- oder Partnerarbeitsphasen
zumeist allein, oder wenn er an einer Gruppe beteiligt ist, hält er sich stark zurück. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Lerngruppenbeschreibung
- 3. Sachanalyse
- 3.1 Das geothermale Phänomen „Geysir”
- 3.2 Wärmeleitung
- 3.3 Hydrostatischer Druck (hydrostatisches Paradoxon)
- 3.4 Druckabhängigkeit des Siedepunktes (von Wasser)
- 3.5 Berechnungen zum Geysirmodell
- 4. Didaktische Überlegungen
- 4.1 Das Phänomen im Physikunterricht
- 4.2 Vom Phänomen zum Modell
- 4.3 Modellbildungsprozesse
- 5. Methodische Überlegungen
- 5.1 Aufbau und Durchführung der Experimente
- 5.2 Berechnungen an den Experimenten
- 6. Groblernziele des Unterrichtsversuchs
- 7. Gliederung der Unterrichtsreihe
- 8. Durchführung der Unterrichtsreihe Darstellung der Unterrichtsstunden
- 9. Gesamtreflexion
- 10. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit präsentiert einen Unterrichtsversuch zur Wärmelehre in der Jahrgangsstufe 7, der sich am geothermalen Phänomen „Geysir" orientiert. Das Ziel des Versuchs ist es, die Schülerinnen und Schüler mit den physikalischen Gesetzmäßigkeiten der Wärmelehre vertraut zu machen. Sie sollen anhand des Geysir-Modells die Wärmeleitung, die Abhängigkeit des Siedepunktes vom Druck (hydrostatischer Druck) und die Bedeutung der Modellbildung in den Naturwissenschaften entdecken und erforschen.
- Die Wärmelehre in der Sekundarstufe I
- Das geothermale Phänomen „Geysir”
- Wärmeleitung und hydrostatischer Druck
- Die Druckabhängigkeit des Siedepunktes von Wasser
- Modellbildung in den Naturwissenschaften
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Kontext des Unterrichtsversuchs beschreibt und die Bedeutung des Themas Wärmelehre in der Jahrgangsstufe 7 hervorhebt. Anschließend wird die Lerngruppe, ihre Vorkenntnisse und das soziale Umfeld der Klasse vorgestellt.
Im dritten Kapitel erfolgt eine detaillierte Sachanalyse des geothermalen Phänomens „Geysir”. Es werden wichtige physikalische Aspekte wie Wärmeleitung, hydrostatischer Druck und die Druckabhängigkeit des Siedepunktes von Wasser erläutert.
Kapitel 4 widmet sich den didaktischen Überlegungen zur Einbindung des Phänomens in den Physikunterricht. Es wird die Bedeutung von Modellbildungsprozessen für das Verständnis physikalischer Zusammenhänge hervorgehoben.
Im fünften Kapitel werden die methodischen Überlegungen zum Aufbau und zur Durchführung der Experimente sowie zur Auswertung der Versuchsergebnisse dargestellt.
Die Arbeit endet mit der Darstellung der Groblernziele des Unterrichtsversuchs, der Gliederung der Unterrichtsreihe und der Durchführung der Unterrichtsstunden.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem geothermalen Phänomen „Geysir” und dessen Relevanz für den Physikunterricht in der Jahrgangsstufe 7. Schwerpunkte sind die Wärmelehre, Wärmeleitung, hydrostatischer Druck, Druckabhängigkeit des Siedepunktes von Wasser, Modellbildung und experimentelle Forschung. Die Arbeit untersucht die Möglichkeiten, wie das Phänomen des Geysirs als Anwendungsproblem genutzt werden kann, um Schülerinnen und Schülern physikalische Zusammenhänge und Modellbildungsprozesse näherzubringen.
Häufig gestellte Fragen
Wie funktioniert ein Geysir physikalisch?
Ein Geysir basiert auf der Druckabhängigkeit des Siedepunktes. Durch den hydrostatischen Druck der Wassersäule siedet das Wasser in der Tiefe erst bei über 100°C. Entstehen Dampfblasen, sinkt der Druck und das Wasser bricht schlagartig aus.
Welche Themen der Wärmelehre werden in Klasse 7 behandelt?
Zentrale Themen sind die Wärmeleitung, die Temperaturmessung, das Teilchenmodell und die Aggregatzustände sowie die Abhängigkeit des Siedepunktes vom Druck.
Was ist das Ziel des Geysir-Experiments im Unterricht?
Schüler sollen durch Modellbildung und Experimente lernen, komplexe Naturereignisse mit physikalischen Gesetzmäßigkeiten zu erklären.
Was versteht man unter hydrostatischem Druck?
Es ist der Druck, den eine ruhende Flüssigkeitssäule durch ihre Gewichtskraft auf eine Fläche ausübt, was beim Geysir den Siedepunkt in der Tiefe erhöht.
Warum ist Modellbildung in der Physik wichtig?
Modelle vereinfachen komplexe Realitäten (wie einen echten Geysir) auf das Wesentliche, um Experimente im Labor durchführbar und physikalische Zusammenhänge verstehbar zu machen.
- Citation du texte
- Thomas Haferburg (Auteur), 2003, Das geothermale Phänomen Geysir - Ein Unterrichtsversuch zur Wärmelehre in der Jahrgangsstufe 7, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/12764