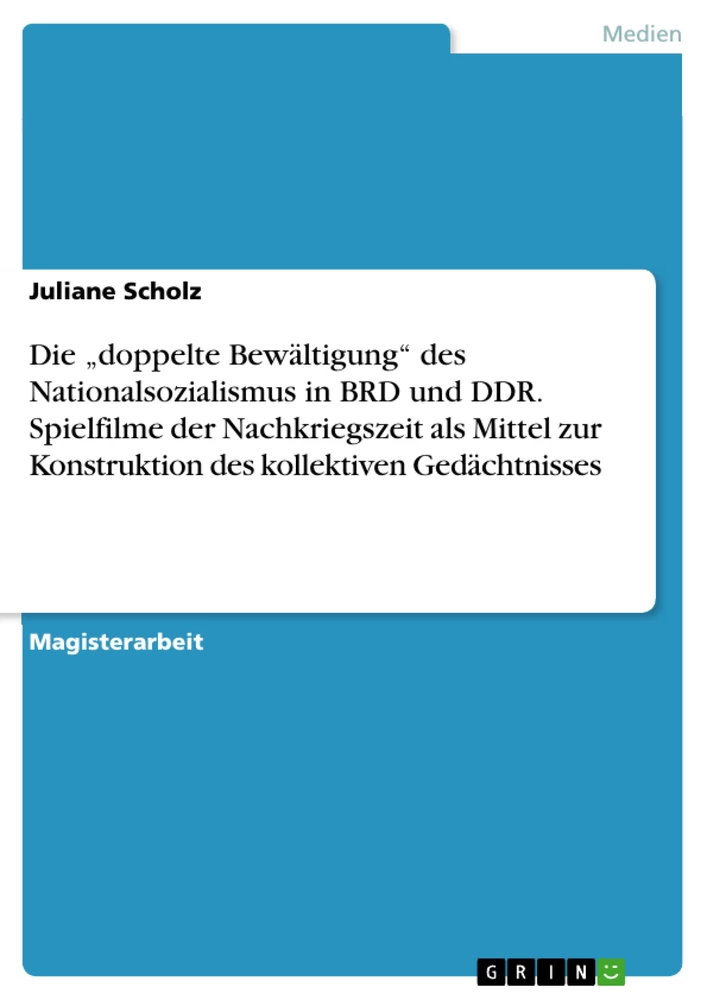Im Zuge der vorliegenden Magisterarbeit sollen interdisziplinär Filmanalyse, Kulturgeschichte und das zeitgeschichtliche Forschungsfeld der Erinnerungskultur thematisch und methodisch miteinander verknüpft werden. Ausgangspunkt bildet der chronologische, wie stellenweise thematische Vergleich deutscher Nachkriegsspielfilme von 1946 bis Anfang der Fünfziger in der SBZ bzw. DDR und den westlichen Besatzungszonen bzw. BRD. Ausgehend vom historischen Vergleich und der Diskursanalyse nach LANDWEHR, welche Sachverhalte erforscht, „[…]die zu einer
bestimmten Zeit in ihrer zeichenhaften und gesellschaftlichen Vermittlung [...] als gegeben anerkannt werden“, sollen Filme einerseits als ästhetische Repräsentation von Künstlern
andererseits als Abbilder und Spiegelungen gesellschaftlicher Wirklichkeit und Ausdruck normativer Rahmenbedingungen politischer sowie öffentlicher Akteure angesehen werden.
Aus der Beziehung zwischen Filmanalyse, herrschenden politischen Kontexte und öffentlicher Debatten, soll das Spannungsfeld der „Vergangenheitsbewältigung“, die ihr immanente „Vergangenheitspolitik“ in der deutschen Nachkriegszeit in Bezug auf den Umgang mit der Geschichte des Nationalsozialismus (NS) und der Auseinandersetzung mit diesem Thema in Spielfilmen analysiert werden. Empirische Grundlage bilden fünfzehn
Filme aus Ost und West, die für den historischen Vergleich und eine Analyse ausgewählter Diskurse zum NS herangezogen werden. Zudem wird anhand eines thematischen Fallbeispiels der spezielle ästhetische Diskurs und die Praxis politischer Einflussnahme auf
das Medium Film verdeutlicht. Außerdem werden das Beispiel der Ablehnung des „Italienischen Neorealismus“ Rossellinis und seiner umfassenden Ästhetik im Nachkriegsdeutschland sowie der erste Zensurfall der DDR um "Das Beil von Wandsbek" mittels eines Exkurses skizziert.
Insofern ist das Erkenntnisinteresse zweierlei: Einerseits innerhalb des historischen Vergleichs die filmimmanenten Diskursen zum Thema Nationalsozialismus herauszufiltern und als Vervollständigung zu neueren Studien zum sozialen Themenkomplex der „Vergangenheitsbewältigung“ einzuordnen. Zweitens einen politisch-ökonomischen Rahmen zu rekonstruieren und die Diskurse filmhistorisch-ästhetisch aber auch politisch-ökonomisch anhand von Fallbeispielen einzuordnen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- 1.1 Methodische Vorbemerkungen
- 1.2 Forschungsstand
- 1.3 Filmauswahl und empirische Umsetzung
- II. Hauptteil: Die Filmwirtschaft von 1945 bis 1949
- 2.1 Wirtschaftliche Umstrukturierung der Filmproduktion in den westlichen Besatzungszonen
- 2.1.1 Lizenzierung und Filmzensur
- 2.1.2 Hollywood als „Umerzieher“
- 2.1.3 Gründung der FSK in der BRD
- 2.2 Neuaufbau der Filmproduktion in der Sowjetischen Besatzungszone
- 2.2.1 Gründung des „Filmaktivs“ und der DEFA
- 2.2.2 Zwischen personeller Kontinuität und ästhetischer Neuorientierung
- 2.2.3 Politischer Einfluss auf die DEFA
- 2.3 Vermarktung des UFA-Erbes und interzonaler Filmaustausch
- 2.4 Die doppelte Staatsgründung und wachsende Systemkonkurrenz
- 2.5 Zusammenfassung
- III. Historischer Vergleich ausgewählter Spielfilme von 1946 bis 1953 und ihre Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus Zwischen Wandel und Beständigkeit
- 3.1 „Trümmerfilm“ und Zeitfilm
- 3.1.1 Von Kriegsheimkehrern, der Frage nach Schuld, Rache und Menschlichkeit in der „dunklen Zeit“ – Filme von 1946 bis 1949
- 3.1.2 Juden als Opfer
- 3.1.3 Die Suche nach den Ursachen des Nationalsozialismus bei der DEFA und psychologische Abgründe der Heimkehrerproblematik
- 3.2 Wachsende Systemkonkurrenz und Kalter Krieg – Legitimierung neuer Gesellschaftsordnungen im Spielfilm in DDR und BRD 1949 bis 1953
- 3.3 Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse
- IV. Exkurs: Ablehnung des „Italienischen Neorealismus“ bzw. „Kritischen Realismus“ in DDR und BRD
- 4.1 Rom-offene Stadt und Deutschland im Jahre Null - Verwerfung pessimistischer Weltsichten
- 4.2 Die Formalismusdebatte in der DDR: „Sozialistischer Realismus“ vs. „Kritischer Realismus“
- 4.3 Das Beil von Wandsbek - Der erste Zensurfall der DDR
- 4.4 Kollektive Abwehr der kritischen Auseinandersetzung mit dem NS im Kino?
- V. Vergleich der cineastischen Diskurse mit der zeitgenössischen Einstellung und öffentlich-politischen Diskussion zur „Vergangenheitsbewältigung“ und „Schuldfrage“
- 5.1 „Vergangenheitsbewältigung“ in den westlichen Besatzungszonen und der BRD
- 5.2 „Verordnete Vergangenheitsbewältigung“ und Antifaschismus als Gründungskonsens in der SBZ/DDR
- 5.3 Wechselseitige Bezugsrahmen der „doppelten Bewältigung“ - der Spielfilm als ein Medium der Konstruktion des kollektiven Gedächtnisses
- 5.4 Einige vergleichende Thesen zur Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus in Film, Öffentlichkeit und Politik der Nachkriegszeit
- 5.5 Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht die wechselseitigen Bezugsrahmen der „doppelten Bewältigung“ des Nationalsozialismus im deutschen Nachkriegsspielfilm. Ziel ist ein historischer Vergleich von Filmen aus der SBZ/DDR und den westlichen Besatzungszonen/BRD, um die Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit im Kontext der jeweiligen politischen und ökonomischen Rahmenbedingungen zu analysieren. Die Arbeit verknüpft Filmanalyse, Kulturgeschichte und Erinnerungskultur.
- Der Einfluss der Besatzungsmächte auf die Filmproduktion
- Die Darstellung des Nationalsozialismus in ost- und westdeutschen Filmen
- Der Vergleich unterschiedlicher Diskurse zur „Vergangenheitsbewältigung“
- Die Rolle des Films in der Konstruktion des kollektiven Gedächtnisses
- Die Auseinandersetzung mit dem „Italienischen Neorealismus“ in Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die methodische und interdisziplinäre Herangehensweise der Arbeit, welche Filmanalyse, Kulturgeschichte und Erinnerungskultur verbindet. Sie legt den Fokus auf den Vergleich deutscher Nachkriegsspielfilme (1946-Anfang der 1950er Jahre) aus Ost und West, analysiert die Diskursanalyse nach Landwehr und untersucht das Spannungsfeld der „Vergangenheitsbewältigung“ in Bezug auf den Nationalsozialismus. Die Arbeit verwendet fünfzehn Filme als empirische Grundlage und beleuchtet die politischen und ökonomischen Einflüsse auf die Filmproduktion. Eine zentrale Hypothese ist, dass die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus im frühen Nachkriegsfilm stark von politischen und ökonomischen Faktoren, aber auch von Akteuren des filmischen Mediums beeinflusst wurde.
II. Hauptteil: Die Filmwirtschaft von 1945 bis 1949: Dieses Kapitel analysiert den Wiederaufbau der deutschen Filmindustrie nach dem Zweiten Weltkrieg unter den Bedingungen der Besatzung. Es vergleicht die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den westlichen Besatzungszonen und der SBZ, beleuchtet die Rolle von Hollywood, die Gründung der FSK und der DEFA, und untersucht die Vermarktung des UFA-Erbes sowie den interzonalen Filmaustausch. Der Fokus liegt auf den unterschiedlichen institutionellen Strukturen und deren Einfluss auf die Filmproduktion und die Entstehung der beiden deutschen Staaten.
III. Historischer Vergleich ausgewählter Spielfilme von 1946 bis 1953 und ihre Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus Zwischen Wandel und Beständigkeit: Dieses Kapitel stellt einen historischen Vergleich ausgewählter Spielfilme aus Ost und West dar, um deren Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus zu untersuchen. Es analysiert verschiedene filmische Darstellungsweisen, z.B. "Trümmerfilme", und die Behandlung von Themen wie Schuld, Rache und die Opferrolle der Juden. Der Vergleich soll Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der filmischen Aufarbeitung der NS-Vergangenheit in den beiden deutschen Staaten aufzeigen, und den Einfluss des wachsenden Kalten Krieges beleuchten.
IV. Exkurs: Ablehnung des „Italienischen Neorealismus“ bzw. „Kritischen Realismus“ in DDR und BRD: Dieser Exkurs untersucht die Ablehnung des italienischen Neorealismus und des kritischen Realismus in Ost und West. Er analysiert die Gründe für diese Ablehnung im Kontext der politischen und ideologischen Rahmenbedingungen der Nachkriegszeit und verwendet Fallbeispiele wie "Rom-offene Stadt" und "Deutschland im Jahre Null", um die jeweiligen politischen und ästhetischen Auseinandersetzungen zu beleuchten. Die Formalismusdebatte in der DDR und der erste Zensurfall ("Das Beil von Wandsbek") werden ebenfalls thematisiert.
V. Vergleich der cineastischen Diskurse mit der zeitgenössischen Einstellung und öffentlich-politischen Diskussion zur „Vergangenheitsbewältigung“ und „Schuldfrage“: Das Kapitel vergleicht die in den Filmen dargestellten Diskurse über die Vergangenheit mit den zeitgenössischen öffentlichen und politischen Debatten zur "Vergangenheitsbewältigung" und "Schuldfrage" in Ost und West. Es analysiert die verschiedenen Ansätze und Strategien im Umgang mit der NS-Vergangenheit und die Rolle des Films als Medium der Konstruktion des kollektiven Gedächtnisses. Es untersucht den Einfluss der jeweiligen politischen Systeme auf die öffentliche Wahrnehmung und die filmische Darstellung der Vergangenheit.
Schlüsselwörter
Nationalsozialismus, Nachkriegsdeutschland, Filmgeschichte, DEFA, UFA, Vergangenheitsbewältigung, kollektives Gedächtnis, „Trümmerfilm“, „Sozialistischer Realismus“, „Kritischer Realismus“, Filmzensur, Kalter Krieg, Hollywood, Diskursanalyse, historischer Vergleich, Ost-West-Vergleich.
Häufig gestellte Fragen zur Magisterarbeit: Die doppelte Bewältigung des Nationalsozialismus im deutschen Nachkriegsspielfilm
Was ist der Gegenstand dieser Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht die unterschiedlichen Weisen, wie der Nationalsozialismus im deutschen Nachkriegsspielfilm (1946-Anfang der 1950er Jahre) in Ost- und Westdeutschland aufgearbeitet wurde. Sie vergleicht Filme aus der SBZ/DDR und den westlichen Besatzungszonen/BRD und analysiert die Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit im Kontext der jeweiligen politischen und ökonomischen Rahmenbedingungen.
Welche Methoden werden in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit verbindet Filmanalyse, Kulturgeschichte und Erinnerungskultur. Es wird ein historischer Vergleich der Filme durchgeführt, wobei die Diskursanalyse nach Landwehr angewendet wird. Die Arbeit analysiert die politischen und ökonomischen Einflüsse auf die Filmproduktion und untersucht das Spannungsfeld der „Vergangenheitsbewältigung“ in Bezug auf den Nationalsozialismus.
Welche Filme werden in der Arbeit untersucht?
Die Arbeit untersucht fünfzehn ausgewählte Spielfilme aus der Zeit zwischen 1946 und Anfang der 1950er Jahre. Die genauen Filmtitel werden im Hauptteil der Arbeit genannt.
Welche zentralen Themen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht den Einfluss der Besatzungsmächte auf die Filmproduktion, die Darstellung des Nationalsozialismus in ost- und westdeutschen Filmen, den Vergleich unterschiedlicher Diskurse zur „Vergangenheitsbewältigung“, die Rolle des Films in der Konstruktion des kollektiven Gedächtnisses und die Auseinandersetzung mit dem „Italienischen Neorealismus“ in Deutschland.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Hauptteil (Filmwirtschaft 1945-1949), historischer Vergleich ausgewählter Spielfilme (1946-1953), ein Exkurs zur Ablehnung des italienischen Neorealismus und des kritischen Realismus, und schließlich ein Kapitel, das cineastische Diskurse mit zeitgenössischen öffentlichen und politischen Diskussionen vergleicht.
Was sind die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit?
Die Arbeit zeigt auf, wie die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus im frühen Nachkriegsfilm stark von politischen und ökonomischen Faktoren, aber auch von Akteuren des filmischen Mediums beeinflusst wurde. Sie deckt Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der filmischen Aufarbeitung der NS-Vergangenheit in Ost und West auf und analysiert die Rolle des Films in der Konstruktion des kollektiven Gedächtnisses in beiden deutschen Staaten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit am besten?
Nationalsozialismus, Nachkriegsdeutschland, Filmgeschichte, DEFA, UFA, Vergangenheitsbewältigung, kollektives Gedächtnis, „Trümmerfilm“, „Sozialistischer Realismus“, „Kritischer Realismus“, Filmzensur, Kalter Krieg, Hollywood, Diskursanalyse, historischer Vergleich, Ost-West-Vergleich.
Wo kann ich die vollständige Magisterarbeit finden?
Die vollständige Magisterarbeit ist [hier den Zugriffsort einfügen, z.B. in der Universitätsbibliothek erhältlich].
- Arbeit zitieren
- M.A. Juliane Scholz (Autor:in), 2008, Die „doppelte Bewältigung“ des Nationalsozialismus in BRD und DDR. Spielfilme der Nachkriegszeit als Mittel zur Konstruktion des kollektiven Gedächtnisses, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/127664