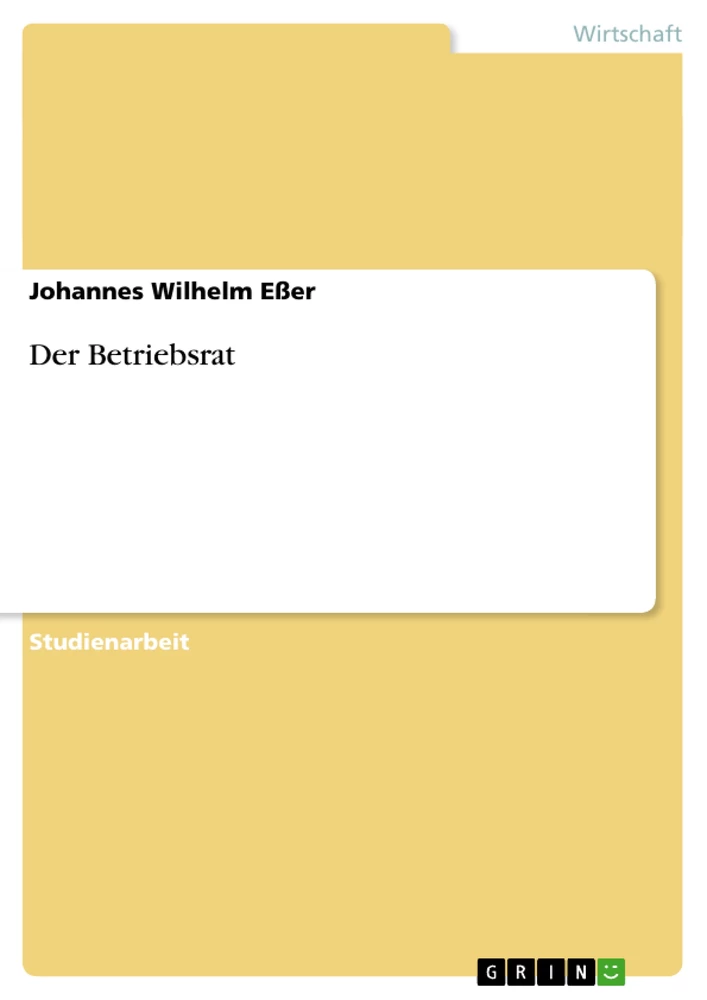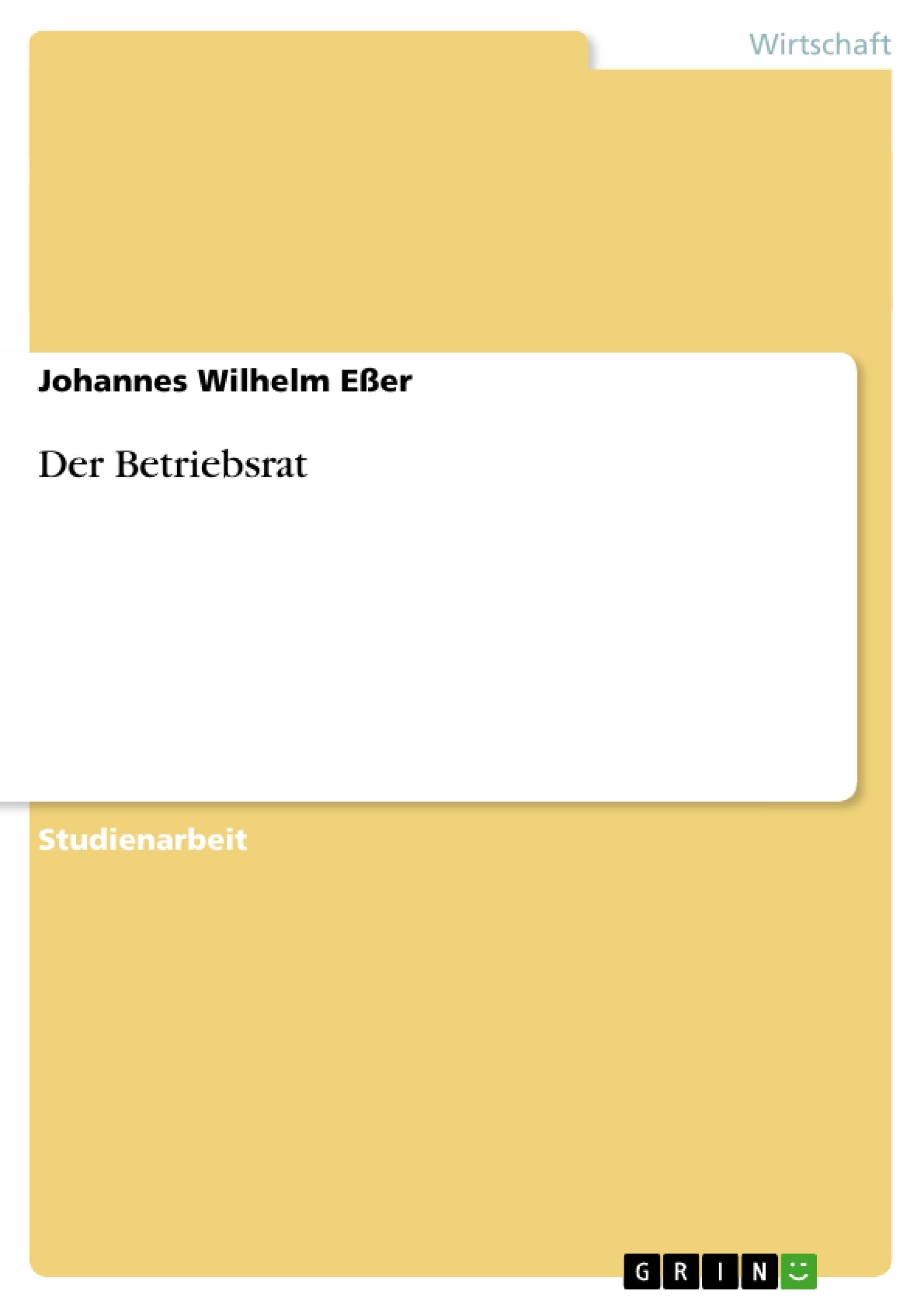Seit der industriellen Revolution, die mit der Bildung der ersten größeren Unternehmen einherging, gab es auf Seiten der Arbeitnehmer das Bedürfnis nach betrieblicher Mitbestimmung. Das Fehlen von umfassenden Arbeitnehmerschutzgesetzen bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatte das natürliche Ungleichgewicht zwischen Inhabern von Produktionsmitteln, den Unternehmern, und Lohnabhängigen aufgezeigt. Das Ergebnis war die Verarmung der Masse des Volkes zu Gunsten kleiner wohlhabender Gruppen.
Mit der Abschaffung des Zensuswahlrechtes durch das Gleichheitswahlrecht, in Verbindung mit der Etablierung von demokratischen Staatsformen, besaßen die Lohnabhängigen fortan einen hohen politischen Einfluss durch ihr zahlenmäßiges Übergewicht. Dies hatte zur Folge, dass in Deutschland bereits 1860 durch politischen Druck erste Arbeiterausschüsse gebildet wurden. Im Rahmen der Bismarkschen Sozialreformen wurde dann 1916 das Hilfsdienstgesetz verabschiedet, das Betriebsräte zu festen Einrichtungen innerhalb von Betrieben machte. Nach heftigen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen und Debatten über Arbeiterrechte und die betriebliche Mitbestimmung kam es am 4.2.1920 zur Erlassung des Betriebsrätegesetzes, das den Einfluss von Arbeitervertretungen verstärkte.
Das heutige Gleichgewicht, in dem sich Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite auf Augenhöhe befinden, wurde jedoch erst durch das Betriebsverfassungsgesetz von 1952 und dessen Überarbeitung im Jahre 1972 ermöglicht, in dessen Rahmen die Mitbestimmungsrechte der Arbeitnehmerseite sukzessive ausgeweitet wurden. Anlass hierzu war der hohe Beschäftigungsanteil von Arbeitskräften in verschiedenen körperlich belastenden Tätigkeitsfeldern der Schwerindustrie sowie in der Fertigung des Maschinenbau- und Automobilsektors. Die letzten bedeutenden Änderungen waren die Aufhebung der Trennung von Arbeitern und Angestellten aufgrund der abnehmenden Bedeutung von körperlichen Tätigkeiten mit geringer Qualifizierung auf Entlohnungsbasis Ende des 20. Jahrhunderts, die Möglichkeit des Betriebsrates bei Betriebsveränderungen, externe Berater einzuschalten sowie das Inkrafttreten des reformierten Betriebsverfassungsgesetzes am 28.7.2001, das die aktuelle Basis der Rechtsprechung darstellt.
Diese Arbeit soll einen Überblick über die Rechte und Pflichten des Betriebsrates aufzeigen, seine historische Entstehung darstellen, wie auch seine Bedeutung für Wirtschaft und Arbeitnehmer verdeutlichen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung – Der Gedanke der Mitbestimmung
- Die Geschichte des Betriebsrates in Deutschland
- Allgemeine Vorschriften
- Rechtliche Grundlagen
- Das Betriebsverfassungsgesetz von 1972
- Kündigungsschutzgesetz und Arbeitsgerichtgesetz
- Weitere Mitwirkungsgremien
- Aufgaben und Rechte
- Allgemeine Aufgaben
- Informations- und Beratungsanspruch
- Anhörung und Mitwirkung
- Echte Mitbestimmung
- Informationsquellen
- Betriebsräte in der Praxis
- Verhältnis von Geschäftsleitung und Betriebsrat
- Unternehmen ohne Betriebsräte
- Die Resonanz des Betriebsrats in der Belegschaft
- Fazit
- Abbildungsverzeichnis
- Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit dem Betriebsrat als gesetzlichem Organ zur Vertretung der Arbeitnehmerinteressen und zur Wahrung der betrieblichen Mitwirkung und Mitbestimmung gegenüber dem Arbeitgeber in Betrieben des privaten Rechts. Die Arbeit beleuchtet die Geschichte des Betriebsrates in Deutschland, die rechtlichen Grundlagen, die Aufgaben und Rechte des Betriebsrates sowie dessen Rolle in der Praxis.
- Die historische Entwicklung des Betriebsrates in Deutschland
- Die rechtlichen Grundlagen der betrieblichen Mitbestimmung
- Die Aufgaben und Rechte des Betriebsrates
- Die Praxis des Betriebsrates in Unternehmen
- Die Bedeutung des Betriebsrates für die Arbeitnehmer und das Unternehmen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der betrieblichen Mitbestimmung ein und beleuchtet die Geschichte des Betriebsrates in Deutschland. Sie zeigt die Entwicklung des Betriebsrates von den ersten Arbeiterausschüssen im 19. Jahrhundert bis zum heutigen Betriebsverfassungsgesetz von 1972. Die Einleitung erläutert auch die allgemeinen Vorschriften zur Bildung und Wahl des Betriebsrates.
Das Kapitel "Rechtliche Grundlagen" befasst sich mit dem Betriebsverfassungsgesetz von 1972 als zentrale Rechtsgrundlage für die betriebliche Mitbestimmung. Es werden die wichtigsten Bestimmungen des Gesetzes erläutert, die die Rechte und Pflichten des Betriebsrates sowie die Beziehung zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber regeln. Außerdem werden weitere relevante Gesetze wie das Kündigungsschutzgesetz und das Arbeitsgerichtgesetz behandelt.
Das Kapitel "Aufgaben und Rechte" beschreibt die verschiedenen Aufgaben und Rechte des Betriebsrates. Es werden die allgemeinen Aufgaben des Betriebsrates, wie z.B. die Vertretung der Arbeitnehmerinteressen, die Mitwirkung bei betrieblichen Entscheidungen und die Information der Arbeitnehmer, erläutert. Außerdem werden die Rechte des Betriebsrates auf Anhörung, Mitbestimmung und Informationszugang detailliert dargestellt.
Das Kapitel "Betriebsräte in der Praxis" befasst sich mit der Rolle des Betriebsrates in der Praxis. Es werden die Beziehungen zwischen Geschäftsleitung und Betriebsrat, die Situation in Unternehmen ohne Betriebsräte und die Resonanz des Betriebsrates in der Belegschaft beleuchtet. Dieses Kapitel zeigt die Herausforderungen und Chancen des Betriebsrates in der heutigen Arbeitswelt auf.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Betriebsrat, die betriebliche Mitbestimmung, das Betriebsverfassungsgesetz, die Arbeitnehmerinteressen, die Rechte und Pflichten des Betriebsrates, das Verhältnis von Geschäftsleitung und Betriebsrat, die Praxis des Betriebsrates in Unternehmen und die Bedeutung des Betriebsrates für die Arbeitnehmer und das Unternehmen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die rechtliche Basis für den Betriebsrat?
Die wichtigste Grundlage ist das Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG), insbesondere in der reformierten Fassung von 2001.
Wann wurde das erste Betriebsrätegesetz in Deutschland erlassen?
Nach historischen Auseinandersetzungen wurde am 4. Februar 1920 das erste Betriebsrätegesetz verabschiedet.
Welche Aufgaben hat ein Betriebsrat?
Zu den Aufgaben gehören die Vertretung der Arbeitnehmerinteressen, die Überwachung geltender Gesetze und Tarifverträge sowie die Mitwirkung bei personellen und sozialen Angelegenheiten.
Was versteht man unter „echter Mitbestimmung“?
Dies betrifft Bereiche, in denen der Arbeitgeber ohne die Zustimmung des Betriebsrates keine Änderungen vornehmen darf, wie etwa bei Arbeitszeitregelungen oder Urlaubsplänen.
Haben alle Unternehmen einen Betriebsrat?
Nein, die Bildung eines Betriebsrates ist ab fünf wahlberechtigten Arbeitnehmern möglich, aber nicht in jedem privaten Unternehmen zwingend vorhanden.
- Quote paper
- Johannes Wilhelm Eßer (Author), 2008, Der Betriebsrat, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/127677