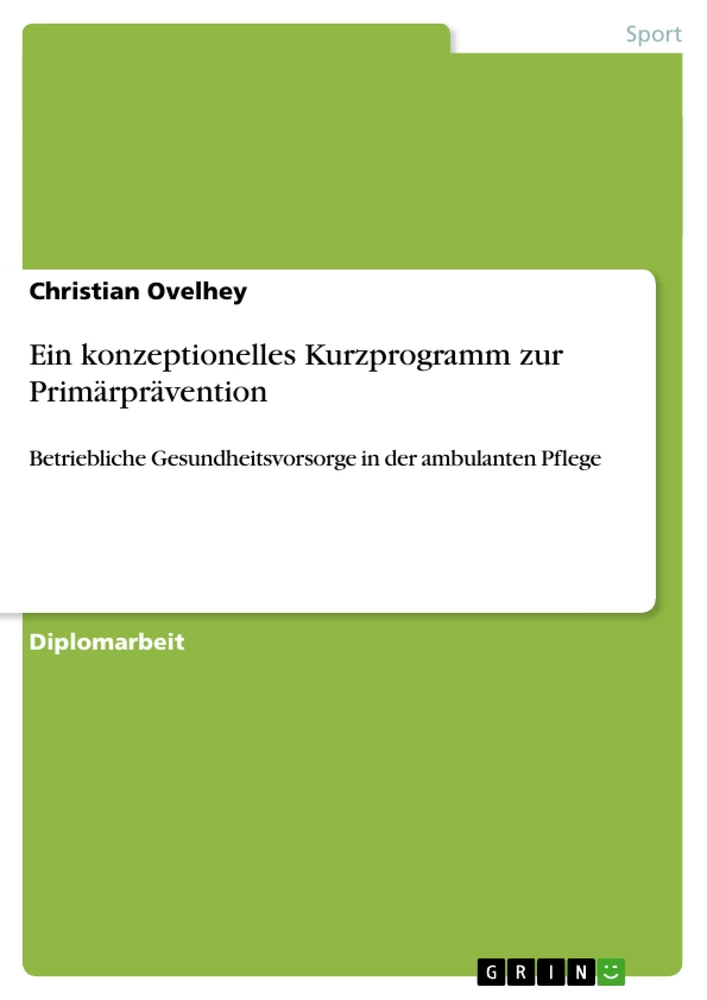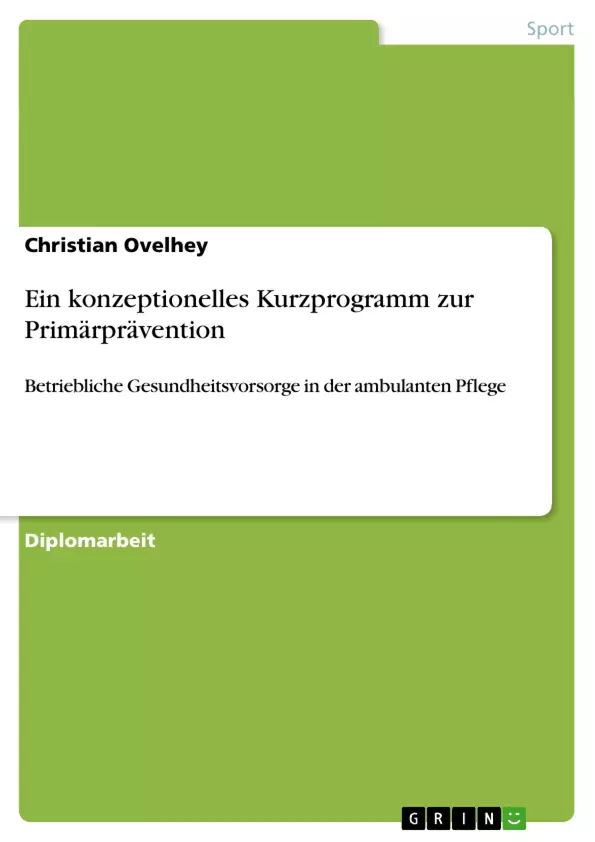Der Arbeitsmarkt der ambulanten Pflege stellt hohe Anforderungen an die
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Schichtdienst ist an der Tagesordnung,
Wochenenddienst ebenfalls. Die Pflegenden stehen oftmals unter
Zeitdruck sollen aber eine persönliche und qualitativ hochwertige Pflege an
und mit dem Menschen durchführen. Waschen, Anziehen, Körperpflege, medizinische
Versorgung, Essensgaben und vieles mehr stehen auf dem täglichen
Programm. Persönliche Gespräche mit Angehörigen, Ärzten, Therapeuten
und anderen am Pflegeprozess beteiligten Personen …all das sind zusätzliche
Spannungsfelder im Alltag einer Pflegekraft.
Die Belastungsfaktoren, denen Pflegekräfte ausgesetzt sind, sind vielfältig
und vielschichtig, sind physischer und psychischer Natur, sind unterschiedlich
stark ausgeprägt und zu unterschiedlichen Zeitpunkten präsent. Aber alle
nehmen sie Einfluss auf den physischen und psychischen Gesundheitszustand
der Betroffenen.
So verwundert es nicht, dass im Pflegemarkt dringend nach Personal gesucht
wird. Ältere Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen scheiden immer früher
aus dem Beruf aus, die Zahlen der Auszubildenden sind laut Berufsgenossenschaft
für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) rückläufig.
Von einem Pflegenotstand ist bereits die Rede (BGW, 2006).
Unter diesem Blickwinkel rückt die Primärprävention immer mehr in den
Fokus. Mitarbeiter müssen befähigt werden, ihren Beruf länger auszuüben.
Diese Arbeit untersucht einen Ansatz, die zuvor beschriebene Problematik
zu beheben.
Zunächst wird der Forschungsgegenstand näher betrachtet, um die physischen
und psychischen Belastungen der Pflegekräfte herauszustellen, und
dem Begriff der Prävention Profil zu verleihen. Zusätzlich werden Argumente
herausgearbeitet, warum Primärprävention auch für Arbeitgeber von Interesse
ist.
Anschließend wird aus den aktuellen sportwissenschaftlichen Erkenntnissen
und unter Berücksichtigung der physischen und psychischen Belastungen
der Pflegekräfte ein theoretisches Gerüst als Grundlage eines Trainingskonzepts
erarbeitet.
Darauf basierend wurde das konzeptionelle Kurzprogramm zur Primärprävention
für Pflegekräfte entwickelt, was über einen Zeitraum von sechs
Wochen in einer ambulanten Pflegestation durchgeführt und evaluiert wurde.
Die Ergebnisse, ihre Interpretation und ihre möglichen Auswirkungen und
Zusammenhänge im bzw. auf das Berufsfeld Pflege werden am Ende dieser Arbeit dargestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Situationsanalyse
- Arbeitsmarkt Pflege
- Exkurs Pflegeversicherung
- Situation des Pflegemarkts
- Perspektiven des Pflegemarkts
- Situationsanalyse der Pflegekräfte
- Anforderungs- und Belastungsprofil der Pflegekräfte „heute“
- Anforderungs- und Belastungsprofil der Pflegekräfte „morgen“
- Arbeitsmarkt Pflege
- Gegenstandsanalyse
- Begriffseingrenzung Gesundheitsförderung
- Begriffseingrenzung Prävention
- Betriebliche Primärprävention
- Motive für eine betriebliche Primärprävention
- Primärprävention im Arbeitsmarkt Pflege
- Theoretische Inhaltsaufbereitung
- Rücken und Rumpf
- Aufbau und Funktion der Rückenmuskulatur
- Aufbau und Funktion der Rumpfmuskulatur
- Risikobilder
- Kraft
- Definition der Kraft
- Dimensionen der Kraft
- Kraft und inter-/intramuskuläre Koordination
- Bedeutung der Kraft und inter-/intramuskulären Koordination
- Krafttraining
- Dimensionen des Rücken- und Rumpfkrafttrainings
- „Sanftes Krafttraining“ nach Mießner (2003)
- Anwendbarkeit des „sanften Krafttrainings“
- Stress und Entspannung
- Definition und Entstehung von Stress
- Definition von Entspannung/Entspannungsreaktion
- Entspannungsverfahren
- Entspannungsverfahren - ein Überblick
- Die Progressive Muskelrelaxation (PMR)
- Rücken und Rumpf
- Methodik
- Fragestellung und Hypothesenbildung
- Projektdesign
- Evaluationsinstrumente
- Der Pre-Fragebogen
- Der Post-Fragebogen
- Der Eingangs- und Ausgangstest
- Probandenrekrutierung
- Beschreibung der Aktiv- und Passivgruppe
- Trainingsinhalte
- Problemfelder
- Datenauswertung
- Ergebnisdarstellung
- Aktivgruppe
- Eingangs- und Ausgangstest
- Pre- und Post-Fragebögen
- Passivgruppe
- Pre- und Post-Fragebögen
- Gruppenvergleich der Pre-Fragebögen
- Gruppenvergleich der Post-Fragebögen
- Projektbewertung
- Drop-out
- Aktivgruppe
- Hypothesenzentrierte Ergebnisinterpretation
- Diskussion
- Diskussion I - Die Ergebnisse
- Diskussion II - Ausblick
- Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit der Entwicklung eines konzeptionellen Kurzprogramms zur Primärprävention von Rücken- und Rumpfbeschwerden im Arbeitsmarkt Pflege. Ziel ist es, ein Programm zu erstellen, das die körperliche und psychische Gesundheit von Pflegekräften durch gezielte Maßnahmen zur Stärkung der Rücken- und Rumpfmuskulatur sowie zur Stressbewältigung verbessert.
- Analyse der Belastungen und Anforderungen im Arbeitsmarkt Pflege
- Entwicklung eines präventiven Kurzprogramms zur Stärkung der Rücken- und Rumpfmuskulatur
- Einbezug von Entspannungstechniken zur Stressbewältigung
- Evaluation des Programms anhand von Fragebögen und Leistungstests
- Diskussion der Ergebnisse und Ableitung von Handlungsempfehlungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Primärprävention von Rücken- und Rumpfbeschwerden im Arbeitsmarkt Pflege ein und erläutert die Relevanz des Themas. Die Situationsanalyse beleuchtet die Arbeitsbedingungen und Belastungen von Pflegekräften, wobei der Fokus auf die körperlichen und psychischen Anforderungen liegt. Die Gegenstandsanalyse definiert die Begriffe Gesundheitsförderung und Prävention und grenzt die betriebliche Primärprävention ein.
Die theoretische Inhaltsaufbereitung behandelt die Anatomie und Funktion der Rücken- und Rumpfmuskulatur sowie die Bedeutung von Kraft und inter-/intramuskulärer Koordination für die Prävention von Rückenbeschwerden. Es werden verschiedene Krafttrainingsmethoden vorgestellt, insbesondere das „sanfte Krafttraining“ nach Mießner (2003). Des Weiteren wird die Entstehung von Stress und die Bedeutung von Entspannungstechniken für die Gesundheit von Pflegekräften erläutert.
Die Methodik beschreibt das Projektdesign, die Evaluationsinstrumente, die Probandenrekrutierung und die Trainingsinhalte des entwickelten Kurzprogramms. Die Ergebnisdarstellung präsentiert die Ergebnisse der Evaluation anhand von Fragebögen und Leistungstests. Die Hypothesenzentrierte Ergebnisinterpretation analysiert die Ergebnisse im Hinblick auf die Fragestellung der Arbeit.
Die Diskussion beleuchtet die Ergebnisse der Arbeit und leitet Handlungsempfehlungen für die Praxis ab. Die Zusammenfassung fasst die wichtigsten Ergebnisse und Erkenntnisse der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Primärprävention, Rücken- und Rumpfbeschwerden, Arbeitsmarkt Pflege, Krafttraining, Entspannungstechniken, Stressbewältigung, Gesundheitsförderung, körperliche und psychische Gesundheit, Evaluationsmethoden, Handlungsempfehlungen.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Primärprävention in der Pflege so wichtig?
Pflegekräfte leiden häufig unter Rückenbeschwerden und Stress; Prävention hilft, die Arbeitsfähigkeit langfristig zu erhalten und dem Pflegenotstand entgegenzuwirken.
Was beinhaltet das vorgestellte Kurzprogramm?
Es kombiniert über sechs Wochen gezieltes Rücken- und Rumpfkrafttraining ("sanftes Krafttraining") mit Entspannungstechniken wie PMR.
Was ist Progressive Muskelrelaxation (PMR)?
Ein Entspannungsverfahren, bei dem durch bewusstes An- und Entspannen von Muskelgruppen ein Zustand tiefer Entspannung erreicht wird.
Wie wurde der Erfolg des Programms gemessen?
Durch eine Evaluation mit Pre- und Post-Fragebögen sowie physischen Ein- und Ausgangstests bei einer Aktiv- und einer Passivgruppe.
Welche Vorteile bietet Prävention für Arbeitgeber?
Sie senkt Krankheitsstände, erhöht die Mitarbeiterbindung und verbessert die Qualität der Pflege.
- Arbeit zitieren
- Christian Ovelhey (Autor:in), 2008, Ein konzeptionelles Kurzprogramm zur Primärprävention, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/127734