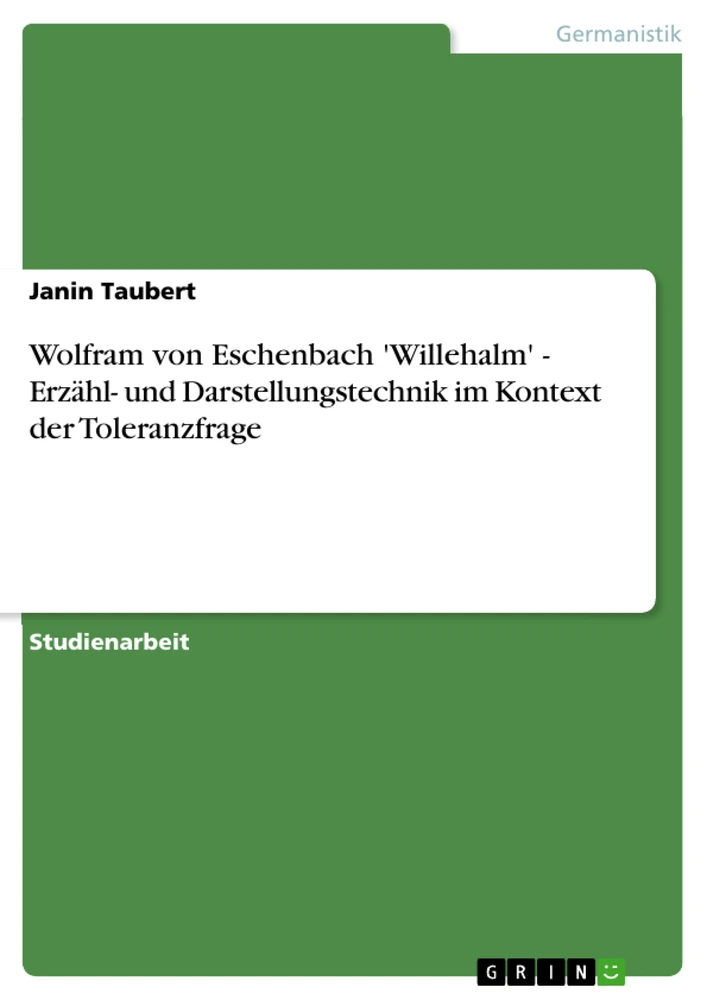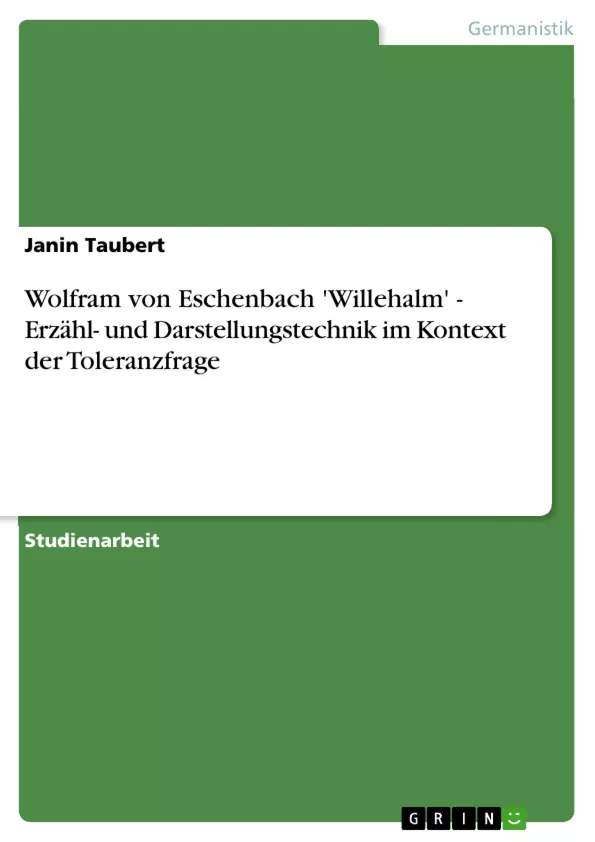„Der Willehalm Wolframs von Eschenbach ist ohne Zweifel das für Toleranzfragen interessanteste Werk der mittelhochdeutschen Literatur.“ Barbara Sabel, deren Dissertation über Toleranzdenken in mittelhochdeutscher Literatur die aktuellste und umfassendste Forschungspublikation zur Frage des Toleranzgehaltes in dem Roman Willehalm von Wolfram von Eschenbach darstellt, trifft mit dieser Äußerung den Kern der problematischen Rezeption dieses Werkes. Einerseits wird es vermieden explizit von Toleranz im Willehalm zu sprechen, indem die Existenz einer Toleranzidee im Mittelalter und damit auch im Willehalm negiert wird. Andererseits gibt es in der Forschung eine Mehrheit, die ausgehend von der Prämisse eines mittelalterlichen Toleranzbegriffes tolerante Gedanken im Willehalm konstatiert. Für viele Autoren zeigt sich in Wolframs Roman sogar eher Humanität als Toleranz. Ausgehend von diesem Humanitätsgedanken wird der Willehalm zuweilen zu einem „der großen Dokumente der Menschlichkeit“ emporstilisiert. Solche unzulässigen Aktualisierungen und weitreichenden Interpretationen zeigen das breite Spektrum auf, in dem sich die Willehalm-Forschung bewegt. Zentrales Problem dieser wissenschaftlichen Auseinandersetzung ist die Unsicherheit im Umgang mit dem Toleranzbegriff. Für jede Arbeit, die sich mit Toleranz im Willehalm auseinandersetzt, ist es demnach unabdingbar zu klären, von welchem Toleranzbegriff die Untersuchung ausgeht. Die bisherige Forschung hat sich vor allem auf die Rede Gyburcs konzentriert. Sabel dagegen fragt, ob „man die Haltung des Erzählers [...] als Toleranzhaltung bezeichnen [kann].“ Dieser Ansatz hat mich zu der Fragestellung inspiriert, inwiefern die Erzähl- und Darstellungsweise Wolframs im Willehalm mit der Frage der Toleranz gegenüber Heiden zusammenhängt. In der folgenden Arbeit werde ich die These vertreten, dass es sich im Willehalm um eine Erzähl- und Darstellungstechnik handelt, die durch distanziertes, kritisches Erzählen, Perspektivenwechsel und die Technik der Widersprüche einen Raum eröffnet, in dem Gegensätzliches ausgehalten werden muss und damit eine Reflexion von Toleranz möglich wird. Es wird zunächst kurz auf den mittelalterlichen Toleranzbegriff eingegangen und dann anhand ausgewählter Aspekte der Narrations- und Darstellungstechnik im Willehalm untersucht, inwiefern diese auf die Infragestellung und Problematisierung des Umgangs mit Andersgläubigen konzipiert ist und damit ein Nachdenken über Toleranz nach sich zieht.
Inhaltsverzeichnis
- Präliminarien
- Der mittelalterliche, tolerantia'- Begriff
- Erzähl- und Darstellungstechnik als Reflexionsraum als, tolerantia’?
- Die Rolle des Erzählers
- Der distanzierte Erzähler
- Der Perspektivenwechsel
- Der,gerechte' Erzähler
- Der (selbst)kritische Erzähler
- Die Technik der Widersprüche
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Darstellung von Toleranz in Wolframs von Eschenbachs "Willehalm". Sie untersucht, ob und wie Wolframs Erzähl- und Darstellungstechnik einen Raum für Toleranz gegenüber Andersgläubigen eröffnet und eine Reflexion von Toleranz ermöglicht.
- Der mittelalterliche Toleranzbegriff und seine Abgrenzung vom modernen Toleranzverständnis.
- Die Analyse von Wolframs Erzähl- und Darstellungstechnik im "Willehalm", insbesondere die Aspekte des distanzierten Erzählens, des Perspektivenwechsels und der Technik der Widersprüche.
- Die Rolle des Erzählers und seine Haltung gegenüber den Heiden.
- Die Verbindung zwischen Erzähltechnik und der Darstellung von Toleranz in Bezug auf den Umgang mit Andersgläubigen.
- Der Einfluss von Wolframs Werk auf die aktuelle Diskussion über Toleranz und Fremdenfeindlichkeit.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit den Präliminarien und gibt einen Überblick über die Rezeption des "Willehalm" im Hinblick auf die Frage der Toleranz. Es werden verschiedene Interpretationen des Werkes vorgestellt und die Problematik des Toleranzbegriffes im Mittelalter diskutiert.
Das zweite Kapitel untersucht den mittelalterlichen Toleranzbegriff und unterscheidet ihn vom modernen Verständnis. Es wird gezeigt, dass die mittelalterliche "tolerantia" ein Konzept des "geduldigen Ertragens" war, das weniger auf Anerkennung als auf die bloße Zulässigkeit von Abweichungen fokussierte.
Das dritte Kapitel befasst sich mit der Erzähl- und Darstellungstechnik im "Willehalm" und fragt, ob und wie diese Technik eine Reflexion von Toleranz ermöglichen kann. Das Kapitel analysiert verschiedene Aspekte der Erzählweise, wie zum Beispiel die Distanz des Erzählers, die Perspektivenwechsel und die Verwendung von Widersprüchen.
Das vierte Kapitel analysiert die Rolle des Erzählers im "Willehalm" und untersucht, wie er sich gegenüber den Heiden positioniert. Es werden verschiedene Aspekte der Erzählerperspektive beleuchtet, wie zum Beispiel die Distanz, die Kritik und die Gerechtigkeit.
Schlüsselwörter
Wolfram von Eschenbach, Willehalm, Toleranz, Toleranzbegriff, Mittelalter, Erzähltechnik, Darstellungstechnik, Distanz, Perspektivenwechsel, Widersprüche, Heiden, Andersgläubige, Humanität, Nächstenliebe, Caritas.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem mittelalterlichen Toleranzbegriff?
Der Begriff „tolerantia“ bedeutete im Mittelalter primär das „geduldige Ertragen“ von Übeln oder Abweichungen, nicht unbedingt die moderne Anerkennung von Gleichwertigkeit.
Warum ist Wolframs „Willehalm“ für die Toleranzfrage so bedeutend?
Das Werk thematisiert den Konflikt zwischen Christen und Heiden auf eine für das Mittelalter ungewöhnlich humane Weise, insbesondere durch die Figur der Gyburc und deren Plädoyer für die Schonung der „Gotteskinder“.
Wie erzeugt Wolfram einen „Reflexionsraum“ für Toleranz?
Durch Techniken wie Perspektivenwechsel, distanziertes Erzählen und das bewusste Darstellen von Widersprüchen zwingt Wolfram den Leser dazu, die festen Fronten zwischen den Religionen zu hinterfragen.
Welche Rolle spielt der Erzähler im „Willehalm“?
Der Erzähler tritt oft (selbst-)kritisch und gerecht auf. Er zeigt Mitgefühl für beide Seiten und vermeidet eine rein einseitige Verteufelung der Heiden.
Was ist der Unterschied zwischen Humanität und Toleranz im Werk?
In der Forschung wird diskutiert, ob Wolframs Haltung eher als „Menschlichkeit“ (Humanität) gegenüber dem leidenden Individuum oder als religiöse Toleranz im modernen Sinne zu verstehen ist.
- Quote paper
- M.A. Janin Taubert (Author), 2005, Wolfram von Eschenbach 'Willehalm' - Erzähl- und Darstellungstechnik im Kontext der Toleranzfrage, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/127760