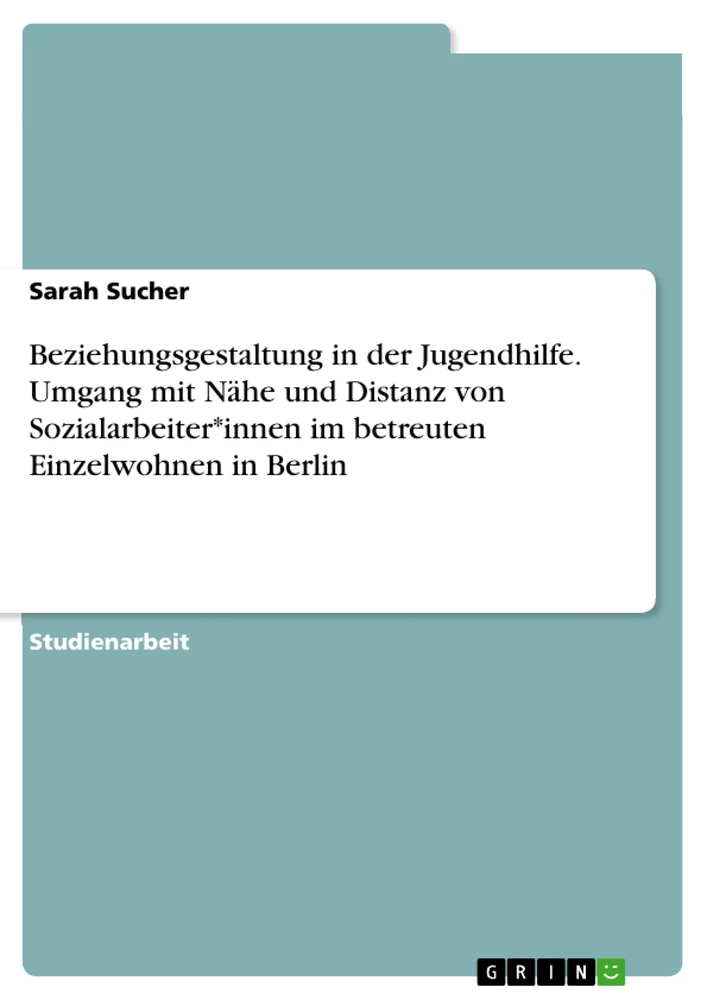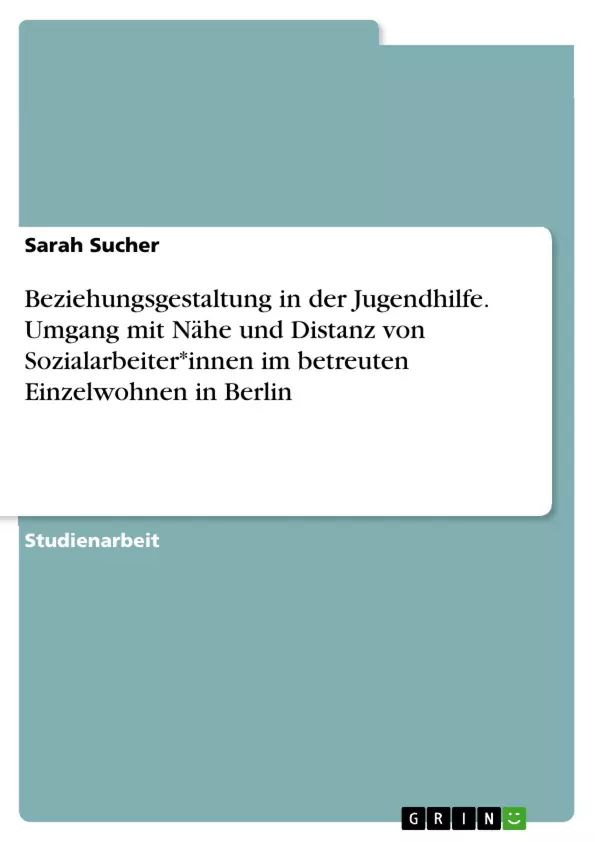Die Praxisarbeit setzt sich mit folgender Forschungsfrage auseinander: Welche Mittel und Wege nutzt die stationäre Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung zur Korrektur negativer Bindungserfahrungen von Kindern und Jugendlichen?
Kinder und Jugendliche können aus unterschiedlichen Gründen entweder phasenweise oder dauerhaft nicht in ihrer Herkunftsfamilie leben, sie werden mit fremden Erwachsenen konfrontiert, die stellvertretend kleinere oder größere Teile der Erziehungs- und Beziehungsarbeit übernehmen. Einige dieser Kinder und Jugendlichen haben in ihrer früheren Kindheit Mangelerfahrungen erlebt, indem Bindungsbedürfnisse wie Nähe und Schutz in extremem Ausmaß nicht passend, ungenügend oder widersprüchlich beantwortet wurden oder der Wunsch nach Distanz nicht gewahrt wurde. Diese Erfahrungen können Kinder und Jugendliche im Grundvertrauen erschüttern und zur Entwicklung einer Bindungsstörung führen. Diese können unterschiedliche Formen annehmen und verschiedene Problematiken mit sich bringen.
Trotz dieser Verbreitung von Bindungsstörungen unter den platzierten Kindern und Jugendlichen steht das Störungsbild nur in einem geringen Fokus der Sozialpädagogik und zählt häufig nur als Begleitdiagnose bei einer psychiatrischen Abklärung. Anhand des SGB VIII werden geregelte Leistungen und Maßnahmen zur Förderung der Entwicklung und zur Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit von Kindern und Jugendlichen für die Kinder- und Jugendhilfe niedergelegt. Wodurch die Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen primär einen Erziehungsauftrag bei Kindern und Jugendlichen erfüllen.
Hinsichtlich Bindungsstörungen besteht ein signifikanter Handlungsbedarf durch die sozialpädagogische Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen, um eine Bindungsfähigkeit aufzubauen und sie zur eigenverantwortlichen Persönlichkeit zu ermächtigen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung.
- 2 Forschungsstand
- 2.1 Bindungstheoretische Grundlagen
- 2.1.1 Bindungsbegriff.
- 2.1.2 Bindungsentwicklung nach Mary Ainsworth...
- 2.1.3 Bindungstheorie.
- 2.1.4 Bindungsqualitäten......
- 2.2 Bindungsstörungen.......
- 2.2.1 Diagnostik von Bindungsstörungen nach dem ICD-10
- 2.2.2 Ätiologie von Bindungsstörungen.........
- 2.1 Bindungstheoretische Grundlagen
- 3 Korrektur negativer Bindungserfahrungen in der stationären Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung ..
- 4.1 Beziehungsgestaltung in der Jugendhilfe - Eine qualitative Studie
- Fragestellung.
- 4.2 Empirische Forschungsmethode
- 4.3 Datenanalyse und -auswertung.
- 4.4 Ergebnisse.......
- 4.5 Limitationen
- 5 Resümee......
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Praxisarbeit zielt darauf ab, die Mittel und Wege der stationären Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung ALEP e.V. zur Korrektur negativer Bindungserfahrungen von Kindern und Jugendlichen zu untersuchen. Die Arbeit basiert auf der Bindungstheorie und untersucht, wie die Einrichtung die Entwicklung einer sicheren Bindung bei Kindern und Jugendlichen mit Bindungsstörungen unterstützt.
- Bindungstheorie und ihre Bedeutung für die Jugendhilfe
- Bindungsstörungen: Ursachen, Symptome und Diagnostik
- Korrektur negativer Bindungserfahrungen in der stationären Jugendhilfe
- Beziehungsgestaltung von Sozialarbeiter*innen im betreuten Einzelwohnen
- Qualitative Forschungsmethoden zur Erhebung der Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Einleitung
Die Einleitung stellt das Thema der Praxisarbeit vor und beschreibt die Bedeutung der Bindungstheorie im Kontext der Jugendhilfe. Sie erläutert den Bedarf an einer korrigierenden Bindungserfahrung für Kinder und Jugendliche mit Bindungsstörungen, die in stationären Einrichtungen leben.
Kapitel 2: Forschungsstand
Dieses Kapitel beleuchtet die theoretischen Grundlagen der Bindungstheorie und erklärt die Entwicklung und Bedeutung der Bindung für die menschliche Entwicklung. Es betrachtet außerdem die verschiedenen Formen von Bindungsstörungen und die Diagnostik und Ätiologie dieser Störungen.
Kapitel 3: Korrektur negativer Bindungserfahrungen in der stationären Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung
In diesem Kapitel werden die Herausforderungen und Chancen der Korrektur negativer Bindungserfahrungen in der stationären Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung beleuchtet. Es werden die Bedürfnisse und Anforderungen der Kinder und Jugendlichen im Kontext dieser Einrichtungen diskutiert.
Kapitel 4: Beziehungsgestaltung in der Jugendhilfe - Eine qualitative Studie
Dieses Kapitel beschreibt die qualitative Studie, die im Rahmen der Praxisarbeit durchgeführt wurde. Es erläutert die Forschungsmethode, die Datenanalyse und die Ergebnisse der Studie. Die Studie untersucht die Mittel und Wege, die die Sozialarbeiter*innen in der Einrichtung ALEP e.V. zur Korrektur negativer Bindungserfahrungen anwenden.
Schlüsselwörter
Bindungstheorie, Bindungsstörungen, Jugendhilfe, stationäre Einrichtungen, Beziehungsgestaltung, Sozialarbeiter*innen, qualitative Forschung, Korrektur negativer Bindungserfahrungen, betreutes Einzelwohnen, ALEP e.V.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der stationären Kinder- und Jugendhilfe bei Bindungsstörungen?
Das Ziel ist die Korrektur negativer Bindungserfahrungen, um Kindern und Jugendlichen den Aufbau einer sicheren Bindungsfähigkeit und die Entwicklung einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit zu ermöglichen.
Wie entstehen Bindungsstörungen bei Kindern in der Jugendhilfe?
Sie entstehen oft durch Mangelerfahrungen in der frühen Kindheit, wenn Bedürfnisse nach Nähe und Schutz unzureichend oder widersprüchlich beantwortet wurden.
Welche Rolle spielt die Bindungstheorie nach Mary Ainsworth?
Sie dient als theoretische Grundlage, um verschiedene Bindungsqualitäten zu verstehen und die Diagnostik von Bindungsstörungen (z. B. nach ICD-10) durchzuführen.
Was leistet der ALEP e.V. im Bereich des betreuten Einzelwohnens?
Die Einrichtung bietet einen Rahmen, in dem Sozialarbeiter gezielt an der Beziehungsgestaltung arbeiten, um traumatisierten Jugendlichen korrigierende Beziehungserfahrungen zu ermöglichen.
Warum wird das Thema Bindungsstörung in der Sozialpädagogik oft vernachlässigt?
Häufig wird es nur als Begleitdiagnose in der Psychiatrie betrachtet, obwohl es eine zentrale Bedeutung für die pädagogische Arbeit und den Erziehungsauftrag nach SGB VIII hat.
- Citation du texte
- Sarah Sucher (Auteur), 2022, Beziehungsgestaltung in der Jugendhilfe. Umgang mit Nähe und Distanz von Sozialarbeiter*innen im betreuten Einzelwohnen in Berlin, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1277681