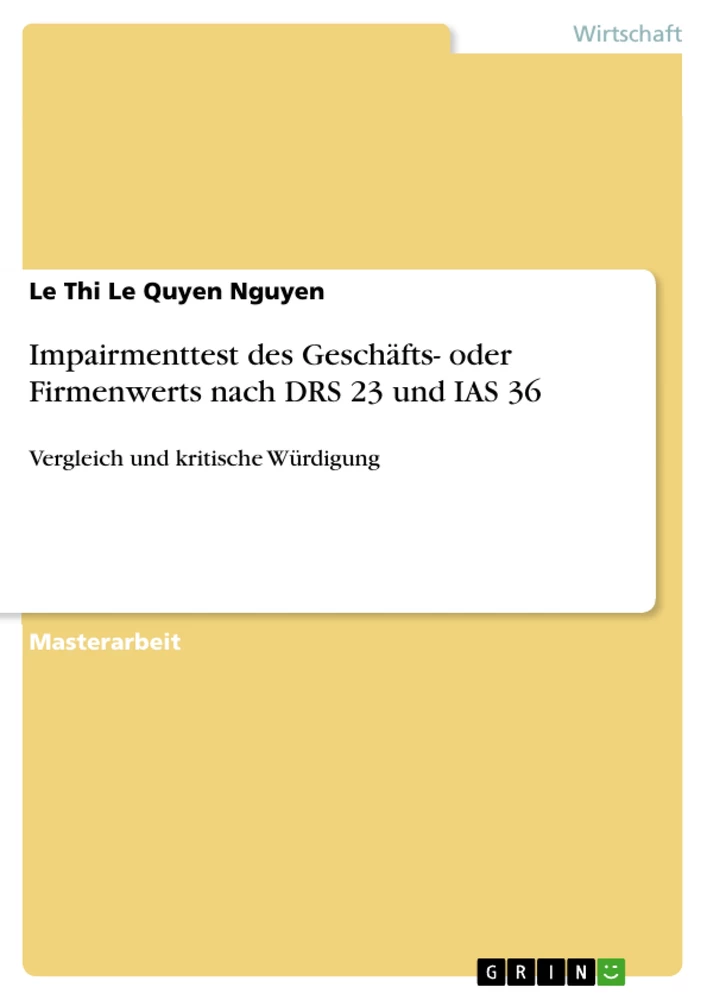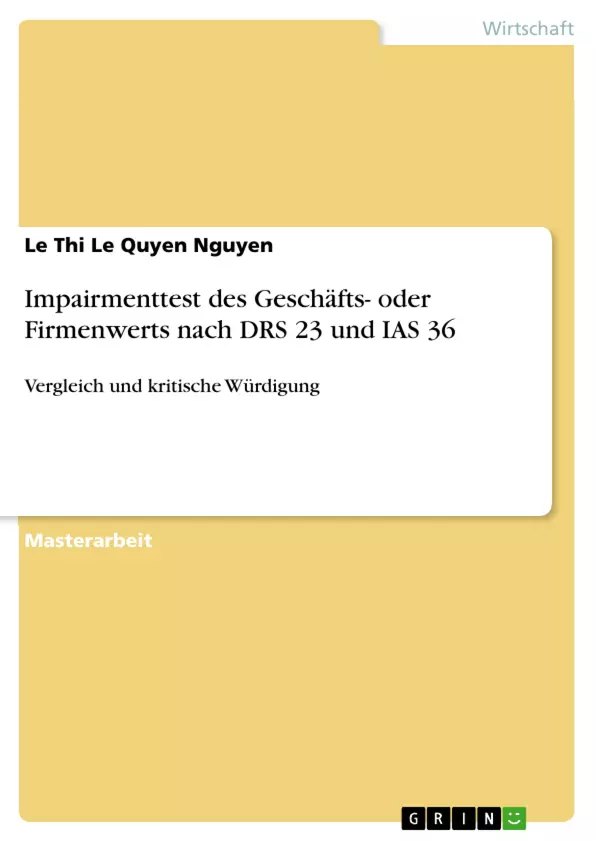Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die Konzeptionen und bilanziellen Auswirkungen des Goodwill Impairment Tests sowohl nach IAS 36 als auch nach DRS 23 darzustellen, um diese anschließend miteinander zu vergleichen und kritisch zu würdigen. Dazu sollen auch aktuelle Themen, wie die vom IASB derzeitig geführte Diskussion und der Ukraine Krieg, berücksichtigt werden.
Der derivative Geschäfts- oder Firmenwert, auch Goodwill genannt, nimmt sowohl in HGB- als auch in IFRS-Konzernabschlüssen eine zentrale Stellung ein. Dieser entsteht – vereinfacht ausgedrückt − als Differenz zwischen dem gezahlten Kaufpreis einerseits und dem Reinvermögen des erworbenen Unternehmens andererseits. Ein Blick in die Konzernabschlüsse deutscher, aber auch internationaler Konzerne zeigt, dass sich dieser immaterielle Vermögensgegenstand bzw. Vermögenswert zu einer der zentralen Bilanzgrößen entwickelt hat. In den letzten Jahren haben die Goodwill Bestände zahlreicher Konzerne trotz Krisen wie der Corona Pandemie zugenommen. Nicht zuletzt deshalb ist der Goodwill Gegenstand intensiver Diskussionen in Forschung und Praxis. Auch der International Accounting Standard Boards (IASB) hält die Debatte aufrecht. Im März 2020 hat der Standardsetzer ein Diskussionspapier veröffentlicht mit dem Ziel, die Bilanzierung des Goodwill zu verbessern.
Ein Themenschwerpunkt bildet die Folgebehandlung des Goodwill. Nach den IFRS gilt seit 2004 der sog. Impairment Only Approach. Der Goodwill ist demnach nicht mehr planmäßig abzuschreiben, sondern unterliegt regelmäßigen Werthaltigkeitstests (im Folgenden auch als Impairment Test bezeichnet). Demgegenüber sieht das HGB eine planmäßige Abschreibung über die betriebliche Nutzungsdauer vor. Zu einer außerplanmäßigen Abschreibung des Geschäfts- oder Firmenwertes kann es kommen, sofern es sich um eine voraussichtlich dauernde Wertminderung handelt. Während das HGB keine kodifizierten Vorschriften für die Prüfung und Ermittlung einer solchen außerplanmäßigen Abschreibung bereithält, stehen dem Bilanzierenden nach DRS 23 gleich drei Alternativen zur Verfügung, die im Standardentwurf so nicht enthalten waren.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- I. Problemstellung und Zielsetzung
- II. Gang der Untersuchung
- B. Theoretische Grundlagen
- I. Geschäfts- oder Firmenwert nach den Vorschriften des deutschen Handelsrechts (HGB)
- 1. Begriffsabgrenzung und Rechtsnatur
- 2. Entstehung des GoF als Folge der Kapitalkonsolidierung
- a) Vorbemerkung
- b) Methodik der Kapitalkonsolidierung nach der Erwerbsmethode
- 3. Bilanzielle Behandlung des GoF nach HGB
- a) Ansatz, Bewertung und Ausweis
- b) Folgebewertung
- II. Goodwill nach den internationalen Rechnungslegungsvorschriften (IFRS)
- 1. Wesen und bilanzielle Behandlung des Goodwill
- 2. Goodwillermittlung – Erstmaliger Wertansatz und Folgebehandlung
- a) Ermittlungsmethodik nach IFRS 3
- b) Full Goodwill Methode vs. Neubewertungsmethode
- c) Folgebewertung
- III. Zwischenvergleich: Synopse der Goodwillbilanzierung nach HGB und IFRS
- C. Werthaltigkeitstest des Geschäfts- oder Firmenwertes nach DRS 23
- I. Überblick über DRS 23
- II. Grundkonzeption des Werthaltigkeitstests nach DRS 23
- 1. Zeitpunkt der Durchführung des Werthaltigkeitstests
- 2. Vorgehensweise nach dem Standardverfahren
- 3. Aufteilung des Geschäfts- oder Firmenwertes auf Geschäftsfelder
- 4. Wertaufholung
- III. Alternatives Verfahren
- D. Konzeption und bilanzielle Auswirkungen des Impairment Tests nach IAS 36
- I. Überblick über IAS 36
- II. Konzeption des Goodwill Impairment Tests
- 1. Pflicht zur Durchführung des Impairment Test
- 2. Pflicht zur Überprüfung einer möglichen Wertaufholung
- III. Wertkategorien des erzielbaren Betrags
- 1. Beizulegender Zeitwert abzüglich der Veräußerungskosten
- 2. Nutzungswert
- IV. Verteilung des Goodwill auf zahlungsmittelgenerierende Einheiten
- 1. Vorbemerkung
- 2. Abgrenzung der zahlungsmittelgenerierenden Einheit
- 3. Goodwill Allokation auf zahlungsmittelgenerierende Einheiten
- V. Bilanzielle Erfassung einer Wertminderung
- 1. Verteilung des Wertminderungsaufwands
- 2. Berücksichtigung nicht-beherrschender Anteilen
- E. Vergleichende Analyse und daraus resultierende Konsequenzen
- I. Fallbeispiele zur Prüfung und Ermittlung des Abschreibungsbedarfs
- 1. Vorbemerkung
- 2. Ermittlungsmethode nach DRS 23
- 3. Ermittlungsmethode nach IAS 36
- II. Vergleich hinsichtlich der Konzeption des Impairment Tests
- 1. Anhaltspunkte
- 2. Bewertungsobjekt (Werthaltigkeitstestebene des Goodwill)
- 3. Verteilung des Geschäfts- oder Firmenwertes
- III. Vergleich hinsichtlich der Behandlung der zwischenzeitlich entstandenen stillen Reserven und Lasten
- IV. Vergleich hinsichtlich bilanzpolitischer Ermessensspielräume
- F. Aktuelle Themen zur Folgebilanzierung des Geschäfts- oder Firmenwertes
- I. IASB Discussion Paper DP/2020/1 „Business Combinations Disclosures, Goodwill and Impairment”
- II. Ukraine Krieg und seine Auswirkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht den Impairmenttest des Geschäfts- oder Firmenwerts nach DRS 23 und IAS 36. Ziel ist ein vergleichender und kritischer Abgleich beider Standards. Die Arbeit beleuchtet die Unterschiede in Konzeption und Anwendung und analysiert die daraus resultierenden Konsequenzen für die Bilanzierung.
- Vergleich der Konzeption des Impairment Tests nach DRS 23 und IAS 36
- Analyse der bilanzpolitischen Ermessensspielräume
- Untersuchung der Auswirkungen auf die Bilanzierung
- Bewertung der Unterschiede in der Behandlung stiller Reserven und Lasten
- Einbeziehung aktueller Themen wie des IASB Discussion Papers und der Auswirkungen des Ukraine-Krieges
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einleitung: Dieses einleitende Kapitel beschreibt die Problemstellung der Masterarbeit, die im Vergleich des Impairment Tests nach DRS 23 und IAS 36 besteht. Es formuliert die Zielsetzung der Arbeit, nämlich die Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider Standards herauszuarbeiten und kritisch zu bewerten. Der Gang der Untersuchung wird skizziert, um dem Leser einen Überblick über den Aufbau und die Methodik der Arbeit zu geben. Die Einleitung schafft somit die Grundlage für die folgenden Kapitel, in denen die theoretischen Grundlagen, die vergleichende Analyse und die Schlussfolgerungen präsentiert werden.
B. Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für den Vergleich der Impairment Tests. Es beschreibt zunächst den Geschäfts- oder Firmenwert nach HGB, inklusive seiner Entstehung, bilanziellem Ansatz und Bewertung. Anschließend wird der Goodwill nach IFRS behandelt, wobei die Ermittlungsmethodik, der Erst- und Folgewertansatz sowie die unterschiedlichen Methoden (Full Goodwill, Neubewertung) erläutert werden. Der Vergleich beider Bilanzierungsmethoden im dritten Abschnitt des Kapitels bereitet den Weg zum darauf folgenden Kapitel, in dem die Werthaltigkeitstests im Detail analysiert werden.
C. Werthaltigkeitstest des Geschäfts- oder Firmenwertes nach DRS 23: Dieses Kapitel konzentriert sich auf den Werthaltigkeitstest nach DRS 23. Es gibt einen Überblick über den Standard, erklärt die Grundkonzeption des Tests inklusive des Zeitpunkts der Durchführung, der Vorgehensweise nach dem Standardverfahren und dem alternativen Verfahren. Die Aufteilung des Geschäfts- oder Firmenwertes auf Geschäftsfelder sowie die Behandlung der Wertaufholung werden ebenfalls detailliert beschrieben. Dieses Kapitel bildet eine fundierte Grundlage für den anschließenden Vergleich mit dem Impairment Test nach IAS 36.
D. Konzeption und bilanzielle Auswirkungen des Impairment Tests nach IAS 36: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Impairment Test nach IAS 36. Es beschreibt die Pflicht zur Durchführung des Tests, die Überprüfung der Wertaufholung, die verschiedenen Wertkategorien des erzielbaren Betrags (beizulegender Zeitwert und Nutzungswert), und die Systematik des Tests selbst. Ein Schwerpunkt liegt auf der Verteilung des Goodwill auf zahlungsmittelgenerierende Einheiten und der bilanziellem Erfassung einer Wertminderung, einschließlich der Verteilung des Wertminderungsaufwands und der Berücksichtigung nicht-beherrschender Anteile. Die detaillierte Darstellung bildet einen wichtigen Kontrastpunkt zum vorherigen Kapitel über DRS 23.
E. Vergleichende Analyse und daraus resultierende Konsequenzen: Dieses Kapitel stellt einen detaillierten Vergleich zwischen den Impairment Tests nach DRS 23 und IAS 36 dar. Anhand von Fallbeispielen wird die praktische Anwendung beider Standards veranschaulicht und die Unterschiede in der Ermittlung des Abschreibungsbedarfs aufgezeigt. Der Vergleich konzentriert sich auf die Konzeption des Impairment Tests, das Bewertungsobjekt, die Verteilung des Geschäfts- oder Firmenwertes, die Behandlung stiller Reserven und Lasten sowie die bilanzpolitischen Ermessensspielräume. Das Kapitel bietet einen fundierten Vergleich, der die wesentlichen Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider Standards hervorhebt.
F. Aktuelle Themen zur Folgebilanzierung des Geschäfts- oder Firmenwertes: Dieses Kapitel behandelt aktuelle Entwicklungen im Bereich der Folgebilanzierung des Geschäfts- oder Firmenwertes. Es analysiert relevante aktuelle Themen, wie das IASB Discussion Paper DP/2020/1 und die Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die Bilanzierung. Der Fokus liegt auf der Darstellung aktueller Herausforderungen und Diskussionen im Bereich der Goodwill-Bilanzierung.
Schlüsselwörter
Impairment Test, Geschäfts- oder Firmenwert, Goodwill, DRS 23, IAS 36, HGB, IFRS, Werthaltigkeitstest, Bilanzierung, Folgebewertung, zahlungsmittelgenerierende Einheiten, Wertaufholung, bilanzpolitische Ermessensspielräume.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Masterarbeit: Impairment Test nach DRS 23 und IAS 36
Was ist der Gegenstand dieser Masterarbeit?
Diese Masterarbeit vergleicht und analysiert kritisch den Impairment Test des Geschäfts- oder Firmenwerts nach den deutschen Rechnungslegungsstandards (DRS 23) und den International Financial Reporting Standards (IAS 36). Der Fokus liegt auf den Unterschieden in Konzeption und Anwendung beider Standards und den daraus resultierenden Konsequenzen für die Bilanzierung.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Vergleich der Konzeption des Impairment Tests nach DRS 23 und IAS 36, Analyse der bilanzpolitischen Ermessensspielräume, Untersuchung der Auswirkungen auf die Bilanzierung, Bewertung der Unterschiede in der Behandlung stiller Reserven und Lasten, und die Einbeziehung aktueller Themen wie des IASB Discussion Papers und der Auswirkungen des Ukraine-Krieges.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sechs Kapitel gegliedert: Einleitung (Problemstellung, Zielsetzung, Gang der Untersuchung), Theoretische Grundlagen (Geschäfts- oder Firmenwert nach HGB und Goodwill nach IFRS), Werthaltigkeitstest nach DRS 23, Impairment Test nach IAS 36, Vergleichende Analyse und daraus resultierende Konsequenzen (inkl. Fallbeispiele), und Aktuelle Themen zur Folgebilanzierung (IASB Discussion Paper und Auswirkungen des Ukraine-Krieges).
Was sind die zentralen Unterschiede zwischen dem Impairment Test nach DRS 23 und IAS 36?
Die Arbeit untersucht detailliert die Unterschiede in der Konzeption des Impairment Tests, dem Bewertungsobjekt, der Verteilung des Geschäfts- oder Firmenwerts, der Behandlung stiller Reserven und Lasten sowie der bilanzpolitischen Ermessensspielräume. Konkrete Unterschiede werden anhand von Fallbeispielen veranschaulicht.
Welche Bedeutung haben bilanzpolitische Ermessensspielräume im Kontext dieser Arbeit?
Die Arbeit analysiert die bilanzpolitischen Ermessensspielräume, die sich aus den Unterschieden zwischen DRS 23 und IAS 36 ergeben. Es wird untersucht, wie diese Spielräume die Bilanzierung beeinflussen können.
Wie werden stille Reserven und Lasten in beiden Standards behandelt?
Die Arbeit vergleicht die Behandlung von stillen Reserven und Lasten im Rahmen des Impairment Tests nach DRS 23 und IAS 36 und hebt die Unterschiede in der jeweiligen Behandlung hervor.
Welche aktuellen Entwicklungen werden berücksichtigt?
Die Arbeit berücksichtigt aktuelle Entwicklungen, insbesondere das IASB Discussion Paper DP/2020/1 „Business Combinations Disclosures, Goodwill and Impairment” und die Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die Bilanzierung des Geschäfts- oder Firmenwerts.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Impairment Test, Geschäfts- oder Firmenwert, Goodwill, DRS 23, IAS 36, HGB, IFRS, Werthaltigkeitstest, Bilanzierung, Folgebewertung, zahlungsmittelgenerierende Einheiten, Wertaufholung, bilanzpolitische Ermessensspielräume.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist ein vergleichender und kritischer Abgleich der Standards DRS 23 und IAS 36 bezüglich des Impairment Tests des Geschäfts- oder Firmenwerts. Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten sollen herausgearbeitet und kritisch bewertet werden.
Wo finde ich detaillierte Informationen zu den einzelnen Kapiteln?
Die Zusammenfassung der Kapitel im HTML-Dokument bietet einen Überblick über den Inhalt jedes Kapitels und seine Bedeutung im Gesamtkontext der Arbeit.
- Quote paper
- Le Thi Le Quyen Nguyen (Author), 2022, Impairmenttest des Geschäfts- oder Firmenwerts nach DRS 23 und IAS 36, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1277685