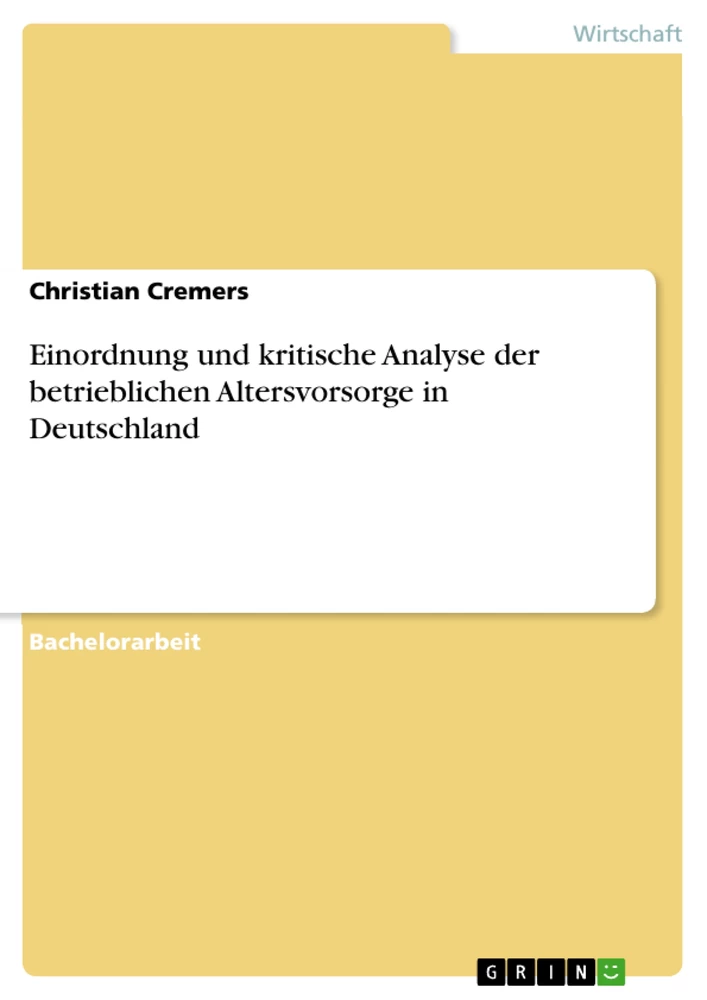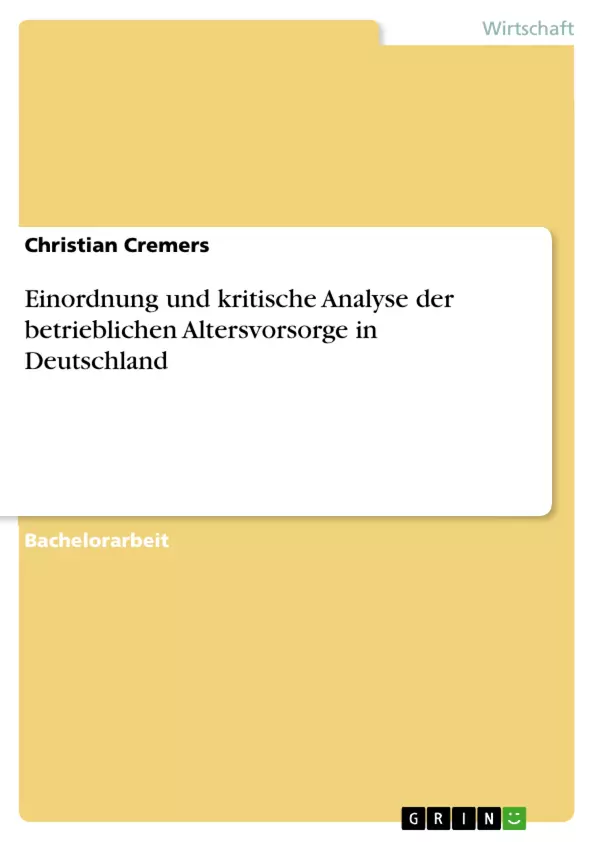Der sogenannte Standardrentner erhält aktuell eine Brutto-Rente von 1.537,20 Euro. Der Standardrentner hat 45 Jahre genau den jeweiligen Durchschnittsverdienst der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten erzielt. Derzeit müssten die Versicherten monatlich im Durchschnitt 3.290 Euro verdienen, um einen Entgeltpunkt zu erwerben. Dies trifft sicherlich auf die Wenigsten in der Bevölkerung zu. Viele Personen haben geringer bezahlte Tätigkeiten oder können aufgrund von Kindererziehung, Krankheit, Arbeitslosigkeit und der Pflege von Angehörigen weniger in die Rentenversicherung einzahlen. Die staatlichen Sozialleistungen fangen lediglich einen Teil der Einkommenseinbußen auf.
Hinzu kommt noch, dass von der Bruttorente erhebliche Abzüge abgehen. So werden von der Rentenversicherung sofort die Krankenversicherungs- und Pflegeversicherungsbeiträge, je nach Beitragssatz der jeweiligen Krankenkasse, einbehalten. Dadurch stehen dem Standardrentner von der Bruttorente in Höhe von 1.537,20 Euro nur knapp 1.356 Euro netto zur Verfügung. Dies ist noch abhängig von dem individuellen Steuersatz, sodass gegebenenfalls noch Steuern abzuführen sind.
In der aktuellen Zeit mit einer hohen Inflation wird die Problemlage besonders deutlich: Die gesetzliche Rente reicht nicht mehr aus, um im Alter den Lebensstandard zu sichern, vielmehr besteht sogar noch die Gefahr, auf staatliche Sozialleistungen angewiesen zu sein. Seitens der Politik wurde dieser Sachverhalt lange nicht erkannt oder infrage gestellt. Dr. Norbert Blüm verficht als Bundesminister für Arbeit und Soziales während seiner Amtszeit von 1982 bis 1998 die Position, dass die gesetzliche Rente für die Gesamtbevölkerung sicher und auskömmlich sei. Jedoch ist es seit dieser Aussage zu mehreren Absenkungen des Rentenniveaus gekommen. Bedingt durch die abnehmende Gesamtbevölkerung, dem demographischen Wandel und die wachsende Lebenserwartung konnte das Versorgungsniveau nicht mehr gehalten werden. Im Jahr 2004 musste die rot-grüne Koalition unter Bundeskanzler Schröder das Rentenniveau schrittweise von 48 % auf 43 % absenken. Daher ist eine zusätzliche Altersvorsorge zur Sicherung des späteren Lebensstandards und zur Vermeidung von Altersarmut unerlässlich. Eine Möglichkeit zusätzlich für das Alter vorzusorgen ist die betriebliche Altersvorsorge. Viele Firmen bieten ihren Mitarbeitern entsprechende Verträge an oder sprechen eine Versorgungszusage aus.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Hinführung zur Thematik
- 1.2 Problemstellung
- 1.3 Aufbau und Vorgehensweise
- 2. Methodik
- 3. Die drei Säulen der Altersvorsorge in Deutschland
- 3.1 Öffentlich-rechtliche Pflichtsysteme
- 3.1.1 Gesetzliche Rentenversicherung
- 3.1.2 Beamtenversorgung
- 3.1.3 Berufsständische Versorgungseinrichtung
- 3.2 Betriebliche Altersvorsorge
- 3.2.1 Tarifvertraglicher Anspruch
- 3.2.2 Betriebliche Übung / Betriebsvereinbarung
- 3.2.3 Gesetzlicher Anspruch
- 3.3 Private Altersvorsorge
- 3.3.1 Riester-Rente
- 3.3.2 Lebensversicherungen
- 3.3.3 Aktien
- 3.3.4 Immobilien
- 3.3.5 Basisrente
- 4. Grundlagen der betrieblichen Altersvorsorge
- 4.1 Merkmale und Begriff der betrieblichen Altersvorsorge
- 4.2 Entwicklungsschritte in den letzten Jahren
- 4.3 Gesetzliche Grundlagen
- 4.3.1 Rechtsanspruch auf Entgeltumwandlung
- 4.3.2 Pflichten des Arbeitgebers
- 4.3.3 Unfallverfallbarkeit der Ansprüche
- 4.3.4 Übertragung des Wertguthabens/Fortführung der Versicherung
- 4.3.5 Sicherung der Versorgungsleistungen
- 4.3.6 Staatliche Überwachung der Leistungszusagen
- 4.4 Sozialversicherungsrechtliche Besonderheiten
- 4.4.1 Beitragspflicht in der Leistungsphase
- 4.4.2 Nachteile bei Sozialleistungen
- 4.4.3 Begünstigung in der Einzahlungsphase
- 4.5 Steuerliche Rahmenbedingung
- 4.5.1 Nachgelagerte Besteuerung
- 4.5.2 Steuerfreiheit in die Einzahlungsphase
- 4.5.3 Zusätzliche Förderung für Geringverdiener
- 4.6 Zusagearten
- 4.6.1 Direktzusage/Pensionszusage
- 4.6.2 Beitragsorientierte Leistungszusage
- 4.6.3 Beitragszusage mit Mindestleistung
- 4.6.4 Reine Beitragszusage
- 4.7 Durchführungsformen
- 4.7.1 Direktversicherung
- 4.7.2 Pensionskasse
- 4.7.3 Unterstützungskasse
- 4.7.4 Pensionsfonds
- 4.7.5 Direktzusage/Pensionszusage
- 4.8 Finanzierungsmöglichkeiten
- 4.8.1 Arbeitgeberfinanziert
- 4.8.2 Mischformen
- 4.9 Staatliche und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen
- 4.9.1 Umlageverfahren
- 4.9.2 Soziale Komponenten
- 4.9.3 Leistungsansprüche
- 5. Institutionelle Geldanlage
- 5.1 Grundlagen
- 5.2 Staatliche Rahmenbedingungen
- 5.3 Vertragliche Garantien
- 5.4 Marktumfeld
- 6. Haftungsrisiken für den Arbeitgeber
- 7. Vergleich mit Ansprüchen aus der privaten Rentenversicherung
- 7.1 Steuerrechtliche Betrachtung
- 7.2 Sozialversicherungsrechtliche Betrachtung
- 7.3 Betrachtung der Wertentwicklungsmöglichkeiten
- 8. Gestaltungsaspekte bei der Altersvorsorge
- 9. Mögliche Alternativen zur Altersabsicherung der Bevölkerung
- 10. Zusammenfassung und Entwicklungstendenzen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit der betrieblichen Altersvorsorge in Deutschland. Ziel ist es, die verschiedenen Formen der betrieblichen Altersvorsorge zu analysieren und deren Vor- und Nachteile aufzuzeigen.
- Die verschiedenen Formen der betrieblichen Altersvorsorge
- Die rechtlichen Rahmenbedingungen der betrieblichen Altersvorsorge
- Die Finanzierungsmöglichkeiten der betrieblichen Altersvorsorge
- Die Haftungsrisiken für den Arbeitgeber bei der betrieblichen Altersvorsorge
- Der Vergleich der betrieblichen Altersvorsorge mit anderen Formen der Altersvorsorge
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Die Einleitung führt in die Thematik der betrieblichen Altersvorsorge ein und erläutert die Problemstellung sowie den Aufbau und die Vorgehensweise der Arbeit.
- Kapitel 2: In diesem Kapitel wird die Methodik der Arbeit dargestellt.
- Kapitel 3: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den drei Säulen der Altersvorsorge in Deutschland: der öffentlich-rechtlichen Pflichtsystemen, der betrieblichen Altersvorsorge und der privaten Altersvorsorge.
- Kapitel 4: In diesem Kapitel werden die Grundlagen der betrieblichen Altersvorsorge erläutert, einschließlich der Merkmale, der Entwicklungsschritte, der gesetzlichen Grundlagen, der sozialversicherungsrechtlichen Besonderheiten, der steuerlichen Rahmenbedingungen, der Zusagearten, der Durchführungsformen, der Finanzierungsmöglichkeiten sowie der staatlichen und kirchlichen Zusatzversorgungseinrichtungen.
- Kapitel 5: Dieses Kapitel befasst sich mit der institutionellen Geldanlage im Zusammenhang mit der betrieblichen Altersvorsorge.
- Kapitel 6: In diesem Kapitel werden die Haftungsrisiken für den Arbeitgeber bei der betrieblichen Altersvorsorge analysiert.
- Kapitel 7: Dieses Kapitel vergleicht die Ansprüche aus der betrieblichen Altersvorsorge mit den Ansprüchen aus der privaten Rentenversicherung in Bezug auf steuerliche, sozialversicherungsrechtliche und wertsteigernde Aspekte.
- Kapitel 8: Dieses Kapitel beleuchtet die Gestaltungsaspekte der betrieblichen Altersvorsorge.
- Kapitel 9: Dieses Kapitel stellt mögliche Alternativen zur Altersabsicherung der Bevölkerung dar.
Schlüsselwörter
Betriebliche Altersvorsorge, Altersvorsorge, Altersvorsorge in Deutschland, Rechtsanspruch, Entgeltumwandlung, Finanzierungsmöglichkeiten, Haftungsrisiken, Direktzusage, Pensionskasse, Direktversicherung, private Altersvorsorge, gesetzliche Rentenversicherung, Beamtenversorgung.
Häufig gestellte Fragen
Warum reicht die gesetzliche Rente in Deutschland oft nicht mehr aus?
Durch den demographischen Wandel und Absenkungen des Rentenniveaus deckt die gesetzliche Rente den Lebensstandard im Alter oft nicht mehr vollständig ab.
Was ist die betriebliche Altersvorsorge (bAV)?
Es ist eine Form der Zusatzvorsorge, bei der Arbeitgeber ihren Mitarbeitern Leistungen zur Alters-, Invaliditäts- oder Hinterbliebenenversorgung zusagen.
Was bedeutet „Entgeltumwandlung“?
Arbeitnehmer verzichten auf einen Teil ihres Bruttogehalts, der direkt in eine betriebliche Altersvorsorge eingezahlt wird, was oft Steuern und Sozialabgaben spart.
Welche Durchführungsformen der bAV gibt es?
Die fünf Wege sind: Direktzusage, Direktversicherung, Pensionskasse, Unterstützungskasse und Pensionsfonds.
Gibt es Nachteile bei der betrieblichen Altersvorsorge?
In der Auszahlungsphase sind die Leistungen oft voll steuerpflichtig und es fallen Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung an (nachgelagerte Besteuerung).
- Arbeit zitieren
- Christian Cremers (Autor:in), 2022, Einordnung und kritische Analyse der betrieblichen Altersvorsorge in Deutschland, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1277856