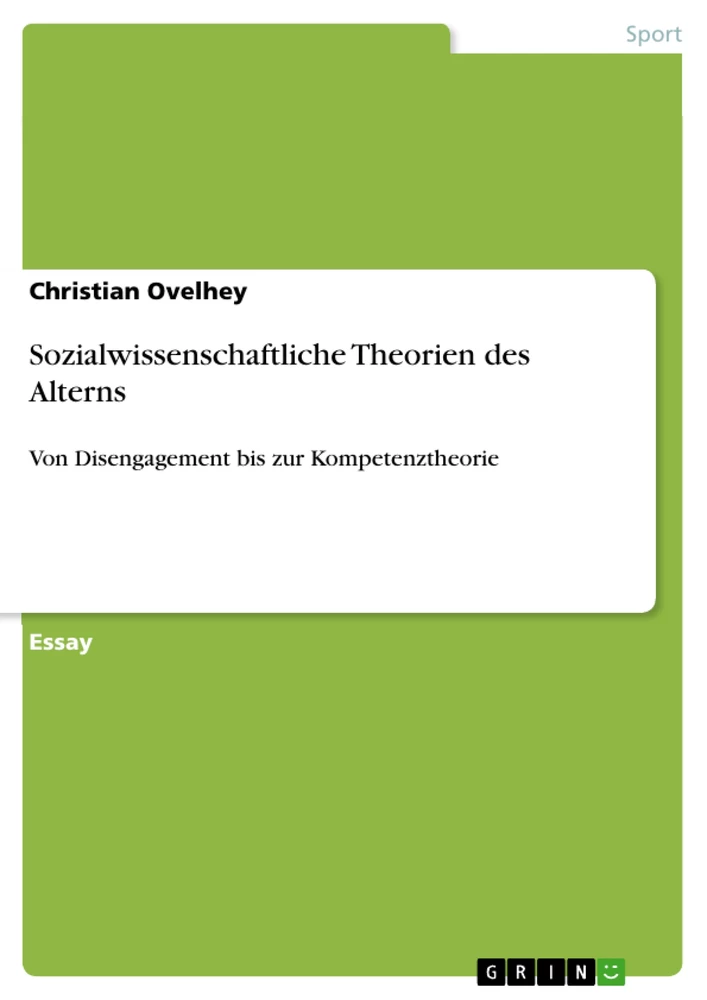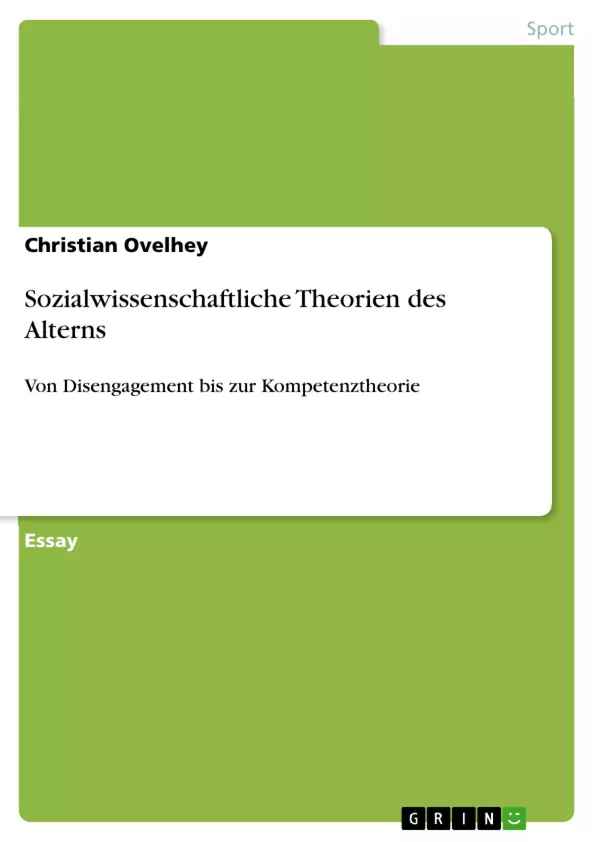Zusammenfassende Darstellung aller aktuellen Alterstheorien und ihrer Umgangsweise mit dem Thema "Altern". „Überwiegt die Mangelseite, so versinkt die Welt in einem depressiven Jammertal, alles ist aussichtslos, mit einem Grauschleier überdeckt. Lichtblicke werden kaum bemeerkt, haben wenig Gewicht.“ (zitiert nach Eisenmann, 2000).
Die Defizittheorie begründet sich auf einer empirischen Studie von Yerkes aus dem Jahre 1921, bei der Leistungs- und Intelligenzmessungen bei Militärangehorigen der US-Streitkräfte zur Zeit des ersten Weltkriegs durchgeführt wurden, da man glaubte, daraus auf die Karriere der Untersuchten schließen zu können.Hierbei beobachtete man einen Anstieg der Intelligenz bis in das dritte Lebensjahrzehnt und danach einen kontinuierlichen Abfall.Leider schloss man daraus, dass dieser Umstand auch auf alle anderen menschlichen Funktionen in physischer und psychischer Hinsicht zuträfe, was in den folgenden Jahren mehrfach widerlegt worden ist.
Diese Defizittheorie betrifft also im Wesentlichen die Perspektive des Mangels, des Fehlens bestimmter Fähigkeiten oder Fertigkeiten, das Gefühl von etwas Unfertigem.Teilweise wird sie sogar als eine bloße Beschreibung von medizinischen und psychologischen Beobachtungen dargestellt. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Theorien des Alterns
- Defizittheorie
- Kompetenz-Modell
- Aktivitätstheorie
- Disengagementtheorie
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit verschiedenen Theorien des Alterns und analysiert deren Relevanz für das Verständnis des Sports in verschiedenen Lebensaltern, insbesondere im Hinblick auf die Bedürfnisse und Herausforderungen älterer Menschen.
- Defizitperspektive vs. Kompetenzorientierung
- Akzeptanz des Alterns und Bewältigung von Rollenverlusten
- Bedeutung von Aktivität und sozialer Integration im Alter
- Kritik an traditionellen Theorien und neue Perspektiven
- Entwicklung von altersgerechten Sportangeboten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Defizittheorie, die auf einer empirischen Studie von Yerkes aus dem Jahr 1921 basiert, sieht das Altern als einen Prozess des Abbaus von Fähigkeiten und Fertigkeiten. Sie betont die negative Perspektive des Mangels und des Verlustes, was zu einer pessimistischen Sichtweise auf das Alter führt. Die Betroffenen vergleichen ihre aktuellen Fähigkeiten mit denen ihrer Jugend und sehen den Alterungsprozess als eine Art Krankheit an. Die Defizittheorie wird jedoch als unzureichend und veraltet betrachtet, da sie wichtige Einflussfaktoren wie den Gesundheitszustand oder den Bildungsstand nicht berücksichtigt.
Das Kompetenz-Modell hingegen betont die Akzeptanz des Alters und die Entwicklung von Kompetenzen, die es älteren Menschen ermöglichen, ihr Leben selbstbestimmt und lebenswert zu gestalten. Es unterteilt Kompetenzen in fünf Bereiche: lebenspraktische, leistungsrelevante, kreative, Krisenbewältigungskompetenzen und soziale Kompetenzen. Das Kompetenz-Modell sieht das Altern als einen Prozess der Anpassung und Neuausrichtung, bei dem die eigenen Fähigkeiten und Bedürfnisse neu bewertet werden.
Die Aktivitätstheorie von Rudolf Tartler sieht Aktivität als Schlüssel zum erfolgreichen Altern. Sie argumentiert, dass der Verlust des Berufslebens durch adäquaten Ersatz kompensiert werden sollte, um Glück und Zufriedenheit im Alter zu gewährleisten. Die Theorie betont die Bedeutung von sozialer Integration und die Notwendigkeit, neue Formen der Aktivität zu finden, um dem Bedürfnis nach Aktivität und Sinnhaftigkeit gerecht zu werden.
Die Disengagementtheorie von Cumming und Henry sieht den sozialen Rückzug als eine natürliche und positive Entwicklung im Alter. Sie argumentiert, dass die Gesellschaft und der ältere Mensch bereit sind, ihre Bindungen zueinander zu lösen, um sich in das soziale Rollensystem einzupassen. Die Theorie wird jedoch heute als nicht mehr haltbar betrachtet, da sie den Verlustperspektive nicht ausreichend berücksichtigt und die Bedeutung von Aktivität und sozialer Integration im Alter unterschätzt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Theorien des Alterns, Defizittheorie, Kompetenz-Modell, Aktivitätstheorie, Disengagementtheorie, Alter, Lebensalter, Sport, Aktivität, soziale Integration, Rollenverlust, Lebensqualität, Altersgerechte Sportangebote, Kompetenzentwicklung, Akzeptanz des Alterns, gesellschaftliche Normen, Wertewandel, empirische Forschung, psychologische Aspekte, soziologische Aspekte.
- Quote paper
- Dipl.Sportwissenschaftler Christian Ovelhey (Author), 2007, Sozialwissenschaftliche Theorien des Alterns, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/127787