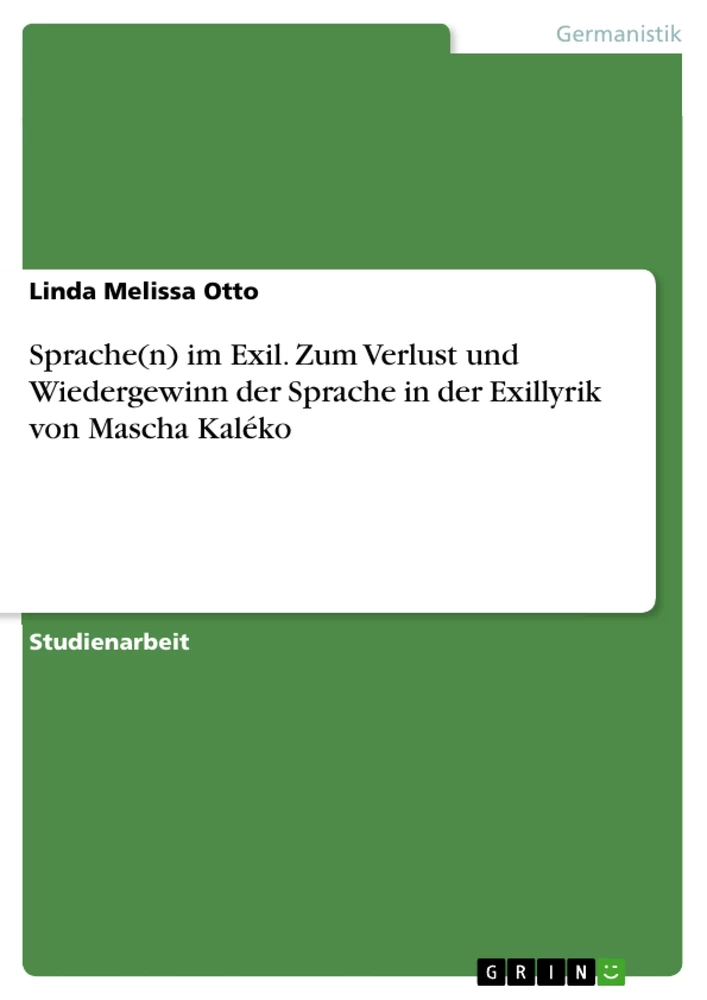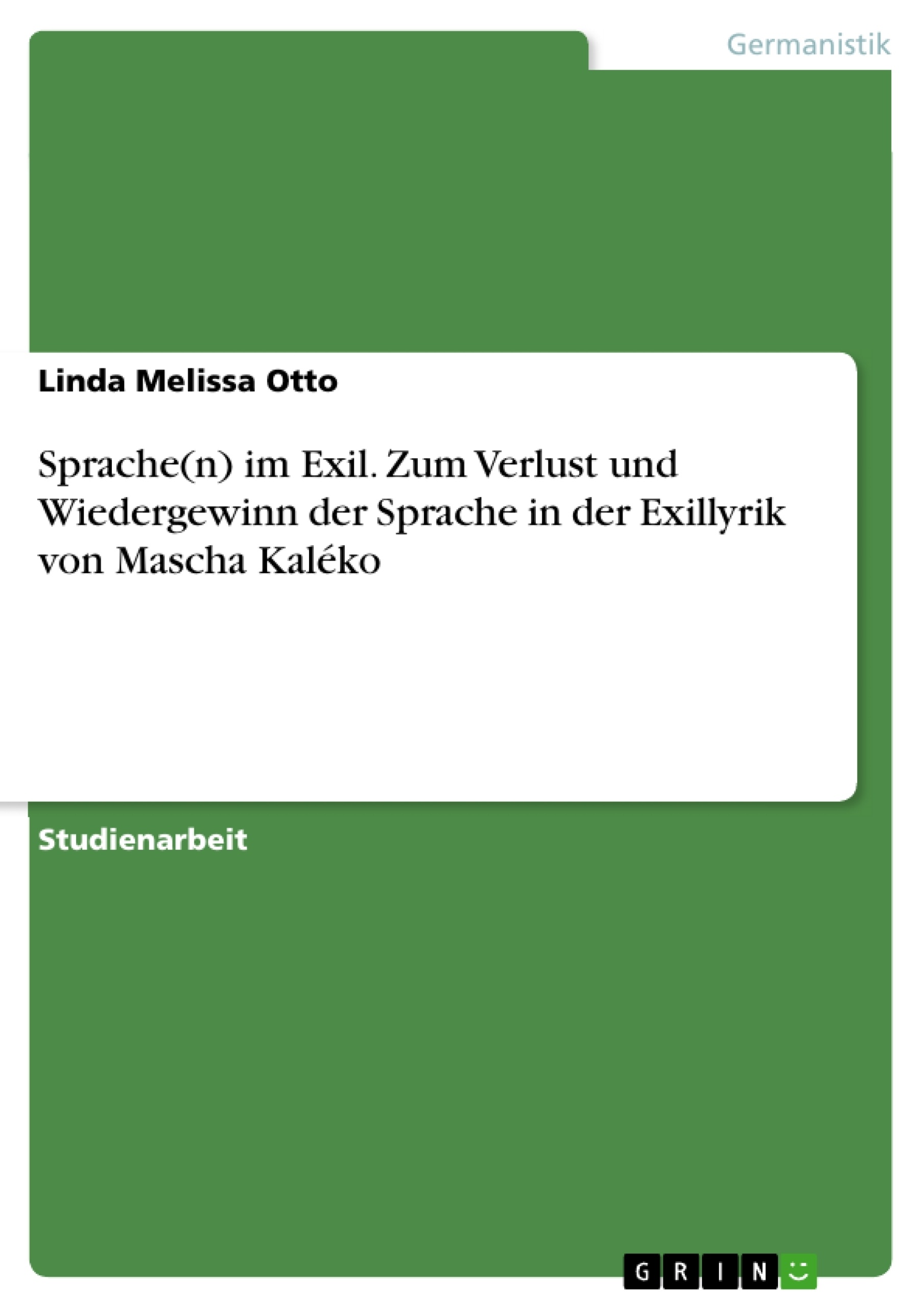Das Thema dieser Hausarbeit ist der Sprachverlust und -wiedergewinn in der Exillyrik von Mascha Kaléko, das anhand der Fragestellung "Wie entwickelte sich der Sprachverlust bei Mascha Kaléko innerhalb des New Yorker Exils?" untersucht werden soll. Zunächst wird ein historischer Überblick über das Thema Sprachverlust im Kontext des Exils gegeben. Dann werden verschiedene Standpunkte zum Thema Sprache(n) im Exil dargestellt. Die Haltung von Mascha Kaléko zu diesem Thema wird eingeordnet und es wird veranschaulicht, wie der Sprachverlust die literaturgeschichtliche Identität von Mascha Kaléko beeinflusst hat.
Anschließend werden die Gedichte Der kleine Unterschied und Momentaufnahme eines Zeitgenossen werden im Hinblick auf Sprachverlust und -wiedergewinn untersucht, wobei der Zusammenhang von Form und Inhalt und wichtige sprachliche Aspekte erörtert werden. Abschließend wird mit Bezug auf den historischen Kontext dargestellt, wie sich der Prozess des Sprachverlusts und -wiedergewinns in den zwei Gedichten abzeichnet. Die Ergebnisse dieser Arbeit werden in einem Fazit zusammengetragen.
Exilautor*innen befindet sich in einer extremen Lebenslage. Oft sind es politische, religiöse oder rassistische Beweggründe, die sie zur Flucht in ein anderes Land zwingen. Durch den Heimatverlust sind sie auch von sprachlicher Entwurzelung und von Sprachverlust bedroht, was den Verlust von Heimatgefühl und Identität oft noch verstärkt. Der Topos Sprachverlust im Zusammenhang mit der Exilerfahrung kann auf die aktuellen Themen Auswanderung, Flucht und neue Heimatsuche übertragen werden. Die Auseinandersetzung mit den Gedichten deutscher Exilschriftsteller*innen kann ein Mittel sein, um über Sprache(n) im Exil zu reflektieren und um Verständnis über Sprachschwierigkeiten von Geflüchteten zu erlangen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Mascha Kalékos Sprache(n) im Exil
- 2.1 Mascha Kalékos Sprache(n) im Exil
- 2.2 Gedichtanalyse Mascha Kaléko Der kleine Unterschied
- 2.3 Gedichtanalyse Mascha Kaléko Momentaufnahmen eines Zeitgenossen
- 3. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Sprachverlust und -wiedergewinn in der Exillyrik von Mascha Kaléko im New Yorker Exil. Die zentrale Fragestellung lautet: Wie entwickelte sich der Sprachverlust bei Mascha Kaléko innerhalb des New Yorker Exils? Die Arbeit beleuchtet den historischen Kontext des Sprachverlusts im Exil, analysiert verschiedene Standpunkte zum Thema Sprache(n) im Exil und ordnet Mascha Kalékos Haltung ein. Der Einfluss des Sprachverlusts auf ihre literaturgeschichtliche Identität wird ebenfalls betrachtet.
- Sprachverlust und -wiedergewinn im Exil
- Mascha Kalékos Beziehung zur deutschen Sprache
- Analyse von Kalékos Gedichten im Hinblick auf Sprache
- Der Einfluss des Exils auf Kalékos dichterisches Werk
- Sprachliche Identität und kulturelle Zugehörigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Sprachverlusts und -wiedergewinns in der Exillyrik ein, insbesondere im Kontext der Erfahrungen von Mascha Kaléko im New Yorker Exil. Sie skizziert die Forschungsfrage und den methodischen Ansatz der Arbeit, der eine historische Betrachtung des Themas mit einer detaillierten Analyse von Kalékos Gedichten verbindet. Die Einleitung betont die Relevanz des Themas, indem sie den Bezug zur aktuellen Situation von Geflüchteten und deren sprachlichen Herausforderungen herstellt. Die Arbeit wird als Beitrag zum Verständnis von Sprachschwierigkeiten bei Geflüchteten positioniert.
2.1 Mascha Kalékos Sprache(n) im Exil: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Perspektiven auf den Sprachaspekt in der Exillyrik, von der Betonung der Unverzichtbarkeit der Muttersprache bis hin zu einer produktiven Mehrsprachigkeit im Exil. Es wird dargestellt, wie Mascha Kaléko sich im amerikanischen Exil um den Erhalt der deutschen Sprache bemühte, die sie als untrennbaren Bestandteil ihrer Identität und kulturellen Zugehörigkeit sah. Das Kapitel zitiert verschiedene Autoren und ihre Standpunkte zum Thema Sprache und Heimat, unterstreicht die existenzielle Bedrohung für exilierte Lyriker*innen durch den Sprachverlust und analysiert Kalékos starke emotionale Bindung an die deutsche Sprache, besonders den Berliner Dialekt, der ihren dichterischen Stil prägte. Es wird der Gedanke der Unvertauschbarkeit der Muttersprache diskutiert, sowie der Einfluss der Mehrsprachigkeit in ihrer Kindheit auf ihr späteres Schaffen.
Schlüsselwörter
Mascha Kaléko, Exillyrik, Sprachverlust, Sprachwiedergewinn, New Yorker Exil, deutsche Sprache, Identität, kulturelle Zugehörigkeit, Gedichtanalyse, Muttersprache, Heimat, Exil, Sprachproblem, literaturgeschichtliche Identität, Berliner Dialekt.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Mascha Kalékos Sprache(n) im Exil
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Sprachverlust und -wiedergewinn in der Exillyrik von Mascha Kaléko während ihres New Yorker Exils. Der zentrale Fokus liegt auf der Entwicklung des Sprachverlusts und seiner Auswirkungen auf Kalékos Identität und literarisches Schaffen.
Welche Forschungsfrage wird gestellt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Wie entwickelte sich der Sprachverlust bei Mascha Kaléko innerhalb des New Yorker Exils?
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet den historischen Kontext des Sprachverlusts im Exil, analysiert verschiedene Standpunkte zum Thema Sprache(n) im Exil, ordnet Mascha Kalékos Haltung ein und betrachtet den Einfluss des Sprachverlusts auf ihre literaturgeschichtliche Identität. Weitere Themen sind Mascha Kalékos Beziehung zur deutschen Sprache, die Analyse ihrer Gedichte im Hinblick auf Sprache, der Einfluss des Exils auf ihr dichterisches Werk sowie sprachliche Identität und kulturelle Zugehörigkeit.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Hauptkapitel (mit Unterkapiteln zur Analyse von Kalékos Gedichten "Der kleine Unterschied" und "Momentaufnahmen eines Zeitgenossen") und ein Fazit. Das Hauptkapitel beleuchtet verschiedene Perspektiven auf den Sprachaspekt in der Exillyrik und analysiert Kalékos Bemühungen um den Erhalt der deutschen Sprache im amerikanischen Exil.
Wie wird die Forschungsfrage beantwortet?
Die Beantwortung der Forschungsfrage erfolgt durch eine historische Betrachtung des Themas und eine detaillierte Analyse von Kalékos Gedichten. Die Arbeit zitiert verschiedene Autoren und deren Standpunkte zum Thema Sprache und Heimat und analysiert Kalékos emotionale Bindung an die deutsche Sprache, insbesondere den Berliner Dialekt.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Mascha Kaléko, Exillyrik, Sprachverlust, Sprachwiedergewinn, New Yorker Exil, deutsche Sprache, Identität, kulturelle Zugehörigkeit, Gedichtanalyse, Muttersprache, Heimat, Exil, Sprachproblem, literaturgeschichtliche Identität, Berliner Dialekt.
Welche Gedichte werden analysiert?
Die Arbeit analysiert mindestens zwei Gedichte von Mascha Kaléko: "Der kleine Unterschied" und "Momentaufnahmen eines Zeitgenossen".
Welche Bedeutung hat die Einleitung?
Die Einleitung führt in die Thematik ein, skizziert die Forschungsfrage und den methodischen Ansatz. Sie betont die Relevanz des Themas im Bezug auf die Situation von Geflüchteten und deren sprachliche Herausforderungen.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
(Das Fazit ist im bereitgestellten Text nicht explizit zusammengefasst, jedoch wird im Kontext der Fragestellung deutlich, dass die Arbeit die Entwicklung des Sprachverlusts bei Mascha Kaléko im New Yorker Exil untersucht und die Auswirkungen auf ihre Identität und ihr Werk beleuchtet.)
- Arbeit zitieren
- Linda Melissa Otto (Autor:in), 2022, Sprache(n) im Exil. Zum Verlust und Wiedergewinn der Sprache in der Exillyrik von Mascha Kaléko, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1277946