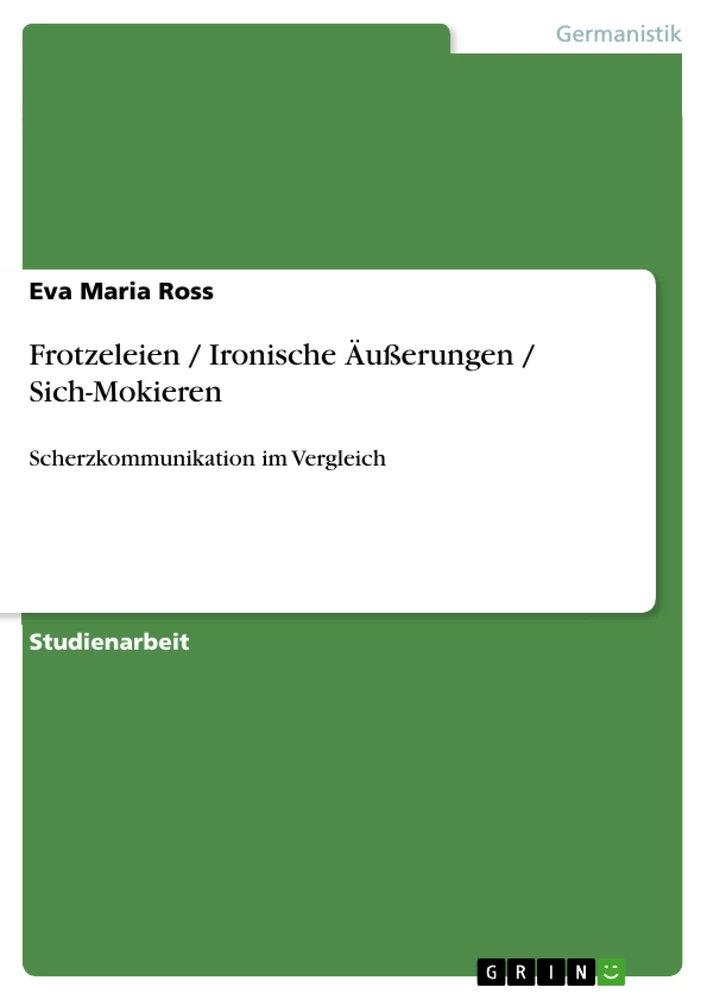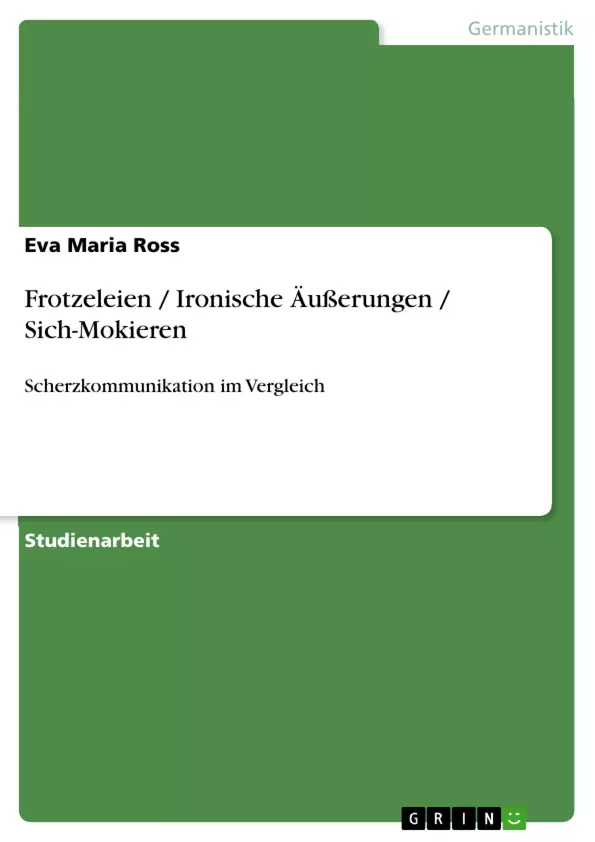Die Beschäftigung mit Scherzkommunikation im Bereich der Linguistik verzeichnet noch keine lange Tradition. Erste Forschungsarbeiten über die Bedeutung von Lachen, Witz und Humor in sprachlichen Handlungen finden sich in wissenschaftlichen Bereichen wie der Ethnologie, Soziologie oder Psychologie. Die Analyse von Scherzaktivitäten in kommunikativer Interaktion ist erst in den letzten Jahrzehnten Teil linguistischer Untersuchungen geworden und kann immer noch als Stiefkind der Gesprächanalyse betrachtet werden. Trotzdem reicht das Spektrum der Arbeiten soweit, dass Wissenschafter und Wissenschaftlerinnen Scherzkommunikation nach verschiedenen Typen differenzieren.
Man unterscheidet unter anderem zwischen ironischen Äußerungen, Frotzeleien und Sich-Mokieren.
In diesem Zusammenhang sollen folgende Fragen im Mittelpunkt stehen: Wie kann man Scherzkommunikation definieren? Was genau zeichnet die drei Arten scherzhafter Äußerungen aus? Worin liegen ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede? Sind scharfe Trennlinien zwischen den verschiedenen Formen zu beobachten oder vermischen und verschwimmen diese?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Scherzkommunikation
- 3. Ironie
- 3.1 Was ist Ironie?
- 3.2 Strukturmerkmale der Ironie
- 3.3 Funktion von Ironie
- 4. Frotzeln
- 4.1 Was ist Frotzeln?
- 4.2 Strukturmerkmale des Frotzelns
- 4.3 Funktion des Frotzelns
- 5. Sich-Mokieren
- 5.1 Was ist Sich-Mokieren?
- 5.2 Strukturmerkmale des Sich-Mokieren
- 5.3 Funktion des Sich-Mokieren
- 6. Unterschiede und Gemeinsamkeiten
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht drei Formen scherzhafter Äußerungen – Ironie, Frotzeln und Sich-Mokieren – im Kontext der Gesprächsanalyse. Ziel ist es, die Merkmale und Funktionen dieser Kommunikationsformen zu beschreiben und ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszuarbeiten. Die Analyse basiert auf bestehenden Forschungsarbeiten zur Scherzkommunikation.
- Definition und Abgrenzung von Scherzkommunikation
- Charakterisierung der drei Formen ironischer Äußerungen (Ironie, Frotzeln, Sich-Mokieren)
- Analyse der Strukturmerkmale der einzelnen Formen
- Vergleich der Funktionen der drei Kommunikationsformen
- Untersuchung der Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den drei Formen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Scherzkommunikation und ihre linguistische Erforschung ein. Sie verortet die Arbeit im Kontext bestehender Forschung und benennt die zentralen Fragestellungen: Definition von Scherzkommunikation, Charakterisierung von Ironie, Frotzeln und Sich-Mokieren, sowie deren Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit und die verwendeten Forschungsansätze.
2. Scherzkommunikation: Dieses Kapitel behandelt allgemeine Merkmale und Funktionen von Scherzkommunikation basierend auf den Arbeiten von Helga Kotthoff. Es werden Aspekte wie die Rolle des Lachens, die Verwendung von Mehrdeutigkeiten und die kreative Gestaltung der Sprache beleuchtet. Die Bedeutung von Inkongruenz, Aggression und Entspannung wird ebenso diskutiert wie die Funktion von geteiltem Wissen und die verschiedenen sozialen Ziele der Scherzkommunikation, einschließlich Solidarisierung und Bewältigung von Konflikten, sowie Unterhaltung.
3. Ironie: Kapitel 3 widmet sich der Ironie als rhetorischer Figur. Es beginnt mit einer Definition von Ironie, die den Gegensatz zwischen dem Ausgesprochenen und dem Gemeinten betont. Es werden die Strukturmerkmale der Ironie, insbesondere die Indirektheit und die negative Bewertung, detailliert analysiert. Der witzig-komische Charakter der Ironie und ihre verschiedenen Ausdrucksformen werden erläutert, inklusive der Verwendung von Mimik, Gestik und Nachahmung.
Schlüsselwörter
Scherzkommunikation, Ironie, Frotzeln, Sich-Mokieren, Gesprächsanalyse, Linguistik, Humor, Kommunikation, Strukturmerkmale, Funktionen, Gemeinsamkeiten, Unterschiede, empirische Gesprächsforschung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse von Ironie, Frotzeln und Sich-Mokieren
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert drei Formen scherzhafter Äußerungen: Ironie, Frotzeln und Sich-Mokieren. Sie untersucht deren Merkmale, Funktionen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Kontext der Gesprächsanalyse.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit beschreibt die Merkmale und Funktionen von Ironie, Frotzeln und Sich-Mokieren. Sie vergleicht diese drei Kommunikationsformen und hebt Gemeinsamkeiten und Unterschiede hervor. Die Analyse basiert auf bestehender Forschung zur Scherzkommunikation.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Abgrenzung von Scherzkommunikation, die Charakterisierung der drei Formen ironischer Äußerungen (Ironie, Frotzeln, Sich-Mokieren), die Analyse der Strukturmerkmale jeder Form, den Vergleich der Funktionen der drei Kommunikationsformen und die Untersuchung der Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den drei Formen.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit ist in sieben Kapitel gegliedert: Einleitung, Scherzkommunikation, Ironie (mit Unterkapiteln zu Definition, Strukturmerkmalen und Funktion), Frotzeln (mit ähnlichen Unterkapiteln wie bei Ironie), Sich-Mokieren (ebenfalls mit Unterkapiteln zu Definition, Strukturmerkmalen und Funktion), Unterschiede und Gemeinsamkeiten, und Fazit.
Was wird im Kapitel "Scherzkommunikation" behandelt?
Dieses Kapitel behandelt allgemeine Merkmale und Funktionen von Scherzkommunikation basierend auf der Forschung von Helga Kotthoff. Es beleuchtet Aspekte wie die Rolle des Lachens, die Verwendung von Mehrdeutigkeiten, kreative Sprachgestaltung, Inkongruenz, Aggression, Entspannung, geteiltes Wissen und verschiedene soziale Ziele der Scherzkommunikation (Solidarisierung, Konfliktbewältigung, Unterhaltung).
Wie wird Ironie in der Arbeit definiert und analysiert?
Kapitel 3 definiert Ironie als rhetorische Figur, die den Gegensatz zwischen dem Ausgesprochenen und dem Gemeinten betont. Es analysiert detailliert die Strukturmerkmale (Indirektheit, negative Bewertung) und den witzig-komischen Charakter der Ironie, einschließlich der Verwendung von Mimik, Gestik und Nachahmung.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Scherzkommunikation, Ironie, Frotzeln, Sich-Mokieren, Gesprächsanalyse, Linguistik, Humor, Kommunikation, Strukturmerkmale, Funktionen, Gemeinsamkeiten, Unterschiede, empirische Gesprächsforschung.
Welche Forschungsansätze werden verwendet?
Die Arbeit basiert auf bestehenden Forschungsarbeiten zur Scherzkommunikation, deren genaue Spezifikation im Text erläutert wird. Es handelt sich um eine linguistische Analyse mit Fokus auf Gesprächsanalyse.
Gibt es eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel, die die zentralen Inhalte und Ergebnisse jedes Kapitels kurz beschreibt.
- Arbeit zitieren
- Eva Maria Ross (Autor:in), 2007, Frotzeleien / Ironische Äußerungen / Sich-Mokieren, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/127806