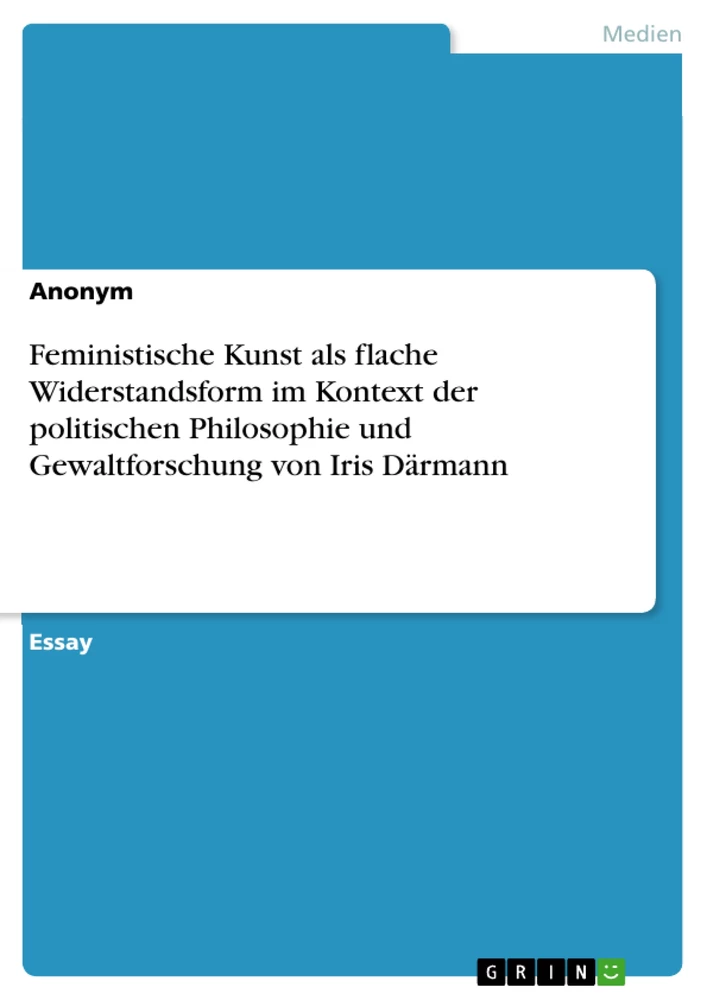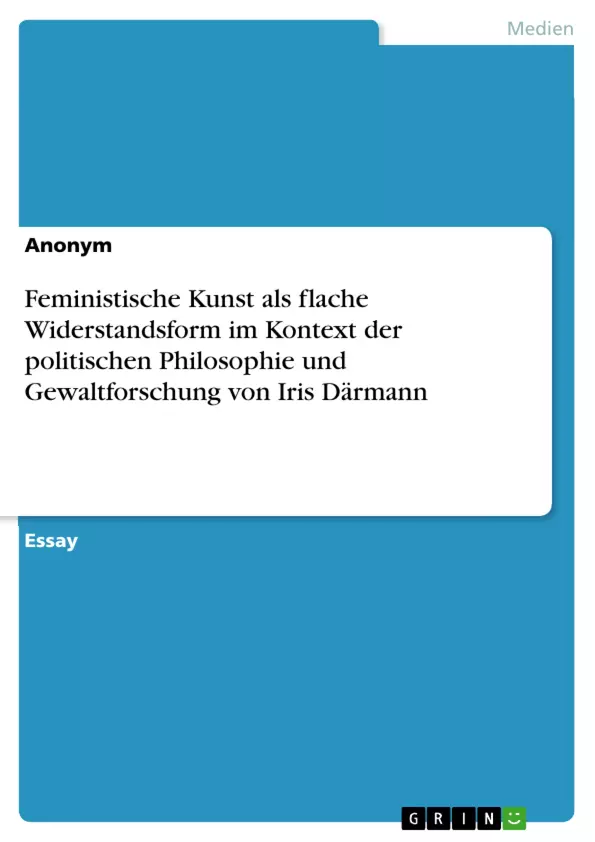Im Folgenden stelle ich die Untersuchungen und wesentliche Schlussfolgerungen der Kulturwissenschaftlerin und Philosophin Iris Därmann zur Gewalt- und Widerstandsforschung vor. Diese setze ich in den Kontext der Arbeit feministischer Künstler*innen. Nach Därmann sind nicht nur Flucht, Selbstverstümmelung, Freitod oder das reine Überleben sogenannte „flache“ Widerstandsformen – im Gegensatz zu bewaffneten Revolutionen. Ich argumentiere, dass auch künstlerische Praktiken, die mit Eigensinn und Ungehorsam ein etabliertes Machtgefüge aushöhlen oder unterwandern, widerständig sind. Feministische künstlerische Praxis verkörpert das „Schwergewicht der Zartheit“, wie Därmann es nennt. Revolutionäres Handeln braucht keine Waffen, kein Blutvergießen und keine politische Machtdemonstration. Leise, einfallsreich und beharrlich – die hier vorgestellten Künstler*innen leben ihren eigenen Widerstand.
Inhaltsverzeichnis
- Was ist Feminismus?
- Iris Därmann: „Flache“ Widerstandspraktiken
- Nora Al-Badri: „The Other Nefertiti“
- Widerstand als „riskante Praxis der gefährlichen Improvisation“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht feministische Kunst als eine Form des „flachen“ Widerstands, wie ihn die Kulturwissenschaftlerin und Philosophin Iris Därmann definiert. Die Arbeit setzt Därmanns Thesen in den Kontext der Arbeit feministischer Künstler*innen und argumentiert, dass künstlerische Praktiken, die Machtgefüge untergraben, ebenfalls widerständig sind.
- Feministische Kunst als „flache“ Widerstandspraxis
- Die Bedeutung von Eigensinn und Ungehorsam
- Das „Schwergewicht der Zartheit“ als revolutionäre Kraft
- Der Zusammenhang zwischen feministischer Kunst und politischer Philosophie
- Widerstand im Kontext von Gewaltforschung
Zusammenfassung der Kapitel
- Was ist Feminismus? Dieses Kapitel definiert den Begriff Feminismus und erläutert, wie feministische Kunst dazu beitragen kann, historische Machtgefüge in Frage zu stellen und zu verändern.
- Iris Därmann: „Flache“ Widerstandspraktiken: Dieses Kapitel stellt die Arbeit der Philosophin Iris Därmann vor, die sich mit „flachen“ Widerstandspraktiken im Kontext des Kolonialismus und der Versklavung auseinandersetzt. Dabei werden Beispiele wie „stealing themselves“ und „stealing away“ vorgestellt und die Bedeutung von Eigensinn, Ungehorsam und Sabotage als widerständige Formen hervorgehoben.
- Nora Al-Badri: „The Other Nefertiti“: Dieses Kapitel analysiert das Werk der Künstlerin Nora Al-Badri, die gemeinsam mit Nikolai Nelles die Büste der Nofretete digitalisiert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat. Es wird untersucht, wie diese Handlung als eine subversive Intervention verstanden werden kann, die Machtverhältnisse in Frage stellt und den Zugang zu Wissen demokratisiert.
- Widerstand als „riskante Praxis der gefährlichen Improvisation“: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Konzept des Widerstands als einer riskanten Praxis, die häufig mit Flucht, Desertion und „Passivierung“ verbunden ist. Am Beispiel der Desertion preußischer Soldaten im Siebenjährigen Krieg wird gezeigt, wie individuelle Widerstandsformen kollektiv zu einer revolutionären Makropolitik führen können.
Schlüsselwörter
Feministische Kunst, „flache“ Widerstandspraktiken, Iris Därmann, Eigensinn, Ungehorsam, Sabotage, Nora Al-Badri, „The Other Nefertiti“, digitale Replikation, Museum, Machtverhältnisse, Wissen, „stealing themselves“, „stealing away“, Flucht, Passivierung, Desertion, Gewaltforschung, politische Philosophie.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Iris Därmann unter "flachem" Widerstand?
Es handelt sich um nicht-bewaffnete Widerstandsformen wie Flucht, Sabotage, Eigensinn oder passiven Ungehorsam, die Machtgefüge unterwandern.
Was ist das Projekt "The Other Nefertiti"?
Die Künstlerin Nora Al-Badri digitalisierte die Büste der Nofretete ohne Erlaubnis des Museums, um den Zugang zum kulturellen Erbe zu demokratisieren.
Wie hängen Kunst und politischer Widerstand zusammen?
Künstlerische Praktiken können etablierte Machtgefüge aushöhlen, indem sie "das Schwergewicht der Zartheit" nutzen und Alternativen aufzeigen.
Warum ist Desertion eine Form des Widerstands?
Därmann analysiert Desertion (z.B. im Siebenjährigen Krieg) als individuelle Verweigerung, die kollektiv politische Systeme destabilisieren kann.
Was bedeutet "stealing themselves"?
Ein Begriff aus der Versklavungsgeschichte: Wenn Menschen flüchten, entziehen sie den Besitzern ihr "Eigentum" – sich selbst – und leisten so Widerstand.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2022, Feministische Kunst als flache Widerstandsform im Kontext der politischen Philosophie und Gewaltforschung von Iris Därmann, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1278625