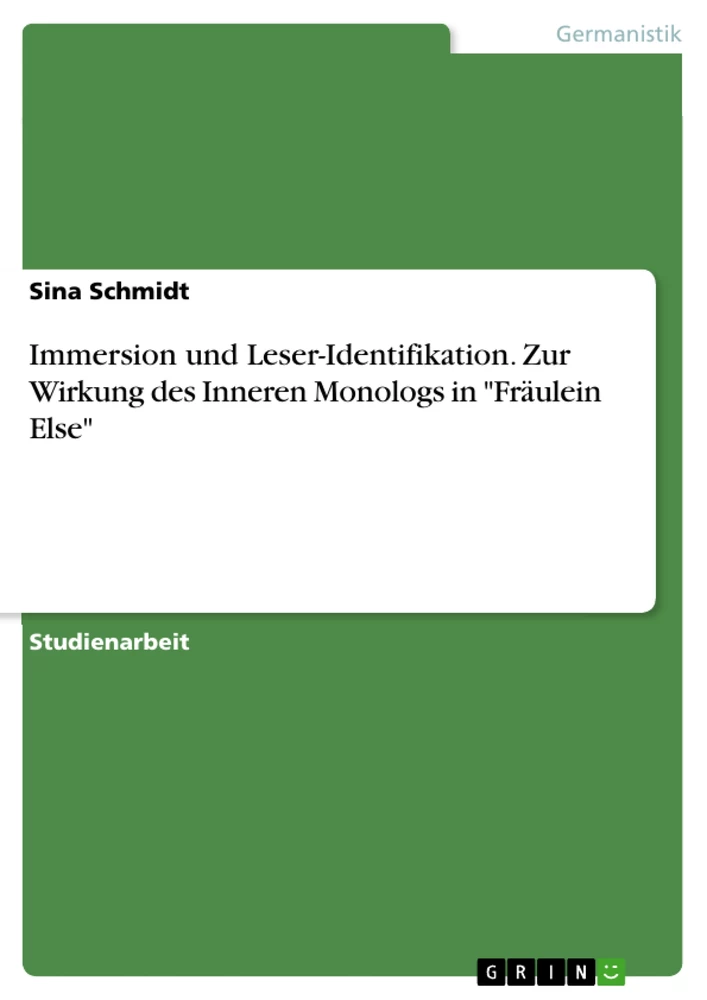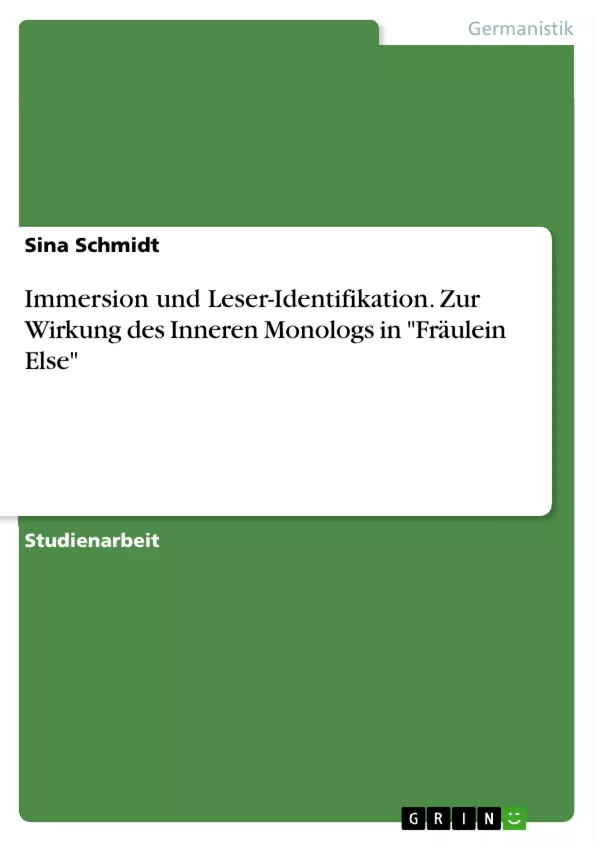Vielen Lesern ist folgendes Phänomen vermutlich bekannt. Das Phänomen, dass man beim Lesen eines guten Buchs derart vertieft ist, dass man jegliches Gefühl für Raum und Zeit vergisst. Der Eindruck der Leser, Teil der narrativen Welt zu sein, ist daran geknüpft, dass sie die Geschichte durch die Augen bzw. aus der Perspektive der literarischen Figuren erleben. Lange Zeit galt dieses Immersionsphänomen als Forschungsdesiderat, bis ihm in den letzten Jahren immer mehr Aufmerksamkeit geschenkt wurde. So haben sich auch in der Narratologie viele neue Erkenntnisse hinsichtlich dieses Themas ergeben. Im Zusammenhang mit dem ‚Vertieftsein‘ steht dabei die leserseitige Identifikation mit den Figuren der fiktiven Welt.
Ein Schwerpunkt dieser Arbeit ist es, die Zusammenhänge der Immersion und der Leser-Identifikation aufzuzeigen. Dabei kommt der Erzählperspektive des Inneren Monologs ein bedeutender Teil zu, da er es dem Leser ermöglicht, die narrative Welt und die Handlung aus der Perspektive der Figur wahrzunehmen. Die Grundlage für die Analyse bildet dabei Arthur Schnitzlers Novelle "Fräulein Else" (1924). Sie ist ein Exempel für die erzähltechnische Strategie des Inneren Monologs. Dieser Strategie widmen sich bereits eine Vielzahl von Forschungsbeiträgen, im Zusammenhang mit der Immersion des Lesers gibt es jedoch wenig Erkenntnisse. Das Forschungsziel dieser Arbeit ist die Beantwortung der Frage, wie sich die Erzähltechnik des Inneren Monologs auf die Immersion des Lesers und seine Identifikation mit der Protagonistin Else auswirkt.
Um die Forschungsfrage zu beantworten, werden dem Analyseteil theoretische Grundlagen des Immersionsphänomens und der leserseitigen Identifikation vorangestellt. Danach widmet sich die Arbeit der Erzählperspektive des Inneren Monologs und dem vorliegenden Untersuchungsgegenstand der Arbeit – der Novelle Fräulein Else. Vor dem Hintergrund der vorangegangenen Erkenntnisse soll im letzten Teil die Wirkung von Elses Inneren Monolog auf den Leser analysiert und der Zusammenhang von Immersion und Leser-Identifikation aufgezeigt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Immersion, Leser-Identifikation und Innerer Monolog
- Immersion
- Identifikation
- Erzähltechnik des Inneren Monologs in Arthur Schnitzlers Fräulein Else (1924)
- Immersion und Leser-Identifikation mit der Protagonistin Else
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Wirkung der Erzähltechnik des Inneren Monologs auf die Immersion des Lesers und seine Identifikation mit der Protagonistin Else in Arthur Schnitzlers Novelle "Fräulein Else" (1924). Ziel ist es, die Zusammenhänge zwischen Immersion, Leser-Identifikation und dem Einsatz des Inneren Monologs aufzuzeigen.
- Das Phänomen der Immersion und die verschiedenen Termini, die es beschreiben
- Die Rolle der Leser-Identifikation für ein immersives Leseerlebnis
- Die Erzählperspektive des Inneren Monologs und ihre Bedeutung für Immersion und Identifikation
- Die Analyse von Arthur Schnitzlers "Fräulein Else" als Beispiel für den Inneren Monolog
- Die Wirkung von Elses Innerem Monolog auf den Leser und die Verbindung von Immersion und Leser-Identifikation
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung führt das Thema der Immersion und Leser-Identifikation ein und stellt die Forschungsfrage der Arbeit vor. Sie erklärt, wie diese Aspekte in der Literaturforschung behandelt werden und wie die Novelle "Fräulein Else" als Beispiel dient.
- Immersion, Leser-Identifikation und Innerer Monolog: Dieses Kapitel definiert die ästhetische Illusion und erläutert verschiedene Konzepte wie "transportation", "narrative engagement" und "presence". Es wird die Entwicklung des Begriffs "Immersion" beleuchtet und seine Bedeutung in der Literatur und den neuen Medien diskutiert.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe dieser Arbeit sind Immersion, Leser-Identifikation, Innerer Monolog, ästhetische Illusion, narrative Welt, Textwelt, "Fräulein Else", Arthur Schnitzler und Erzählperspektive.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet „Immersion“ beim Lesen?
Immersion beschreibt das Phänomen, so tief in eine Geschichte einzutauchen, dass man Raum und Zeit vergisst und sich als Teil der narrativen Welt fühlt.
Wie fördert der „Innere Monolog“ die Leser-Identifikation?
Da der Leser die Gedanken und Gefühle der Figur unmittelbar miterlebt, entsteht eine starke Perspektivübernahme, die die Identifikation mit der Figur (z.B. Else) erleichtert.
Worum geht es in Arthur Schnitzlers „Fräulein Else“?
Die Novelle schildert den inneren Konflikt einer jungen Frau, die durch eine moralische Forderung in eine verzweifelte Lage gerät, fast ausschließlich durch ihre eigenen Gedanken.
Was ist der Unterschied zwischen „transportation“ und Immersion?
„Transportation“ beschreibt das Gefühl, in eine Geschichte „entführt“ zu werden, während Immersion eher das „Eintauchen“ und die Präsenz in der Textwelt betont.
Warum gilt „Fräulein Else“ als Exempel für den Inneren Monolog?
Schnitzler nutzt diese Technik meisterhaft, um den Bewusstseinsstrom der Protagonistin ungefiltert darzustellen, was für die damalige Zeit erzähltechnisch revolutionär war.
Welchen Einfluss hat die Erzählperspektive auf die ästhetische Illusion?
Eine unmittelbare Perspektive wie der Innere Monolog minimiert die Distanz zum Text und verstärkt die ästhetische Illusion, wirklich am Geschehen teilzuhaben.
- Quote paper
- Sina Schmidt (Author), 2022, Immersion und Leser-Identifikation. Zur Wirkung des Inneren Monologs in "Fräulein Else", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1280408